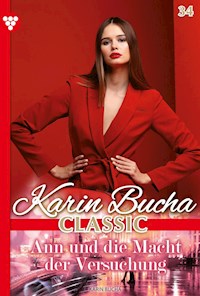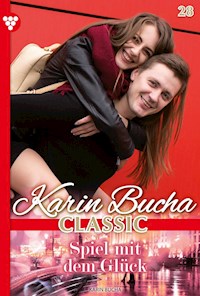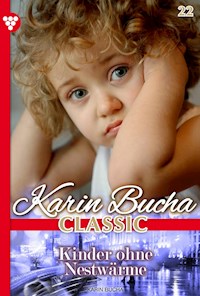Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Karin Bucha Classic
- Sprache: Deutsch
Karin Bucha ist eine der erfolgreichsten Volksschriftstellerinnen und hat sich mit ihren ergreifenden Schicksalsromanen in die Herzen von Millionen LeserInnen geschrieben. Dabei stand für diese großartige Schriftstellerin die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach Fürsorge, Kinderglück und Mutterliebe stets im Mittelpunkt. Karin Bucha Classic ist eine spannende, einfühlsame geschilderte Liebesromanserie, die in dieser Art ihresgleichen sucht. Unablässig wanderte Olaf Bergner in der weitläufigen Halle hin und her. Bis unter das Dach waren seine Schritte zu hören, denn eine geradezu unheimliche Stille herrschte in dem märchenhaften Haus, das Percy Hudson seiner einzigen Tochter und dem geliebten Schwiegersohn hatte erbauen lassen. Manchmal unterbrach Olaf ruckartig seine Wanderung, lauschte mit vorgeneigtem Oberkörper und vernahm kurze aber durchdringende Schreie, die aus dem ersten Stockwerk zu ihm drangen. Dann sah es aus, als wolle er vorwärts stürzen, die breite gewundene Treppe empor, in die Zimmer seiner geliebten Evelyn, die ihre schwerste Stunde durchkämpfte. Doch er bezwang sich. Nur die Rechte legte er an seinen Hals und atmete tief und erregt, als wolle ihm die Angst, die unbeschreibliche, wahnsinnige Angst um das geliebte, kostbare Leben die Luft abschnüren. Der Hausarzt, Doktor Jefferson, hatte ihn in seiner trockenen, energischen Art aus dem Zimmer gewiesen und zur Geduld ermahnt. Der Arzt hatte gut reden, ihn tatenlos dieser Nervenprobe auszusetzen. Was wußte er, was Evelyn, die geliebte Frau, ihm bedeutete? Treueste Lebenskameradin! Vorbildliche Repräsentantin seines Hauses. Zärtlichste Geliebte! Mutter, Elternhaus und Heimat zugleich. Alles hatte er in ihr gefunden in seiner fast fünfzehnjährigen Ehe mit ihr, die jetzt die Krönung durch die Geburt des ersten Kindes erfahren sollte. »Wenn das noch lange so weiter geht, Olaf, werde ich wahnsinnig«, hörte er Percy Hudsons Stimme aus der Tiefe eines der zu gemütlichen Plauderecken gruppierten Sessel kommen. Wie aus schwerem Traum erwachend, strich Bergner sich über die brennenden Augen. Die Anwesenheit des Schwiegervaters hatte er völlig vergessen. »Schrecklich! Schrecklich, Papa!«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karin Bucha Classic – 48 –Vergiss die Heimat nicht
Karin Bucha
Unablässig wanderte Olaf Bergner in der weitläufigen Halle hin und her. Bis unter das Dach waren seine Schritte zu hören, denn eine geradezu unheimliche Stille herrschte in dem märchenhaften Haus, das Percy Hudson seiner einzigen Tochter und dem geliebten Schwiegersohn hatte erbauen lassen.
Manchmal unterbrach Olaf ruckartig seine Wanderung, lauschte mit vorgeneigtem Oberkörper und vernahm kurze aber durchdringende Schreie, die aus dem ersten Stockwerk zu ihm drangen. Dann sah es aus, als wolle er vorwärts stürzen, die breite gewundene Treppe empor, in die Zimmer seiner geliebten Evelyn, die ihre schwerste Stunde durchkämpfte.
Doch er bezwang sich. Nur die Rechte legte er an seinen Hals und atmete tief und erregt, als wolle ihm die Angst, die unbeschreibliche, wahnsinnige Angst um das geliebte, kostbare Leben die Luft abschnüren.
Der Hausarzt, Doktor Jefferson, hatte ihn in seiner trockenen, energischen Art aus dem Zimmer gewiesen und zur Geduld ermahnt.
Der Arzt hatte gut reden, ihn tatenlos dieser Nervenprobe auszusetzen. Was wußte er, was Evelyn, die geliebte Frau, ihm bedeutete?
Treueste Lebenskameradin! Vorbildliche Repräsentantin seines Hauses. Zärtlichste Geliebte! Mutter, Elternhaus und Heimat zugleich. Alles hatte er in ihr gefunden in seiner fast fünfzehnjährigen Ehe mit ihr, die jetzt die Krönung durch die Geburt des ersten Kindes erfahren sollte.
»Wenn das noch lange so weiter geht, Olaf, werde ich wahnsinnig«, hörte er Percy Hudsons Stimme aus der Tiefe eines der zu gemütlichen Plauderecken gruppierten Sessel kommen.
Wie aus schwerem Traum erwachend, strich Bergner sich über die brennenden Augen. Die Anwesenheit des Schwiegervaters hatte er völlig vergessen.
Er verhielt den Schritt, sah auf die mächtige, jetzt zusammengesunkene Gestalt Hudsons und flüsterte geistesabwesend:
»Schrecklich! Schrecklich, Papa!«
Der alte Mann, der mit abgöttischer Liebe an seinem einzigen Kinde hing, wischte sich dicke Schweißtropfen von der Stirn. Sein Blick irrte durch die wie ausgestorben wirkende Halle.
Hudsons Augen wanderten zurück, blieben an der hohen Gestalt des Schwiegersohnes haften. Kläglich bat er: »Könntest du nicht einmal nach Evelyn sehen?«
»Unmöglich, Papa!« Bergner machte eine erschreckte Handbewegung. »Jefferson hat mich einmal hinausgefeuert. Das genügt mir. Wir müssen Geduld haben. Hoffentlich ist bald alles vorüber.«
Er ließ sich stöhnend neben seinem Schwiegervater nieder, stützte die Ellbogen auf die Knie und barg den Kopf in die Hände. So saß er bewegungslos, als habe er alles um sich vergessen. Dabei lauschte er doch nur mit allen Sinnen in die jetzt geradezu unheimliche Stille des Hauses.
Eine Tür wurde geöffnet. Schritte nahten. Doktor Jefferson schaute über die Brüstung vom ersten Stockwerk herunter in die Halle und winkte den sich schwerfällig erhebenden Bergner zu sich.
Dieser zögerte noch, dann aber jagte er förmlich die Stufen hinauf.
»Herr Doktor –?«
Ernst blickte Jefferson in das erregt zuckende Gesicht Bergners.
»Wir müssen Professor Burgk rufen. Wo ist das Telefon?«
Bergner erblaßte bis in die Lippen. Ganz stumm ging er vor dem Arzt her, überquerte den breiten Gang und öffnete dann die Tür zu seinem Arbeitszimmer.
»Bitte, Doktor!« Er ließ den Arzt an sich vorbeigehen und folgte ihm. Ihm war jämmerlich zumute.
Mit verschränkten Armen lehnte er am Bücherschrank und ließ kein Auge von Jefferson. Kein Wort der kurzen Unterredung, die der Arzt mit dem berühmten Chirurgen führte, entging ihm.
Endlich legte Jefferson den Hörer in die Gabel zurück. Da stand Bergner auch schon neben ihm.
»Burgk kommt sofort. Wir müssen operieren. Leider ist ein Transport in Burgks Klinik nicht mehr möglich. Schwester Mary bereitet schon alles vor.«
Jefferson fühlte seine Hände gepackt. Bergner preßte sie wie in einem Schraubstock.
»Sagen Sie mir die Wahrheit, Jefferson«, keuchte er. In seinen Augen brannte helle Verzweiflung. »Werden beide leben? Meine Frau und das Kind?«
»Ich hoffe es –«
»Doktor!« Bergner ließ den Arzt los. Seine Hände sanken kraftlos herab. Dicke Schweißperlen standen auf seiner Stirn. Sein Mund öffnete sich. Aber nur ein dumpfer Laut entrang sich ihm. Dann riß sich Bergner zusammen. »Sie müssen alles tun, Jefferson, hören Sie? Ich vertraue Ihnen und Burgk grenzenlos.«
Jefferson rieb ratlos die Hände gegeneinander. Mit aller Eindringlichkeit begegnete er Bergners hilfeheischenden Augen.
»Vergessen Sie nicht, daß wir nur Handlanger Gottes sind. Das letzte Wort spricht er.« Er zwang sich zu einem ermunternden Lächeln. »Aber seien Sie nicht so verzweifelt, Bergner. Wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Und Ihre Frau Gemahlin will leben. Sie ist so beispiellos tapfer, daß man sie nur bewundern kann.«
Wieder begann Olaf Bergner seine endlose Wanderung durch die Halle. Wieder lagerte die unheimliche Stille über dem Haus, die dennoch nichts Beruhigendes an sich hatte. Im Gegenteil, sie wirkte aufreizend, peitschte die Sinne auf, denn alle wußten, daß in einem der hohen Zimmer die Entscheidung fiel über Leben und Tod.
Percy Hudson schien noch kleiner in seinem Sessel geworden zu sein. Er fühlte sich wie ausgepumpt. Olaf hatte ihm wahrheitsgemäß über seine kurze Aussprache mit Jefferson berichtet. Er war davon wie zerschmettert.
Immer mehr steigerte sich Olaf Bergner in seine Gedanken hinein, so daß er nicht den dünnen Schrei vernahm, der Percy Hudson emporschnellen ließ.
»Hast du – das gehört, Olaf?« stieß er heiser vor Erregung hervor.
Olaf Bergner verhielt den Schritt und hob lauschend den Kopf. Da war es wieder, dieses zarte Kinderweinen. War das nicht wie Musik? Wie eine erlösende, beseligende Melodie?
In der ersten Etage wurde es lebhaft. Türen wurden geöffnet und geschlossen. Die beiden Männer standen abwartend, wie angewurzelt.
Da, ein leichter Tritt. Schwester Mary neigte sich über das Geländer und winkte den beiden Männern zu.
Bergner stürmte voran, langsam gefolgt von Hudson.
»Nun – Schwester?« forschte Bergner atemlos.
Schwester Mary streckte ihre Hände den beiden Männern entgegen.
»Herzlichen Glückwunsch! Ein Sohn!«
»Und – meine Frau?« Schwer rang sich die Frage über Bergners Lippen.
»Die Ärzte sind noch bei ihr«, erwiderte sie, und den beiden Männern entging in ihrer Freude, daß kein Lächeln auf den mütterlichen Zügen der Schwester stand. »Kommen Sie. Ich führe Sie zu dem Kind.«
Unwillkürlich schob Bergner seine Hand unter den Arm des Schwiegervaters. So traten sie Arm in Arm über die Schwelle zu dem Vorraum, der in das Schlafzimmer der jungen Herrin dieses Hauses führte.
Auf Zehenspitzen folgten sie der Schwester zu dem kostbar ausgestatteten Kinderbett, worin gebadet und gewickelt der künftige Erbe lag.
Ergriffen neigte sich Olaf Bergner zu dem winzigen Menschenkind hinab.
»Mein Sohn«, flüsterte er und fühlte sein Herz vor Freude hart gegen die Rippen pochen. »Darf ich jetzt zu meiner Frau?« Er richtete sich auf und wandte sich an die abseits stehende Schwester.
Durch Jeffersons Eintritt wurde die Schwester einer Antwort enthoben. Er nickte Bergner zu.
»Gehen Sie hinein. Professor Burgk ist noch bei ihr.«
Bergner zitterte. Kaum wollten ihm die Füße gehorchen. Behutsam trat er in den weiten Raum voller Harmonie und Schönheit, aus dem man die Spuren der Operation bereits entfernt hatte.
Das breite Bett mit den seidenen Kissen und Decken hatte man schräg ins Zimmer gestellt. Und dann stockte sein Fuß und auch sein Atem. War das seine strahlend schöne Evelyn? War das überhaupt noch ein Mensch aus Fleisch und Blut? Mit schneeigem Antlitz, matt, teilnahmslos, ruhte sie in den Kissen. Bläulich waren die Augen umschattet. Der blasse Mund war wie im Schmerz verzogen.
Evelyn Bergner hielt die Augen geschlossen. Tastend, suchend glitten ihre Hände über die Decke.
Voll Erbarmen neigte sich Bergner zu seiner jungen Frau hinab. Sein tiefes Erschrecken verbarg er hinter einem verkrampften Lächeln.
»Evelyn, Liebes!«
Ihre Lider zuckten. Sie schlug die Augen auf, große, brennende, fiebernde Augen. Augen, die in einem überströmenden Glück aufleuchteten, als sie den Gatten erkannte. Ein Lächeln, unsagbar glückselig, nahm den Schmerz von den schönen Zügen und verklärte sie.
»Olaf«, flüsterte sie und versuchte ihm die Hände entgegenzustrecken.
Rasch kam er ihr zu Hilfe und nahm sie behutsam auf und drückte voll Inbrunst seine Lippen darauf. »Es ist ein – Sohn, Olaf.«
Überwältigt von seinen Gefühlen, barg er sein Gesicht in ihre fieberheißen Hände.
»Ja, ein Sohn, Evelyn, und ich danke dir dafür. Wie geht es dir, Liebes?«
Ihre Augen irrten hinüber zu der weißbekittelten Gestalt des Professors, der am Fenster lehnte und ihr aufmunternd zunickte. Langsam trat er näher.
»Muß ich – sterben, Herr Professor?« fragte sie leise, eindringlich und wie es schien ohne innere Auflehnung gegen ein unerbittliches Schicksal.
»Evelyn!« rief Bergner da entsetzt und legte den Arm um die geliebte Frau.
»Aber – liebe, gnädige Frau«, wehrte Burgk, betroffen von dem tiefen Ernst der jungen Mutter, ab.
Wie ein müdes Kind kuschelte sie sich in des Gatten Arme und schloß vorübergehend die Augen. Als sich die schweren Lider wieder öffneten, lag ein schier überirdisches Leuchten darin.
»Ich weiß es besser, Professor. Sie dürfen mir die Wahrheit sagen. Wie lange noch?«
Bergners Augen hingen voll Entsetzen an dem Munde des Arztes, dabei preßte er die geliebte Frau so fest an sein Herz, als könne er damit das geliebte, kostbare Leben festhalten.
»Herr Professor«, mahnte Bergner bittend um Aufschluß. Da wandte sich Burgk ab und ging aus dem Zimmer. Lautlos schnappte die Tür hinter ihm ins Schloß.
Totenstille ließ er hinter sich, in dem Raum, den Bergner mit aller Liebe und Fürsorge für die liebste Frau eingerichtet hatte und der nun erfüllt war mit Verzweiflung.
Mit geschlossenen Augen ruhte Evelyn Bergner weichgebettet im Arm des Gatten. Und neben der Glückseligkeit, dem Gatten den größten Wunsch seines Lebens erfüllt zu haben, wuchs das Leid in ihr. Nein! So tapfer und abgeklärt, wie sie sich nach außen hin gab, war sie gar nicht.
Noch eine Gnadenfrist! dachte sie. Noch eine Gnadenfrist – zum Abschiednehmen.
Bergner neigte sich tiefer über das stille blasse Frauenantlitz. Angst schnürte ihm die Kehle zusammen. Unter den dunklen Wimpern der geliebten Frau quoll es hervor und perlte über die Wangen.
»Evelyn, Liebes, Geliebtes«, stammelte er. »Du darfst nicht von uns gehen. Das Kind braucht dich, unser Sohn! Auch Papa und ich, Evelyn, ich brauche dich so nötig. Was sollen wir ohne dich beginnen? Du –«
»Ach, Olaf.« Jedes Wort mußte sie aus der Tiefe ihres Herzens herausholen. »Neige dich etwas tiefer zu mir«, bat sie mit flüsternder Stimme. Bergner brachte sein Gesicht dem ih-
ren ganz nahe. »Versprich mir etwas, Olaf –«
»Evelyn, du mußt Ruhe haben. Das Sprechen strengt dich an!«
Sie lächelte süß zu ihm auf, dabei rannen heiße Tränen über ihre Wangen. »Meine Zeit ist bemessen, Liebster –«
Aufstöhnend preßte er seine Lippen auf ihren Mund. Immer wieder, bis sie unter seinen Liebkosungen leise seufzte und ihr Kopf zur Seite sank.
Er kniete vor ihr nieder und rief in heller Verzweiflung ihren Namen, bis sich die geliebten blauen Augensterne noch einmal leuchtend öffneten.
»Olaf, nicht traurig sein –«, lächelte sie verklärt. »Du hast mich so glücklich gemacht – so glücklich! Hast nie geklagt, wenn die Sehnsucht nach der Heimat über dich kam. Gehe mit unserem Sohn und Papa nach Deutschland zurück. Unser Sohn soll – Percy-Olaf heißen, und deine Mutter soll ihn an ihr Herz nehmen. Versprich es mir, Olaf –«
»Ich verspreche es dir, Evelyn«, gelobte er ernst und feierlich.
»Ich – danke dir, Olaf.« Sanft glitt sie aus seinen Armen und ruhte sekundenlang bewegungslos in den Kissen. Dann bat sie leise: »Rufe Papa, Olaf – und bringe mir – das Kind.«
Bergner taumelte empor und ins Nebenzimmer. Schleier lagen vor seinen Augen.
Hudson erschrak, als er den Schwiegersohn vor sich sah. Er schien ihm um Jahre gealtert.
»Evelyn, Papa – sie will dich sehen – und das Kind.«
Bergner zitterte so heftig, daß er kaum das Kind zu halten vermochte, das die Schwester ihm in den Arm legte.
Mit großen, glänzenden Augen schaute Evelyn ihnen entgegen, den drei Menschen, die ihr das Liebste in der Welt bedeuteten.
»Papa, lieber, guter Papa!« Matt streckte sie ihm die Hand entgegen.
»Evelyn, geliebtes Kind.« Die Schultern des alten Hudson zuckten, und auch die Hand zitterte, die zärtlich über das gelöste Blondhaar seines Kindes strich.
Über Evelyns Kopf hinweg glitt sein Blick zu Bergner, doch dieser sah nicht die stumme, erschütternde Bitte in den Augen des alten Mannes, sondern legte das Kind in die Arme seiner Frau.
Er sah nur das liebreizende, vom Glück verklärte Antlitz Evelyns, dieses in seligem Mutterglück erstrahlende Antlitz, das bereits vom Tod gezeichnet war, und er fühlte es heiß in seine Augen steigen.
Ein einziges Gebet zerriß sein Herz.
»Herrgott, erhalte mir mein Glück. Laß meinem Kinde die Mutter!«
Weihevolle Stille herrschte im Zimmer. Bergner und Hudson verhielten den Atem. Sie sahen, wie eine junge Mutter mit letzter Kraft ihr Kind liebkoste, wie ihre Lippen sich bewegten. Gab sie ihrem Sohn viele gute Segenswünsche mit in sein junges Leben?
Vor den Fenstern verdämmerte der traumschöne Sommertag. Die letzten Sonnenstrahlen huschten über Mutter und Kind. Der letzte goldene Strahl nahm auch den letzten Atemzug von Evelyn Bergner mit hinweg. Wie ein Schatten glitt Schwester Mary ins Zimmer und löste das Kind aus den Armen der Verblichenen.
Das Kind, aus seinem Schlaf geschreckt, begann hilflos zu weinen, als wisse es, daß es soeben das Wertvollste verloren hatte – das Mutterherz.
*
Der Sommer hatte in Deutschland seinen Einzug gehalten. In der »Waldvilla«, dem Bergnerschen Familienbesitz, prangten die Zimmer im schönsten Blumenschmuck, und im weitläufigen Park blühten die bunten Sommerblumen in verschwenderischer Pracht und verbreiteten ihren süßen Duft.
Zwei Gärtner hielten Wege und Rasen in tadelloser Ordnung und pflegten die empfindlichsten Blüten in hellen Treibhäusern.
Am Wohnhaus waren in den letzten Jahren moderne, bauliche Veränderungen vorgenommen worden. Auch den Wintergarten hatte man vergrößert und die Fenster verbreitert. Ungehindert konnten nun Licht und Sonne eindringen.
Durch breite Flügeltüren betrat man die Terrasse, und die Freitreppe, die in den Garten hinabführte, hatte man ebenfalls verbreitert.
Frau Irene Bergner überschaute noch einmal den einladend gedeckten Frühstückstisch, damit auch alles am rechten Platz stand, dann ließ sie sich nieder.
Es war noch früh am Tag. Sie warf einen Blick über die Fassade des Hauses, empor zu den Fenstern der Enkelkinder und lächelte. Noch schienen sie zu schlafen, denn es herrschte merkwürdige Ruhe.
Sie legte die Hände im Schoß zusammen und versank ins Träumen, wie sie es jeden Morgen tat, ehe die übrigen Familienmitglieder am Frühstücks-tisch erschienen.
Ihre Gedanken eilten in die Ferne, bis über den großen Teich hinweg, zu dem jüngsten ihrer beiden Söhne, zu Olaf und seiner Frau Evelyn.
Sie lächelte glücklich vor sich hin. Wie Olaf ihr geschrieben hatte, würde ihm Evelyn bald ein Kind schenken, und dann wäre sein Glück das vollkommenste auf der ganzen Welt.
Frau Irene freute sich mit ihnen, wie sie auch täglich das Glück ihres Ältesten, Günther, sowie seiner sanften Frau Dorothea genoß und das Heranwachsen der prächtigen Kinder mit erlebt hatte.
Nur einmal waren dunkle Wolken über das Haus Bergner gezogen und hätten beinahe die Sonne überschattet. Aber – gottlob hatte im rechten Augenblick eine schöne, verwöhnte Frau den Mut zur Wahrheit gefunden. –
Frau Irene Bergner strich sich mit den feinen Altfrauenhänden über Stirn und Augen. Weg mit den dummen Gedanken – schalt sie sich. Weshalb sie ausgerechnet jetzt daran denken mußte? Wo doch alles so weit zurücklag? –
Geräuschvoll wurde plötzlich ein Fenster geöffnet. Ein liebreizender dunkler Lockenkopf lehnte sich heraus.
»Oma, Oma!«
Lächelnd, froh aus ihren dunklen Erinnerungen gerissen zu sein, beugte sich Frau Irene vor und sah zu dem lebhaft winkenden Mädchen empor.
»Na, ihr Langschläfer? Lockt euch der herrliche Morgen nicht?«
»Guten Morgen, Oma!« kam es als Antwort zurück. »In zehn Minuten bin ich bei dir!«
»Guten Morgen, Bärbel«, erwiderte die alte Dame. »Dann kann ich ja inzwischen den Kaffee bestellen.«
Pünktlich nach zehn Minuten wirbelte Bärbel Bergner auf die Terrasse und in die ausgebreiteten Arme ihrer geliebten Oma.
»Ausgeschlafen, du Wildfang?« Frau Irene blickte zärtlich in das liebliche Mädchengesicht, in die merkwürdig hellen Augen, die so seltsam zu dem dunklen Haar kontrastierten. »Wo bleiben denn die anderen?«
»Günther-Eckhardt murmelte etwas wie ›endlich mal ausschlafen wollen‹, und Anne-Dore kommt gleich. Bei Vati und Mutti habe ich sprechen hören. Sie kleiden sich bestimmt schon an.«
»Und was treibt dich so früh aus dem Bett, Kleines?« wunderte sich Frau Irene. »Hat das einen besonderen Grund?«
»Eigentlich nicht, Oma – oder doch, eigentlich ja!«
»Eigentlich nicht – eigentlich ja?« Lächelnd forschte Frau Irene in den klaren hellen Augen der Enkelin.
Bärbel spielte unschlüssig mit dem Ende ihres Gürtels. Als sie den lachenden Augen der Oma begegnete, seufzte sie tief auf. »Kannst du Vati und Mutti nicht ein wenig beeinflussen?« faßte sie sich endlich ein Herz.
»Beeinflussen?« Frau Irene war ehrlich erstaunt. »In welcher Beziehung denn, Bärbel?«
»Es handelt sich um meinen Eintritt in den Rundfunk-Chor. Meister Donner könnte mich jetzt unterbringen, da eine Choristin ausgefallen ist«, platzte sie endlich heraus und beobachtete mit einigem Herzklopfen die Wirkung ihrer Worte.
Die alte Dame blickte nachdenklich in das rosige Mädchengesicht. Nach einer Weile meinte sie: »Kind, du scheinst vergessen zu haben, welchen Kampf es damals gekostet hat, daß du Gesangsunterricht nehmen durftest. Deine Eltern haben es dir ausdrücklich nur für den Hausgebrauch gestattet. Du bist noch viel zu jung und zart, um die Anstrengungen auf dich nehmen zu können, die Proben und Aufführungen mit sich bringen.«
Bärbel reckte die zierliche Gestalt ordentlich in die Höhe, als wollte sie die Oma vom Gegenteil überzeugen.
»Schau mich doch an, Oma«, sagte sie ungewöhnlich ernst. »Sehe ich etwa anders aus als sonst?«
»Bis auf die Trotzaugen, die du machst, scheinst du dich nicht verändert zu haben«, sagte Frau Irene trocken.
»Und ich habe schon im Chor mitgesungen, Oma, und fleißig geprobt«, stieß Bärbel erregt hervor. Ganz blaß war sie bei diesem Geständnis geworden.
Da es still zwischen ihnen blieb, sprang sie schließlich auf und eilte zu der Oma, schmiegte ihre Wange an die der alten Dame und – schmeichelte: »Bitte, nicht böse sein, Oma. Ich mußte einfach mitsingen. Bedenke, es war eine einmalige Chance. Hätte ich die ungenutzt lassen sollen?«
Die hellen Augen konnten recht unwiderstehlich bitten. Frau Irene empfand wieder einmal den Charme und Liebreiz dieser kleinen Person, die so selbständig gehandelt hatte und nun auch mutig genug schien, die Folgen daraus zu tragen.
»Oma, so sag’ doch ein Wort, ein einziges Wort nur«, fiel Bärbel flehend in ihre Überlegung ein.
»Dieses gewichtige Wort werden wohl deine Eltern sagen müssen«, entschied Frau Irene und schob die Enkelin sanft von sich, da das Mädchen mit der Kaffeekanne erschien.
»Oma«, bohrte Bärbel, der es gar nicht zu schmecken schien, nach kurzer Pause wieder. »Du sollst mir ja nur sagen, ob du mir böse bist.«
»Ein bißchen schon, Kind«, entgegnete sie gemacht streng, und als sie sah, wie Bärbel vor Schreck die Augen aufriß, fügte sie mildernd hinzu: »Aber nur ein bißchen.«
Wieder sprang Bärbel empor, umhalste die geliebte Oma und küßte sie so stürmisch ab, daß diese schließlich erklärte:
»Gut, Bärbel, ich werde mit deinen Eltern sprechen. Mal sehen, was sich tun läßt. Aber die Strafpredigt, die werde ich dir nicht abnehmen können.«
Bärbel preßte beide Hände gegen das Herz. »Ach, Oma, die will ich gern hinnehmen, wenn ich nur singen darf. Du ahnst ja nicht, was es für mich bedeutet. Ich möchte alle Menschen mit meiner Stimme verzaubern und eine große Sängerin werden.«
Gleich nach dem Frühstück nahm Frau Irene Gelegenheit, mit Sohn und Schwiegertochter über Bärbel zu sprechen.
Günther Bergner, ein gutaussehender Fünfziger, schon etwas zur Fülle neigend, bot seiner Mutter den Arm und führte sie in sein im Erdgeschoß gelegenes Arbeitszimmer. Frau Dorothea, schlank, blond, von sanftem, anschmiegsamem Wesen, gewissenhafte Hausfrau und zärtlich liebende Mutter, folgte den Vorangehenden.
Aufmerksam rückte Günther Bergner Mutter und Gattin einen Sessel zurecht und nahm dann hinter seinem Schreibtisch Platz.
»Nun, Mutter, was gibt es denn?« Über die Brille hinweg blickte er gespannt auf Frau Irene.
»Ach ja«, begann Frau Irene und legte die Hände in den Schoß. »Es hat mich einiges aufgeregt.«
»Hat dir etwa jemand etwas zuleide getan, Mutter?« fuhr Frau Dorothea aus ihrer lässigen Haltung auf.
»Aber nein, Dorothea«, winkte die Angeredete beruhigend ab. »Um mich geht es nicht, sondern um Bärbel.«
»Um Bärbel?« kam es wie aus einem Munde. Betroffen sahen sich die Ehegatten an. Und Frau Irene bestätigte. »Ja, um Bärbel und ihren Gesang.«
»Ist sie endlich vernünftig geworden, die Kleine?« rief Günther Bergner erfreut aus. Doch als seine Mutter kummervoll das weiße Haupt schüttelte und bemerkte: »Leider gerade das Gegenteil«, da fuhr er ärgerlich auf.
»Hätte ich damals bloß nicht nachgegeben! Nun wird sie sich noch die unmöglichsten Flausen in den Kopf setzen.«
»Wird? Die hat sie ja schon drin!«
Nun mußte Frau Irene doch über das verblüffte Gesicht ihres Sohnes lachen.
»Mutter, hoffentlich bestärkst du das Mädchen nicht noch in seinen verrückten Ideen.«
»Ganz gewiß nicht, mein Junge. Es liegt absolut nicht in meiner Absicht, mich in eure Erziehungsmaßnahmen zu mischen. Aber ich kann dir nur das eine sagen: so wenig wie Bärbel von ihrer Kunst abzubringen ist, so wenig wirst du der Katze das Mausen abgewöhnen können.«
»Aber, Mutter –!«
»Bitte, mein Junge«, mit einer Handbewegung unterbrach sie ihn. »Das ist Erbgut. Dagegen kommst du nicht an. Außerdem –«, gab sie noch zu bedenken, »wird Bärbel unglücklich werden, erfüllten wir ihr den einzigen sehnlichsten Wunsch nicht. Wollt ihr das etwa?«
Antwortheischend sah sie von einem zum andern. In Dorotheas Züge trat jetzt ein Zug von tiefer Hilflosigkeit. Sie brach auch als erste das Schweigen.
»Nein, Mutter. Unglücklich werden darf das Kind auf keinen Fall. Nicht wahr, Günther«, wandte sie sich an den Gatten, »das willst du doch auch nicht?«
Günther Bergner drehte sich unschlüssig an seinem Schreibtisch um und schaute zum Fenster hinaus. Er sah sich seinem Bruder gegenüber, hörte dessen eindringliches Mahnen: »Ich kann Bärbel, das kleine, hilflose Menschenkind nicht mit nach drüben nehmen und lege sie dir ganz besonders ans Herz. Sie soll zu einem glücklichen Menschenkind heranwachsen und niemals erfahren, wer ihre Eltern waren und wie sie endeten. Ich verlasse mich ganz auf dein Gerechtigkeitsgefühl.«
Er sah im Geiste die Szene ganz deutlich vor sich. Er sah sich selbst, wie er dem Bruder Olaf darauf die Hand gegeben hatte und hörte sich sagen:
»Ich verspreche es dir, Olaf. Bärbel soll glücklicher werden, als ihre Mutter es war. Niemals soll sie erfahren, daß sie nicht mein Kind ist.«
Keinen Blick ließ Frau Dorothea von dem Gesicht des Gatten. Und als wüßte sie um seine Erwägungen, trat sie leise zu ihm und legte sanft die Hand auf seine Schulter.
»Vor allem geht es um Bärbels Glück, Lieber«, sagte sie mit leicht bebender Stimme. »Bitte, bedenke das zu allererst, Günther. Bärbel ist mehr das Kind ihres Vaters mit ihrem reinen, treuen Herzen. Von der Mutter bekam sie wohl nur die kostbare Stimme. Wenn es das Kind mit aller Macht zur Musik zieht, dann wollen wir ihm nicht im Wege stehen, Günther.«
»Du sprichst meine Gedanken aus, Thea«, sagte er mit einem befreienden Atemzug und küßte ihr die Hand. »Ich werde noch einmal mit Bärbel sprechen. Ist es ihr unabänderlicher Wille, dann wollen wir ihrer Zukunft nicht länger im Wege stehen.«
An der Gattin vorbei, blickte er dann zu seiner Mutter hinüber.
»Zufrieden, Mutter? Dein Liebling soll glücklich werden.«