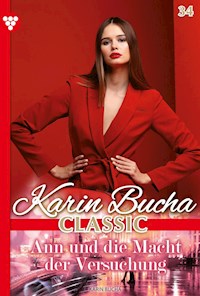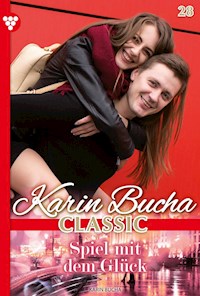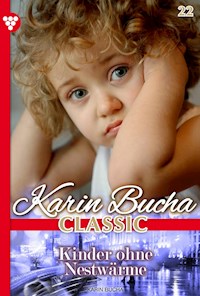Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Karin Bucha Classic
- Sprache: Deutsch
Karin Bucha ist eine der erfolgreichsten Volksschriftstellerinnen und hat sich mit ihren ergreifenden Schicksalsromanen in die Herzen von Millionen LeserInnen geschrieben. Dabei stand für diese großartige Schriftstellerin die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach Fürsorge, Kinderglück und Mutterliebe stets im Mittelpunkt. Karin Bucha Classic ist eine spannende, einfühlsame geschilderte Liebesromanserie, die in dieser Art ihresgleichen sucht. »Frau Bornemann kommt Donnerstag zur Bestrahlung. Notieren Sie bitte, Schwester Ly«, wandte Dr. med. Suchen sich an seine Sprechstundenhilfe Schwester Ly. »Der Nächste, bitte!« Vom Fenster setzte sich eine schlanke Frauengestalt ab und wandte sich in das nunmehr leere, schon dämmrige Zimmer. »Renate – du?!« Suchens abgespannte Züge belebten sich. Schreck und Freude spiegelten sich darin. Er zögerte, schließlich machte er eine einladende Handbewegung. Renate Merkel trat an dem Arzt vorbei in das Ordinationszimmer und blieb unschlüssig stehen, als sie Schwester Ly bemerkte. Die beiden Frauen wechseln einen kühlen Gruß. Sprechenstundenhilfe die Karte ein, knallt den Kasten zu, daß Renate leicht zusammenzuckt, und erleichtert atmet sie auf, als die weiße Gestalt in das kleine Gemach neben dem Ordinationszimmer verschwindet, wo die Apparate stehen. Mit zwei Schritten steht Dr. Suchen neben seiner Besucherin und umfaßt ihre Schultern. »Ich habe dich doch gebeten, mich nicht in meiner Praxis aufzusuchen«, beginnt er, die peinlich gewordene Stille zu unterbrechen. Die dunklen feuchtschimmernden Augen Renates forschen in den seinen. Ihr Herz schlägt schneller.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karin Bucha Classic – 49 –Wenn die Liebe fehlt
Karin Bucha
»Frau Bornemann kommt Donnerstag zur Bestrahlung. Notieren Sie bitte, Schwester Ly«, wandte Dr. med. Suchen sich an seine Sprechstundenhilfe Schwester Ly.
»Der Nächste, bitte!«
Vom Fenster setzte sich eine schlanke Frauengestalt ab und wandte sich in das nunmehr leere, schon dämmrige Zimmer.
»Renate – du?!« Suchens abgespannte Züge belebten sich. Schreck und Freude spiegelten sich darin. Er zögerte, schließlich machte er eine einladende Handbewegung. Renate Merkel trat an dem Arzt vorbei in das Ordinationszimmer und blieb unschlüssig stehen, als sie Schwester Ly bemerkte.
Die beiden Frauen wechseln einen kühlen Gruß. Gelassen reiht die
Sprechenstundenhilfe die Karte ein, knallt den Kasten zu, daß Renate leicht zusammenzuckt, und erleichtert atmet sie auf, als die weiße Gestalt in das kleine Gemach neben dem Ordinationszimmer verschwindet, wo die Apparate stehen. –
Mit zwei Schritten steht Dr. Suchen neben seiner Besucherin und umfaßt ihre Schultern. »Ich habe dich doch gebeten, mich nicht in meiner Praxis aufzusuchen«, beginnt er, die peinlich gewordene Stille zu unterbrechen.
Die dunklen feuchtschimmernden Augen Renates forschen in den seinen. Ihr Herz schlägt schneller. Ihr Atem geht erregt. Wie ich ihn liebe – denkt sie – und sekundenlang schmiegt sie sich fest an ihn. Sie steht schon wieder im Banne seiner unwahrscheinlich blauen Augen, die so klar und gütig blicken können, in denen es aber auch hart wetterleuchten kann.
»Warum hast du nichts von dir hören lassen, Hans?« zittert es von ihren Lippen. »Seit Tagen warte ich auf dich.«
Schnell schließt sie die Augen, da sie spürt, wie sich seine Arme fester um sie legen.
»Die Praxis, Renate«, sagt er leise. »Die Arbeit hat mich einfach nicht losgelassen. Krankenbesuche bis spät in die Nacht.«
Mit Rührung blickt er auf sie hinab, haucht einen Kuß auf die seidigen Wimpern, auf den schöngeschwungenen Mund. »Wie blaß du bist, Renate. Hast du dich gesorgt? Mein Gott, Renate, das darfst du nicht tragisch nehmen. Ein Arzt ist nicht Herr seiner Zeit. Verstehst du das nicht?«
»Doch, doch«, flüstert sie, ohne ihre Haltung zu verändern. »Ich hielt es einfach nicht mehr aus. Sehnsucht – und – und ich muß mit dir sprechen, heute noch!«
Jetzt schlägt sie die Augen zu ihm auf und schaut ihn mit ungewöhnlichem Ernst an. Ein Schreck zuckt ihm zu Herzen. Weiß sie etwas? Noch ehe er gebeichtet hat? Warum hat er es nicht schon längst getan?
Wirklich, er liebt sie – aber er liebt auch die andere, die seinen Namen trägt, die ein armes, geschlagenes Menschenkind ist, und der sein ganzes Mitleid gehört.
Angst fällt ihn an, Angst, mit seiner Beichte zu spät zu kommen, sie verlieren zu müssen. Er zwingt sich zu einem Lächeln, versucht diese Angst hinter seiner Frage zu verstecken. »Ist es wirklich so wichtig, Kind?«
Sie nickt und bestätigt ernsthaft. »Sehr wichtig, Hans.« Dann verziehen sich erstmals ihre Lippen zu einem schattenhaften Lächeln. Es wirkt halb gequält, halb verlegen.
Wieder zieht er sie fest an sich. Sie ist ein äußerst reizvoller Mensch, diese Renate Merkel, feingliedrig, hoch und schlank gewachsen, mit samtdunklen Augen und dunkelglänzenden Haaren, die ein schmales, eigenwilliges Gesicht umschließen.
Was ihm aber zuerst an ihr gefiel, war ihre fröhliche Lebensbejahung, ohne leichtsinnig zu sein. Ihre unproblematische, unbekümmerte Art, an der er sich aufgerichtet hatte zu einer Zeit, da er auf dem besten Weg war, schwermütig zu werden. Ihr Lachen hatte ihn bis in die Schwere seines Alltags hinein begleitet und ihm immer den Lebensmut gestärkt.
Um so mehr beunruhigt ihn jetzt ihr Kommen und ihr beinah verstörtes Wesen.
»Hast du heute wenigstens Zeit für mich, Hans?« fällt ihre Frage in seine kurze Versunkenheit.
Es ist so schön, ihre lebenswarme Nähe zu spüren, die ihn so vieles vergessen läßt, was seine Seele bedrückt.
Er richtet sich etwas empor und löst dabei sanft ihre Arme von seinem Nacken, die sich zärtlich um ihn geschlungen haben.
»Ich mache Schluß hier«, sagt er und ist fest entschlossen, ihr heute die Warheit zu sagen. »Nimm indessen Platz.« Er drückt sie auf den nächsten Stuhl.
Ist es ihm so unangenehm, daß sie ihn trotz seines Verbotes in der Praxis aufgesucht hat?
Unerklärliche Angst greift nach ihr.
»Können wir jetzt gehen?« hört sie sich fragen. Die Stimme klingt gepreßt und kommt ihr selbst fremd vor.
Dr. Suchen schreckt empor, als habe er Renates Anwesenheit völlig vergessen. »Natürlich, Renate! Sofort«, versichert er eifrig, zu eifrig, und wendet sich sogleich unwillig der Tür zu, in der nach kurzem Anklopfen die Sprechstundenhilfe erscheint.
»Verzeihung, Herr Doktor«, sagt sie, ein kleines Lächeln in den Mundwinkeln. »Sie haben mein Klopfen überhört. Das Telefon. Ihre Gattin ist am Apparat. Es sei dringend.«
Ein Klirren! Eines der Instrumente schlägt auf den Boden. Es ist Suchens kraftlos gewordenen Händen entglitten. Schwester Ly, die sich diensteifrig danach bücken will, wird mit einer heftigen Handbewegung aus dem Zimmer gescheucht.
*
Totenstille!
Renates weit aufgerissene Augen hängen an Dr. Suchens kalkig weißem Gesicht. Sie will sich erheben. Die Glieder versagen ihr den Dienst. Sie bemüht sich um einen Laut, einen einzigen armseligen Laut. Die Zunge ist wie gelähmt.
Eine Lawine scheint sich auf Renate zuzuwälzen, um sie zu vernichten.
Gattin! – Gattin!
Das ist ja Wahnsinn! Ich träume! Gleich werde ich erwachen, und alles ist wie früher. Aber diese furchtbare, vernichtende Stille! Warum spricht Hans nicht? Warum kommt er nicht zu mir und erklärt mir, daß das nicht wahr ist?
»Hans!«
Hat sie geflüstert? Hat sie es ge-schrien? Sie weiß es nicht. Sie weiß nur, daß etwas geschehen muß, was die ungeheure Spannung in ihr zum Zerreißen bringt.
Da fühlt sie sich umschlungen. Ganz nahe ist ihr das geliebte Gesicht. Sie hört seine dunkle erregte Stimme.
»Hör mich an, Renate, bitte hör mich an, und sei nicht so verzweifelt.«
Sie hat das Gefühl, als wäre dieses Gesicht ihr ganz fremd, als hätte sie es nie gekannt, und Zorn und Erbitterung steigen so gewaltig in ihr empor, daß sie am liebsten in dieses Gesicht hineingeschlagen hätte, wenn… wenn sie es nicht so sehr lieben würde.
In einem Anfall von Schwäche lehnt sie sekundenlang den Kopf an seine Brust und stammelt hilflos:
»Oh, Hans – wie furchtbar. Du hast mich die ganze Zeit belogen. Deshalb also durfte ich nie zu dir kommen –?«
Ein Geräusch an der Tür läßt ihn herumfahren. Schwester Ly macht ihm ein Zeichen. Er winkt ab und nimmt Renates Gesicht zwischen seine Hände. Seine Stimme hat einen beschwörenden Klang.
»Ich werde dir alles erklären, Renate. Ich liebe dich ehrlich und wahrhaftig. Bitte, warte hier. Ich bin sofort zurück.«
Suchen löst sich von ihr und eilt hinaus. Sein weißer Mantel ist wie ein heller, schmerzhafter Fleck. Renate schließt die Augen und sinkt stöhnend in sich zusammen.
Oh, mein Gott – denkt sie nur – oh, mein Gott! –
Dr. Suchen schließt geräuschlos die Tür hinter sich. Seine Hände zittern. In den Knien spürt er ein weiches Gefühl. Ihm ist zumute, als müßte er Schwester Ly das Genick umdrehen. Und doch spürt er trotz aller Erregung etwas wie Erleichterung, daß das ängstlich vor ihr gehütete Geheimnis nun gelüftet ist.
Zaghaft greift er nach dem Telefon. Er benetzt die trockenen Lippen mit der Zunge und atmet ein paarmal tief. Der Apparat brennt wie glühendes Eisen in seiner Hand. Endlich hat er die Schwäche überwunden.
»Ja, Eva«, meldet er sich mit rauher Stimme. Dabei lauscht er angestrengt auf jeden Laut in der Wohnung. Renate wird doch nicht weglaufen – denkt er verzweifelt. Dann reißt er sich zusammen. »Bist du noch da, Eva?«
»Kommst du bald nach Hause, Hans?« hört er die ängstliche Frage. Die Stimme ist kindlich und weich und erweckt sofort alles Mitleid in ihm.
»Aber Eva«, erwidert er mit leichtem Vorwurf. »Deshalb brauchst du doch nicht anzurufen. Das hätte doch Helga für dich tun können. Bist du etwa aufgestanden?«
»Ja, Hans, bitte nicht böse sein. Ich hatte solche Angst, ganz allein im Haus. Mir war plötzlich unheimlich zumute und… und ich wollte wenigstens deine Stimme hören – Hans…«
»Aber, Kind, wie konntest du! Wo sind denn deine beiden Betreuerinnen, die Helga und die Barthels?« forscht er besorgt.
»Sie wollten Besorgungen machen und schnell wieder zurückkehren«, kommt es weinerlich zurück. »Nun bin ich schon solange allein. Kommst du bald?«
»Natürlich komme ich bald –« Er zögert, wischt sich mit der Linken über die Stirn, auf der Schweiß steht. »Nur noch ein paar dringende Besuche, Eva.«
Wieder zögert er, preßt die Zähne in die Unterlippe. Wie schrecklich. Wieder muß er einen gläubigen Menschen be-lügen.
»Hans!« reißt ihn die kindlich bittende Stimme in die Gegenwart zu-rück. »Komme bald, hörst du – ich –
ich –«
»Ja, sobald ich kann, komme ich, Eva«, sagt er entschlossen. »Leg dich wieder hin. Kannst du bis zum Bett gehen? Gut, Eva, versuche es. Ich schicke dir indessen Schwester Ly. Bis nachher.«
Er beendet rasch das Gespräch. Sekundenlang steht er bewegungslos, die Hände gegen die Schläfen gepreßt. Mein Gott, was für ein Tag! Dort die kranke Eva. Hier Renate, das getäuschte, verzweifelte Mädchen. Alles habe ich falsch gemacht – denkt er.
Im Röntgenzimmer findet er Schwester Ly. Mit einem kleinen Schrei fährt sie herum, erkennt den Chef und fragt entsetzt:
»Ist was passiert? Mit Ihrer Frau? Oder – sind Sie krank?«
Er winkt ab, mühsam formt er die Worte.
»Wollen Sie mir einen Gefallen tun, Schwester Ly?« Er muß sich zu einem sachlichen Ton zwingen. Und als sie eifrig nickt, fährt er fort: »Meine Frau befindet sich ohne Hilfe im Haus. Wollen Sie einstweilen zu ihr gehen? Sie ängstigt sich. Eine der beiden Dienstboten wird wohl bald heimkehren. Dann sind Sie endlich frei.«
»Selbstverständlich, Herr Doktor, ich gehe sofort«, verspricht sie schnell, wirft noch einen Blick in das verstörte Gesicht des Chefs und huscht davon.
Eiligst kehrt er in sein Ordinationszimmer zurück, wo Renate immer noch in zusammengesunkener Haltung im Sessel hockt. Ihr Kopf ruht in der Beuge ihres Armes. Ungehemmt fließt das dunkle seidigglänzende Haar darüber. Das süße kleine Hütchen liegt irgendwo achtlos auf dem Boden. Behutsam hebt Suchen es auf und legt es auf die Schreibtischplatte.
Zaghaft nähert er sich Renate. An den Schultern dreht er sie zu sich herum. Ein paar samtdunkle, wie erloschen wirkenden Augen sehen ihn an.
»Renate, bitte, hör mir gut zu«, fleht er förmlich, weil ihr starres Wesen ihn maßlos ängstigt. Unverwandt schaut sie ihn an, als wolle sie sich seine Züge für ewig einprägen. Als suche sie in diesem edlen, stolzen Männergesicht nach einem Zug von Gemeinheit oder Niedertracht. Aber sie kann nichts finden. Es ist dasselbe reine Bild, wie es immer vor ihrer Seele schwebt.
Ernst, traurig sind seine Augen. Merkwürdig helle Augen. Augen, die den Menschen bis auf den Grund der Seele zu blicken scheinen.
Und plötzlich löst sich die ungeheure Spannung in ihr. Ein Laut, tief aus dem Herzen kommend, ringt sich empor. Ein Schluchzen, heiß und bitterlich.
»Ach, Hans, was hast du aus mir gemacht!«
Er hört nur das wehe Weinen, das ihm tief ins Herz schneidet. Aber er weiß, daß er jetzt nicht in sie hineinreden darf, daß der Tränenstrom ungehindert fließen muß.
So wartet er geduldig, bis das Weinen leiser und leiser wird und endlich verstummt ist. Dann geht er zu ihr, hebt ihr Kinn empor und sieht ihr in die weit aufgerissenen Augen. Die letzten Tränen hängen noch an den dichten, leichtgebogenen Wimpern, die diese samtenen Augen wie ein Kranz umgeben. Liebe und Erbarmen machen ihn seltsam weich.
»Renate, Liebes, laß dir alles erklären –«
Mit einer Bewegung unterbricht sie ihn leidenschaftlich.
»Was gibt es noch zu erklären? Ich weiß ja alles, und das ist so entsetzlich – so gemein. Ich weiß nicht mehr aus noch ein.« Sie schlägt die Hände vor das Gesicht und murmelt zwischen den Fingern. »Und ich schäme mich… Ich schäme mich so sehr –«
»Du schämst dich deiner Liebe zu mir?« fragt er betroffen.
Mit einem Ruck steht sie auf den Beinen. Ihre Augen funkeln ihn feindselig an.
»Ja, und nochmals ja. Ich schäme mich«, stößt sie fassungslos und erbittert hervor. »Ich schäme mich, daß mein Kind geboren wird, und sein Vater einer anderen gehört –«
»Renate!«
Sie preßt die Hand gegen den Mund. Sie bereut, daß die Erregung ihr das Geheimnis entrissen hat.
Atemlos starren sie sich an.
Schwester Ly kennt sich in dem Einfamilienhaus Dr. Suchens, das in einem gepflegten Garten gelegen ist, gut aus. Schon mehrmals hat sie die Wache bei der kranken Eva Suchen übernommen.
Ihr Chef, Dr. Suchen, ist ein vielbeschäftigter und äußerst beliebter Arzt. Seine Patienten verehren ihn, und die Kinder hängen an ihm. Keiner versteht so gut zu trösten und sich so schnell das Vertrauen der Kleinsten zu erringen wie er. Seine Praxis wird überlaufen, und Dr. Suchen ist unermüdlich tätig.
Schwester Ly hat oft den Eindruck, daß er sich förmlich in die Arbeit vergräbt, um das tragische Schicksal seiner Ehe zu vergessen.
Sie findet Eva Suchen ohnmächtig am Boden neben dem Telefon.
Das zarte, vom Leid gezeichnete Antlitz der Kranken ist wie Wachs so bleich. Als Schwester Ly sich zu ihr neigt, schlägt sie die Augen auf, benommen sieht sie sich um, bis sie die Schwester erkennt.
Ein gequältes Lächeln umspielt die farblosen Lippen.
»Wie gut, daß Sie da sind, Schwester Ly«, flüstert sie und streckt ihr die Hände entgegen. »Helfen Sie mir, bitte! Mir ist so kalt. Auf einmal hatte mich alle Kraft verlassen, und dann die Angst.«
Voll Erbarmen nimmt Schwester Ly die eiskalten Hände der Kranken. Man glaubt nicht, wie weich und mitfühlend die Stimme der Frau sein kann.
»Schlingen Sie Ihre Arme um meinen Hals, gnädige Frau. Ich bringe Sie ins Bett. Sie sind ja halb erfroren. Geht es so? Ja, fein! Nun noch ein paar Schritte. Sehen Sie, da sind wir schon.«
Kraftlos sinkt Eva Suchen auf ihr Lager, legt den Kopf zurück und schließt die Augen. Schwester Ly deckt die Kranke sorgfältig zu, dann läuft sie in die Küche, um Wärmflaschen zu machen. Nach kurzer Zeit kehrt sie zurück und bemüht sich um Eva Suchen, bis diese die Augen aufschlägt und die Frau im weißen Kleid dankbar anlächelt.
»Jetzt ist mir wieder wohler, Schwester Ly. Vielen Dank.«
»Ist Ihnen etwas warm geworden?«
Eva Suchen nickt und deutet mit matter Handbewegung auf den Stuhl neben sich. »Bleiben Sie bei mir«, haucht sie.
Wie oft hat Schwester Ly die Schluchzende schon im Arm gehalten, liebevoll getröstet und mitleidig belogen: Alles wird wieder gut. Ins Herz haben ihr die flehenden Blicke gestochen, mit denen sie voll ungläubiger Verzweiflung gefragt hat:
»Glauben Sie daran, Schwester? Glauben Sie, daß ich eines Tages wieder gesund sein werde?«
Und sie hat sich beherrscht, genickt und tapfer geantwortet:
»Ganz sicher.«
Und an dieser Zusicherung hat sich der Wille zum Leben in der Kranken emporgerankt.
Aber jetzt liegt sie in kraftloser Hinfälligkeit vor ihr, kraftloser denn je. Aus den Augenwinkeln betrachtet Schwester Ly die junge Frau, während sie auf dem niedrigen Tisch, der neben dem Lager steht, die Sachen ordnet. Nichts als das leise Klirren der Medizinflasche ist zu hören.
Gottlob – sie schläft – denkt Schwester Ly und zuckt leicht zusammen, als die Stimme der Kranken in die Stille fällt:
»Haben Sie meinen Mann gesprochen? Oder war er schon auf Krankenbesuch?«
»Er war noch in der Praxis«, erwidert sie mit abgewandtem Gesicht.
»Mein Mann arbeitet zu viel«, bemerkt die junge Frau. Ihre Hände liegen matt, weiß und durchsichtig auf der seidenen Decke. Nachdenklich schaut sie sie an. »Nichts haben diese Hände verstanden zu halten. Alles ist ihnen entglitten –«
»Aber doch nicht durch Ihre Schuld!« fährt Schwester Ly tröstend dazwischen.
Ein langer Blick trifft die Schwester. Dann schüttelt sie langsam das blonde Haar.
»Nein, nicht durch meine Schuld, und doch bin ich es, die meinen Mann unglücklich macht. Was hat er von mir? Was kann ich ihm noch sein? Doch nur eine Last! Wenn ich nicht mehr wäre, könnte er eine gesunde Frau an meine Stelle setzen –«
»Aber gnädige Frau«, sagt Schwester Ly entsetzt. »Mit welchen Gedanken quälen Sie sich herum!«
Eva Suchen macht eine kleine Handbewegung. Ganz ruhig, ohne Bitterkeit spricht sie weiter:
»Sie sind die einzige, Schwester Ly, mit der ich darüber sprechen kann. Sie glauben nicht, was mir alles durch den Kopf geht, wenn ich nicht schlafen kann. Immer ist mein Mann in diese Gedanken eingeschlossen. Für mich wünsche ich mir nichts, gar nichts – höchstens ein baldiges Ende. Das ist ja alles Quälerei, und ich hänge nicht mehr am Leben. Aber das Glück meines Mannes geht mir über alles. Er verdient alles Glück der Welt.«
Sie läßt eine Pause eintreten, in der sie heftig atmend nach Luft ringt. Voll Barmherzigkeit nimmt die Schwester die Kranke in die Arme, die sich willig wie ein müdes Kind an ihre Brust schmiegt. Und da läßt Schwester Ly sich etwas entreißen, was keiner Eifersucht oder einem unseligen Gefühl entspringt. Einzig und allein möchte sie diesem armen, leidenden Geschöpf Ruhe ins Herz senken.
»Vielleicht quälen Sie sich ganz ohne Grund mit diesen düsteren Erwägungen, gnädige Frau. Vielleicht hat der Doktor schon ein Glück gefunden?«
Ein Ruck geht durch den Körper der Kranken. Die blauen Augen Eva Suchens hängen mit seltsamem Ausdruck an den Lippen der Schwester. Sie bemerkt deren Schrecken und lächelt nachsichtig.
»Sagen Sie mir die Wahrheit, Schwester Ly, ich kann sie vertragen.«
In heller Bestürzung sinkt Schwester Ly vor dem Lager der Kranken in die Knie. »Verzeihen Sie mir, bitte, verzeihen Sie mir«, stammelt sie.
»Was soll ich Ihnen verzeihen, Schwester Ly? Das Antlitz der Kranken leuchtet vor Blässe. Auch das Lächeln ist aus ihren Zügen verschwunden. »Ist sie hübsch?«
»Sehr hübsch«, flüstert Schwester Ly.
»Ist sie auch – gut?«
Schwester Ly weiß nicht mehr aus noch ein. »Oh, ich weiß gar nichts. Es ist nur eine Vermutung von mir. Vielleicht füge ich Herrn Doktor Unrecht zu. Aber – aber er war in letzter Zeit ganz anders, wie verwandelt, und deshalb habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Und heute –« Sie verstummt jäh, weil sie merkt, daß sie immer mehr preisgibt, was lieber ungesprochen bleiben sollte.
»Und heute –?« forscht Frau Eva unerbittlich mit der Hartnäckigkeit, die alle kranken Menschen an sich haben.
»Und heute kam eine junge bildschöne Dame in die Sprechstunde. Herr Doktor geriet darüber in eine Aufregung, wie ich ihn noch nie gesehen habe.«
Langsam heben sich die schweren Lider der jungen Frau. Die Augen wandern abseits zu dem Bild des Gatten. Sie umschließt die geliebten Züge mit liebevollen Blicken. Wenn du doch noch einmal glücklich werden könntest – denkt sie – so glücklich, wie wir es früher waren. Während sie das denkt, stellt sie überrascht fest, daß sie dabei gar keinen Schmerz mehr empfindet.
Wohl löst der Gedanke, ihn an eine andere Frau verloren zu haben, Wehmut in ihr aus. Aber etwas ist doch stärker in ihr. Nämlich die Liebe zu dem Gatten, die nur noch Selbstlosigkeit kennt.
Ihre Augen gleiten von dem Bild hinweg. Leuchtender Glanz liegt darin, und sie lächelt, daß Schwester Ly erschauert.
»Warum weinen Sie, Schwester Ly?« Jetzt ist die Kranke die Stärkere. »Sehen Sie, ich weine doch auch nicht. Das habe ich selbst gewollt. Nur gewußt habe ich es noch nicht. Und – und ich möchte sie gern kennenlernen, die Frau, die meine Stelle einnehmen soll. Dann kann ich ruhig sterben.«
Schwester Ly ist überwältigt von so viel selbstloser Größe. Still weint sie vor sich hin. Sie möchte weglaufen, weit weg, und ich doch durch den Auftrag des Doktors an das Krankenlager gefesselt. Als könne Frau Eva Gedanken erraten, sagt sie leise:
»Sie können gern heimgehen, Schwester Ly. Ich warte auf meinen Mann – und habe so viel zu denken.«
Schwester Ly richtet sich steif empor.
»Ich bleibe bei Ihnen – bis Herr Doktor kommt!«
*
»Renate, Liebes. Das habe ich nicht gewußt«, sagt Dr. Suchen erschüttert und macht ein paar Schritte auf sie zu.
»Rühr mich nicht an«, stößt sie erregt hervor und streckt ihm abwehrend die Hände entgegen. »Du hast mich belogen und betrogen.« Ihre Stimme bebt, und sie schöpft tief Atem. »Du hast mir von Liebe gesprochen und nur Liebelei gemeint. Du hast meine Jugend und Unerfahrenheit ausgenutzt. Ach, jetzt wird mir alles erschreckend klar. Immer warst du von einem Geheimnis umwittert. Ich habe nur nicht geahnt, was es war. Jetzt weiß ich es. Mich hast du in dem Glauben gelassen, daß ich einmal deine Frau würde – und dabei bist du längst gebunden. Oh, ich schäme mich, ich schäme mich furchtbar, deine Geliebte gewesen zu sein.«
»Renate –«, vergebens versucht Suchen die an allen Gliedern zitternde Frau zu unterbrechen.
»Ich hasse dich«, schleudert sie ihm entgegen. »Und ich hasse auch das Kind, das ich unter dem Herzen trage. Niemals werde ich das Kind zur Welt bringen, niemals –«
»Renate!« Suchen fängt die schwankende Frau in seinen Armen auf. Es ist, als habe plötzlich alle Kraft sie verlassen. Willig läßt sie sich zu einem Sessel führen und sinkt kraftlos hinein.
»Renate, bitte höre mich an, ich bitte dich um nichts weiter«, beginnt er beschwörend, dann tritt er von ihr hinweg. Erbärmlich ist ihm zumute. Sie hat ja recht – denkt er. Ich habe sie über meine Verhältnisse im unklaren gelassen. Aber ich liebe sie, wirklich!
Als das Schweigen bedrückend zu wirken beginnt, und auf leisen Sohlen die Dämmerung ins Zimmer schleicht, rafft er sich auf. Seine Stimme klingt heiser vor Erregung.
»Du hast mir sehr viel unedle Motive vorgeworfen, Renate. Jeder Angeklagte hat das Recht zur Verteidigung. Ich habe dich weder belogen noch betrogen. Lediglich aus Angst, dich zu verlieren, habe ich dir verschwiegen, daß ich an eine kranke Frau gebunden bin –«
»Hahaha!« Ihr grelles, unnatürliches Lachen läßt ihn verstummen. »Nun sage bloß noch, daß du auf den Tod deiner Frau gewartet hast.«
»Nein, Renate! Bei Gott, das habe ich nicht, denn sie ist die beste, edelste Frau –«
»Die du hinter ihrem Rücken mit mir betrogen hast«, wirft sie wiederum dazwischen. Es klingt ironisch und bitter zugleich. »Nennst du das auch edel?«
»Hör mich einmal an, ohne mich zu unterbrechen«, bittet er voll Wärme. Sie lehnt sich zurück und schließt die Augen. Innerlich fiebert sie nach seinen Erklärungen. Schon seine Stimme zu hören ist Glück für sie. Nein! Ich liebe ihn nicht mehr. Ich hasse ihn – hämmert sie sich ein.
»Es soll keine Rechtfertigung sein«, fährt er, etwas ruhiger, fort. »Jetzt sehe ich ein, daß ich gemein an dir gehandelt habe. Als ich dich seinerzeit auf der Gesellschaft bei Werner Eibner kennenlernte, ahnte ich nicht, daß du einmal mein Schicksal werden würdest. Frauen waren mir sehr gleichgültig geworden. Damals kannte ich nur meine Arbeit und die Sorge um meine Frau. Nur sehr widerstrebend hatte ich Eibners Einladung angenommen. Ich konnte mich nicht länger mit Arbeit entschuldigen. Die Familie Eibner gehört zu meinen jahrelangen Patienten. Früher war ich mit meiner Frau häufig zu Gast bei ihnen.
Nun also, ich erschien auf dieser Party, und du wurdest mir vorgestellt. Zunächst hatte ich nicht mehr Interesse an dir als an jeder schönen Frau. Höchstens, daß ich Wohlgefallen an deiner auffallend aparten Erscheinung hatte.
Seit jenem Abend wurde es anders bei mir. Ich begann mich aus meiner Gleichgültigkeit, ja, Schwermut herauszureißen und begann das Leben, das außerhalb meiner Praxis und meinem so still gewordenen Haus lag, wieder lebenswert zu finden.«
Er laßt eine Pause eintreten und lächelte sie schmerzlich und wie um Entschuldigung bittend an. Groß ruhen ihre Augen auf seinem erregten Gesicht. »Den Rest kennst du, Renate. In stiller Übereinkunft gingen wir beide eigene Wege, zogen uns gemeinsam von den anderen zurück. Aus unserer Bekanntschaft wurde eine gute Freundschaft und aus dieser Freundschaft Liebe.
Wenn ich ehrlich sein soll, dann hat mich dieser Zustand nie restlos glücklich gemacht, weil alles in aller Heimlichkeit geschehen mußte und du ahnungslos bleiben solltest.
Ich liebe dich, Renate – und wollte dich nicht verlieren.«
»Und – deine Frau?« wirft sie kalt ein.
»Meine Frau hat damit gar nichts zu tun. Sie ist seit Jahren unheilbar krank. Sie führt ein Schattendasein. Ihr gehört mein ganzes Mitleid und meine Fürsorge. Ich fühle mich ihr gegenüber nicht schuldig«, sagt er ernst und geht langsam auf sie zu. Er forscht in ihren Augen vergeblich nach dem gewohnten Funken. Sie sind wie erloschen, aber Haß liegt darin, abgrundtiefer Haß, der ihn zutiefst erschreckt. Noch einmal legt er alle Wärme in seine Stimme. »Ist es denn so verabscheuungswürdig, daß ich noch einmal an ein Glück geglaubt habe? Ich sehe ein, daß es schwer ist, mir zu verzeihen. Aber deshalb brauchst du mich doch nicht zu hassen!«
Renate fühlt sich an Leib und Seele wie zerschlagen »Du bist nicht allein schuldig«, sagt sie, den Blick starr zu Boden geheftet.