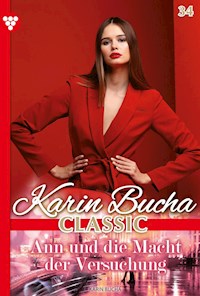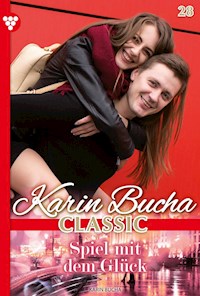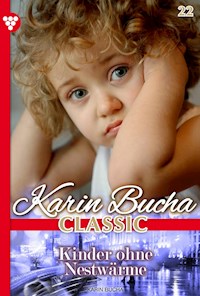Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Karin Bucha Classic
- Sprache: Deutsch
Karin Bucha ist eine der erfolgreichsten Volksschriftstellerinnen und hat sich mit ihren ergreifenden Schicksalsromanen in die Herzen von Millionen LeserInnen geschrieben. Dabei stand für diese großartige Schriftstellerin die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach Fürsorge, Kinderglück und Mutterliebe stets im Mittelpunkt. Karin Bucha Classic ist eine spannende, einfühlsame geschilderte Liebesromanserie, die in dieser Art ihresgleichen sucht. »Salina-Schokolade«. In den Werksgaragen stehen die bunten Lieferwagen mit der Aufschrift »Salina-Schokolade«. Ein Heer von Arbeitern und Angestellten findet in der »Salina-Schokoladenfabrik« Arbeit und Lohn. Sie arbeiten alle gern in dieser Fabrik, manche schon ein Menschenalter, unter der Leitung von Albrecht Salin. Nirgendwo finden sie einen besseren, gerechteren Chef als ihn. Ein Mensch, der, selbst rastlos tätig, auch die Arbeit der anderen anerkennt und entsprechend belohnt. Alle scheinen sie glücklich und zufrieden. Nur ein Mensch ist es nicht. Ein kleines, fünfjähriges Menschenkind: Claudia, die einzige Tochter des Fabrikherrn. Bitterlich weint sie in die spitzenbesetzten Kissen, in die Dunkelheit des prachtvoll ausgestatteten Zimmers, das allen Ansprüchen gerecht wird, die einem Kind zur Freude und Anregung dienen. Albrecht Salin, müde, abgehetzt von Kopenhagen mit dem Flugzeug und vom Flugplatz mit dem Wagen kommend, betritt sein Haus und hat nur den einen Wunsch, noch etwas Schlaf zu bekommen, denn frühzeitig wartet schon wieder Auslandsbesuch auf ihn, dem er sich besonders widmen muß. In der weiten und hohen Halle knipst er sämtliche Lampen an und sieht sich lächelnd um. Immer wieder freut er sich über die Schönheit und geschmackvolle Ausstattung seines Hauses. Sekundenlang bleibt er nachdenklich stehen und lauscht in die Stille des Hauses. Noch nie hat er sie so stark empfunden wie eben jetzt. Und doch! Wie schön war es doch vor fünf Jahren, als Nina ihm strahlend vor Wiedersehensfreude in die Arme gesprungen kam. Das war wirklich Heimkehr, von einem liebenden Menschen erwartet. Heute?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karin Bucha Classic – 50 –Der Sonne entgegen
Karin Bucha
Weithin sichtbar leuchten die signalroten riesigen Buchstaben über dem langgestreckten Fabrikgebäude:
»Salina-Schokolade«.
In den Werksgaragen stehen die bunten Lieferwagen mit der Aufschrift »Salina-Schokolade«. Ein Heer von Arbeitern und Angestellten findet in der »Salina-Schokoladenfabrik« Arbeit und Lohn. Sie arbeiten alle gern in dieser Fabrik, manche schon ein Menschenalter, unter der Leitung von Albrecht Salin. Nirgendwo finden sie einen besseren, gerechteren Chef als ihn. Ein Mensch, der, selbst rastlos tätig, auch die Arbeit der anderen anerkennt und entsprechend belohnt.
Alle scheinen sie glücklich und zufrieden.
Nur ein Mensch ist es nicht. Ein kleines, fünfjähriges Menschenkind: Claudia, die einzige Tochter des Fabrikherrn. Bitterlich weint sie in die spitzenbesetzten Kissen, in die Dunkelheit des prachtvoll ausgestatteten Zimmers, das allen Ansprüchen gerecht wird, die einem Kind zur Freude und Anregung dienen.
Albrecht Salin, müde, abgehetzt von Kopenhagen mit dem Flugzeug und vom Flugplatz mit dem Wagen kommend, betritt sein Haus und hat nur den einen Wunsch, noch etwas Schlaf zu bekommen, denn frühzeitig wartet schon wieder Auslandsbesuch auf ihn, dem er sich besonders widmen muß.
In der weiten und hohen Halle knipst er sämtliche Lampen an und sieht sich lächelnd um. Immer wieder freut er sich über die Schönheit und geschmackvolle Ausstattung seines Hauses.
Sekundenlang bleibt er nachdenklich stehen und lauscht in die Stille des Hauses. Noch nie hat er sie so stark empfunden wie eben jetzt.
Und doch! Wie schön war es doch vor fünf Jahren, als Nina ihm strahlend vor Wiedersehensfreude in die Arme gesprungen kam. Das war wirklich Heimkehr, von einem liebenden Menschen erwartet.
Heute? Er seufzt leise auf, schaltet die Lampen wieder aus, packt seine Aktentasche und begibt sich in das erste Stockwerk, wo die Schlaf- und
Gasträume liegen.
Plötzlich stockt sein Fuß. Ein Ton dringt durch die Stille zu ihm, der ihn aufhorchen läßt. Wer weint da? Er geht langsam weiter und bleibt vor der Tür stehen, die zum Zimmer seiner Tochter führt.
Behutsam öffnet er, tastet nach dem Lichtschalter – es bleibt dunkel.
»Claudia«, ruft er leise.
»Papi, lieber Papi!« kommt es kläglich aus dem Dunkel. Im Nu sitzt er auf dem Hocker neben dem Kinderbett, aus dem sich zwei Arme sehnsüchtig ihm entgegenstrecken.
»Warum weinst du denn, mein Kind?« Er hebt die zierliche Gestalt im langfließenden rosaseidenen Nachthemd zu sich empor und bettet sie auf seinen Schoß und in die Arme. Er spürt, wie sich das Kind an ihn preßt, wie sich seine Ärmchen fest um seinen Hals schlingen. Der ganze zarte Körper wird von Schluchzen geschüttelt.
»Papi! Papi!« Nichts anderes stammelt das Kind. Mit der Rechten hält er seine Tochter umschlungen, die Linke sucht den Knipser der Nachtlampe. Kein Licht!
»Was ist denn hier los, Liebling? Warum brennen die Lampen nicht?«
»Mademoiselle«, flüstert das Kind.
Kurz entschlossen nimmt er Claudia mit in sein Zimmer. Dort läßt er sie auf die breite Couch gleiten, hüllt das zitternde kleine Menschenbündel in Decken und schiebt noch ein weiches Kissen in den Rücken. Dann setzt er sich zu ihr.
»Nun erzähle, mein Liebling«, fordert er seine Tochter auf. Etwas preßt ihm das Herz zusammen, als er in das verquollene Gesichtchen sieht. »Wie lange weinst du eigentlich schon, mein Herz? Du kannst ja kaum aus den Augen gucken.«
Liebevoll trocknet er ihre Tränen, drückt ihr einen Kuß auf den kleinen Mund und ermuntert noch einmal. »Nun erzähle, Claudi, Papi will alles wissen.«
»Mademoiselle hat gesagt – ich – ich sei so ungezogen und müßte Strafe haben. Sie – sie hat alle Birnen mitgenommen – und – und da habe ich Angst bekommen. Ich will auch ganz lieb sein, Papi. Machst du mir wieder Licht? Oder darf ich – bei dir bleiben, Pa-
pi?«
Salins Mund preßt sich zusammen. Zart streicht er das wirre feuchte Haar aus der Stirn des Kindes.
»Darf ich – darf ich denn bei dir bleiben?« Claudia ist aus den schützenden Hüllen auf seinen Schoß gekrabbelt. Zärtlich schmiegt sie sich an den erschütterten Mann.
Er preßt sie ganz fest an sich. »Du bleibst bei mir, mein Herz. Du darfst sogar in meinem Bett schlafen.«
»Und du, Papi?«
»Papi schläft hier auf der Couch, Claudi.«
Sie kuschelt sich inniger an ihn. »Kannst du – kannst du nicht auch im Bett schlafen? Sooo klein mach ich mich, Papi.«
»Kleine süße Schmeichelkatze«, sagt er bezwungen und nickt überrumpelt. »Du darfst, mein Kind.«
Er nimmt sie abermals auf den Arm, trägt sie hinüber zu dem breiten Bett und packt sie sorgfältig ein. Lange hält Claudia es nicht in der warmen Umhüllung aus. Schon sitzt sie wieder aufrecht, die Händchen auf der Decke zusammengelegt und läßt keinen Blick von dem Vater.
»Papi!«
»Ja, Liebes!«
»Ich habe Durst«, sagt sie kläglich. »Ich habe schon seit vielen Stunden Durst. Kannst du – kannst du mir nicht etwas zu trinken geben?«
»Das kann ich, Kind«, erwidert er und reißt sich aus seiner Nachdenklichkeit. Zweifelnd setzt er hinzu: »Seit Stunden schon? Du übertreibst aber, Claudi.«
»Bestimmt nicht, Papi!« spricht sie voll Eifer. »Mademoiselle hat mich ins Bett gesteckt, da war es noch ganz hell. Da hatte ich schon Durst.«
»Soso!« bemerkt er und sieht ganz grimmig dabei aus. Schöne Zustände, die während seiner Abwesenheit herrschen. Er ist fest entschlossen, ordentlich aufzuräumen. Zu seiner Tochter sagt er: »Warte, Claudi. Ich hole dir etwas. Schön artig im Bett bleiben, keine Dummheiten machen.«
Er geht über den breiten teppichbelegten Flur, sieht unter einer Tür einen Lichtschimmer, erkennt das Zimmer von Mademoiselle und klopft entschlossen an.
Im nächsten Augenblick steht er in der Tür.
Beim unverhofften Anblick des Hausherrn – der übrigens noch nie ihr Zimmer betreten hat, am allerwenigsten würde sie ihn in der Nacht erwarten – fährt sie mit einem kleinen spitzen Schrei empor, so daß das Buch polternd zu Boden fällt.
»Herr Salin – Sie?« Den Mann vor sich zu sehen, den zu erringen sie alle Mittel bisher vergeblich angewandt hat, verwirrt sie über alle Maßen. Sie sieht schön aus, mit etwas zerzaustem dunk-lem Haar und den Augen, die groß und sprühend wie Feuerräder sind. Aber Salin sieht das nicht.
»Verzeihen Sie den nächtlichen Überfall«, beginnt er, sich zur Ruhe zwingend. »Ich sah noch Licht bei Ihnen –«
»Aber, bitte – ich freue mich. Wollen Sie nicht Platz nehmen?« Sie spricht ein einwandfreies Deutsch, fast akzentfrei. »Ich wußte nicht, daß Sie heute zurückkehren.«
»Sonst hätten Sie sicher nicht meine Tochter in ein dunkles Zimmer gesperrt«, fällt er ihr eiskalt in die Re-
de.
»Ich – Claudia?« Ihr wird unbehaglich unter dem Blick der hellen Augen zumute. Ihre Hände streichen erregt über das duftige Morgenkleid. »Sie war sehr ungezogen – es sollte –«
»– eine Strafe sein«, vollendet er abermals, und sie spürt die Kälte förmlich, die von dem Mann ausgeht, um den sie sich viel Mühe gemacht hat.
Sein Mund verzieht sich verächtlich.
»Seltsame Methoden, ein fünfjähriges Kind, das ein weiches, zärtliches Herz hat, erziehen zu wollen –«
»Claudia ist nicht sanft. Es ist schwer, mit ihr fertig zu werden.«
Er lächelt mitleidig.
»Ein Beweis, wie wenig Sie sich als Erzieherin eignen. Man muß sich das Herz eines Kindes erringen. Dazu fehlt Ihnen jedes Talent. Sie hätten den Weg zu mir finden müssen –«
»Sie haben ja nie Zeit«, versucht sie sich zu verteidigen.
»Allerdings!« stimmt er ihr spöttisch zu. »Ich sehe ein, einen Kardinalfehler begangen zu haben. Ich glaubte mein Kind in Ihrer Obhut gut aufgehoben, daß Sie es quälen, konnte ich nicht wissen. Es tut mir leid, daß ich Ihre Nachtruhe stören muß, ich hätte es Ihnen auch morgen früh sagen können. Aber so haben Sie Gelegenheit, jetzt noch Ihre Koffer zu packen, denn morgen früh möchte ich Sie nicht mehr in meinem Haus sehen.«
»Aber – aber.« Hilflos klappt ihr Mund auf und zu, aber da ist das Zimmer bereits leer. Mit Nachdruck ist die Tür ins Schloß gefallen.
Wie erschlagen sinkt sie auf die Couch zurück. Sie kann die harten Worte gar nicht fassen. Nur eins wird ihr klar. Das herrliche, bequeme Leben ist vorbei. Sie hat es selbst verspielt.
*
»Anneliese, ich kann meine linke Sandale nicht finden. Komm doch mal bitte, Anneliese«, ertönt es recht kläglich aus dem Kinderschlafzimmer.
»Moment, Frauke«, ruft Anneliese Klaus zurück. Sie ist selbst noch wie ein Kind anzuschauen, mit ihrer schmalen, zierlichen Figur, die sehr der kranken Mutter nebenan ähnelt, die sich von ihrer Lungenentzündung gar nicht wieder erholen will.
»Anneliese«, ruft es hinter ihr. »Zieh mir doch mal den Reißverschluß zu.« Das ist Heike, das zehnjährige Nesthäkchen der Familie Klaus.
Anneliese schließt den hellblauen Pullover und eilt dann hinüber zu Frauke, der zwölfjährigen Schwester, die unter dem Bett rumort und schließlich mit hochrotem Kopf auftaucht. »Er ist weg, einfach weg.«
Anneliese bückt sich und holt das Gesuchte unter dem Stuhl hervor. »Hier, du Ruschelbuschel, hast du deine Sandale«, sagt sie und gibt der Schwester einen gutmütigen Klaps auf die Schulter. »Wann wirst du endlich Ordnung lernen.«
Ehe Frauke sich verteidigen kann, ist Anneliese schon wieder in die Küche geeilt. Vier Schnitten für Hans-Georg, den Sechzehnjährigen, der immer am schnellsten in den Kleidern ist und daher bis zur letzten Minute schlafen kann. Vier Schnitten für Frauke und sechs für das Nesthäkchen, das ewig Hunger hat.
Schnell die Brote in sauberes Papier gewickelt und dann wieder zurück ins Kinderschlafzimmer. Ein blonder, verwuschelter Kopf ist nur zu sehen. Nicht gerade sanft schüttelt sie den Langschläfer an der Schulter.
»Nun wird’s aber Zeit, Hansi. Los, aufstehen, hörst du? Und vergiß nicht, die Zähne zu putzen.«
»Nein doch«, mault Hans-Georg ein wenig, schwingt sich jedoch schnell aus dem Bett und trottet in die Küche, wo Anneliese den Kaffee einschenkt und dann mit großer Sorgfalt ein Tablett richtet.
Behutsam öffnet sie die Tür zum Elternschlafzimmer. Aus großen fragenden Augen sieht ihr die Mutter entgegen.
»Schon wach, Mutti?« Anneliese neigt sich liebevoll über das Gesicht der geliebten Mutter und küßt sie herzlich.
»Wie mußt du dich abhetzen, Anneliese«, klagt die Kranke leise und schwermütig. »Alles ruht auf deinen Schultern, mein Kind. Wird es dir auch nicht zuviel?«
Mütterliche Sorge und Liebe liegen in ihren Worten.
Anneliese, die Achtzehnjährige, lacht leise und warm auf. »Aber Mutti, das ist doch gar nicht so schlimm«, wehrt sie leichthin ab. »Du glaubst nicht, wie artig die Rasselbande ist.«
»Und nun muß zu allem Unglück auch Vater noch mit seinem Oberschenkelbruch im Krankenhaus liegen«, seufzt die Kranke.
»Es geht ihm aber sehr gut, Mutti«, beschwichtigt Anneliese. »Du brauchst dich wirklich nicht zu sorgen.«
Anneliese drückt einen herzlichen Kuß auf die Wange der Frau, die aus dankbaren, glücklichen Augen zu ihr aufsieht.
»Was für ein gutes Kind bist du, meine Anneliese.« Ganz feuchte Augen hat sie dabei bekommen.
»Die Allerbeste bist doch du, Mutti. Werde nur recht bald gesund. Wir brauchen dich alle so nötig.«
»Ach ja, Kind.« Die Kranke legt sich wieder zurück.
»Jetzt muß ich aber gehen, Mutti.« Anneliese streicht noch einmal zärtlich über die blasse Wange der Mutter, dann läuft sie hinaus.
»Daß ihr mir rechtzeitig zur Schule geht, Kinder«, ruft sie, während sie noch einmal über ihr Haar bürstet, die Hände säubert und zu ihrer Tasche greift.
»Wiedersehen, seid lieb und brav«, ermahnt sie noch einmal die Geschwister, die eifrig bejahen. »Vielleicht gibt mir der Meister heute etwas Abfall für euch. Oder mögt ihr keine Schokolade?«
»Und ob, Anneliese.« Das kommt im Chor, im Brustton der Überzeugung zurück.
»Ich paß schon auf, Große«, setzt Hans-Georg noch hinzu. »Und um Mutti kümmere ich mich auch. Wiedersehen!«
Anneliese hetzt davon. Ein Glück, daß sie nur wenige Minuten Weg bis zur »Salina-Schokoladenfabrik« zu-rückzulegen hat. Täglich muß sie an dem hohen schmiedeeisernen Zaun der Villa Salin vorüber, und täglich hält sie Ausschau nach einem dunklen Lockenkopf.
Noch nie hat sie Gelegenheit gehabt, mit dem kleinen süßen Mädel ein Wort zu wechseln, das so artig neben einer eleganten Frau, wohl der Erzieherin, gehen muß.
Arme Kleine – denkt sie meist dabei – nie sieht man sie beim kindlichen Spiel. Nie sieht man sie einmal zerzaust. Immer ist alles geradezu beängstigend sauber an ihr – wie aus dem Schaufenster gestiegen.
Anneliese hat andere Vorstellungen von dem Leben eines Kindes. Sie meint, ein Kind sieht am süßesten aus, wenn es sich so richtig schmutzig beim Spielen gemacht hat.
Nein! Kinder müssen fröhlich sein – denkt sie abschließend und hastet
weiter. – Frühmorgens trifft sie ja niemals das kleine reizende Mädchen, das sie so sehr in ihr Herz geschlossen
hat.
Pünktlich wie jeden Tag steht sie an ihrem Arbeitsplatz, Arbeiterin unter vielen, bescheiden und hilfsbereit und von allen eigentlich gern gesehen.
Im Laufe des Vormittags, während sie mit flinken, geschickten Händen die appetitlichen Pralinen in die geschmackvollen Kartons schichtet, bleibt der Meister vor ihr stehen.
»Wie geht es dem Vater, Anneliese?« erkundigt er sich. Er kennt das Mäd-chen schon seit Kindheit, denn Rudolf Klaus und er sind gut befreundet. Annelieses Vater ist schon beinahe ein Menschenalter als Chauffeur in der Fabrik angestellt und hat unlängst bei einem Betriebsunfall einen Oberschenkelbruch erlitten.
Anneliese hebt den Kopf. Donnerwetter – geht es Meister Friedrich durch den Kopf – das Mädchen wird ja immer schöner.
»Danke, Onkel Friedrich«, sagt sie und lächelt den guten Freund der Familie herzlich an. »Vati geht es gut. Er hofft, in vierzehn Tagen wieder entlassen zu werden.«
»So bald schon?« Der hagere Mann mit den dicken Brillengläsern krault sich am Kopf. »Soll sich man erst richtig auskurieren lassen. Nichts über den Zaun brechen. Alles braucht seine Zeit. Mit so einem Bruch ist nicht zu spaßen. Manchmal bleiben die Knochen steif, und mit dem Beruf ist es aus –«
»Onkel Friedrich«, entfährt es ihr entsetzt und erschrocken. »Du meinst doch nicht etwa, Vati könnte nicht wieder hinters Steuer? Das wäre nicht auszudenken.«
»Nun sieh mich nicht gleich so entsetzt an, Mädel«, begütigt er. »Das wollte ich damit nicht sagen. Nur schonen soll sich der Vater. Es geht auch eine Weile ohne ihn. Sonntag werde ich ihn noch mal besuchen und mit ihm sprechen.«
»Ach ja, Onkel Friedrich, sprich du mal mit ihm«, kommt es erlöst von ihren Lippen. Er lächelt ihr noch einmal herzlich zu und setzt seinen Rundgang fort.
Punkt zwölf heult die Fabriksirene. Das bedeutet fünfundvierzig Minuten Mittagspause. Anneliese Klaus benutzt sie, um schnell in die nahe elterliche Wohnung zu laufen. Wieder passiert sie den eisernen Zaun, der sie von dem parkähnlichen, gepflegten Garten der Villa »Salin« trennt. Obwohl sie es sehr eilig hat, verharrt sie ein paar Augenblicke und überblickt die kiesbestreuten Wege.
Da – ihr Herzschlag stockt fast. Etwas Helles, Duftiges sitzt auf einem Ast eines der zartesten Bäume und besieht sich die Welt von oben, vergnügt mit den Beinen baumelnd. Was es aber nicht sieht, das ist, daß der Ast sich immer tiefer und tiefer neigt und bei Anneliese tödlichen Schrecken auslöst.
Sie fegt am Gitter entlang, sucht den Eingang und stürzt über ihr unbekannte Wege, bis sie endlich vor dem Baum steht. Gerade im rechten Augenblick, als der Ast abbricht und mitsamt der kleinen Gestalt auf Anneliese zugeflogen kommt.
Sie hält die Arme offen und liegt im nächsten Augenblick mit Claudia Salin, die sie mit beiden Händen zu fassen bekommen hat, am Boden.
Ein Paar große dunkle Augen sehen sie sprachlos an. Der kleine Mund verzieht sich wie im Schmerz.
»Hast du dir weh getan, Kind?« Anneliese zittert am ganzen Körper. Das Kind ist so benommen von dem plötzlichen Sturz, daß es nur nicken kann. Annelieses Hände tasten den kleinen Körper ab. »Tut es hier weh? Oder da?«
»Aber nein, Tante, mir tut nichts weh«, flüstert das Kind endlich, und jetzt tritt ein Ausdruck von Angst in die schönen Kinderaugen. »Tante, wirst du es Hilde sagen?«
»Hilde?« Anneliese überlegt. Das mag wohl die Erzieherin sein, und das Kind ist ihr entwichen.
»Ja, Hilde«, erzählt die Kleine eifrig und scheint sich in Annelieses Armen sehr wohl zu fühlen, denn sie macht es sich auf deren Schoß bequem. »Das ist nämlich unser Mädchen, weißt du, Tante? Mademoiselle ist abgereist.« Ihre Stimme sinkt zu einem geheimnisvollen Flüstern herab. »Papi hat sie fortgeschickt, und nun sollte Hilde auf mich aufpassen. Sie ist aber wirklich nicht schuld, Tante«, bekennt sie ehrlich. »Sie wollte nur ganz schnell einmal ins Haus gehen – da – da bin ich auf den Baum gestiegen.«
Die dunklen Augen bitten und flehen. »Nicht wahr, Tante, du wirst es Hilde nicht sagen? Sonst – sonst erfährt es Papi; dann ist er ganz traurig.«
Lächelnd schüttelt Anneliese den Kopf.
»Ganz bestimmt sage ich nichts, Kind.«
Im Nu klettert Claudia aus Annelieses Armen, so daß diese sich vom Boden erheben kann. Das Kind dreht sich nach allen Seiten.
»Sieh doch schnell mal nach, ob ich mir auch etwas zerrissen habe.«
Aufmerksam prüfend kontrolliert Anneliese das seidene Kleid Claudias. »Alles in Ordnung, Claudia«, stellt sie fest, und das Kind klatscht vor Freude in die Hände.
Liebevoll streicht Anneliese das wirre Haar aus der Stirn des Kindes, und Claudia hält ganz still, fast andächtig sagt sie:
»Das macht Papi auch mit mir, Tante. Du hast genauso weiche Hände wie Papi. Überhaupt, du bist auch so lieb wie Papi.«
Anneliese errötet, und gleichzeitig strömt ein gutes, warmes Gefühl für das reizende Kind durch sie. Arme Kleine! Wie wenig verwöhnt ist sie mit Zärtlichkeit.
Ehe sie antworten kann, kommt den Weg herauf eine Gestalt auf sie zugeflogen, so daß die weiße Schürze wie eine Fahne hinter ihr her flattert.
Schnell bückt Anneliese sich und schleudert den abgebrochenen Ast ins Gebüsch. Dankbar sieht das Kind zu ihr auf und läuft dem Mädchen entgegen.
»Hier bin ich, Hilde«, ruft sie ihr zu.
Anneliese sieht, wie das Mädchen die Hand des Kindes nimmt, ihr einen verwunderten Blick zuwirft und sich dann umdreht.
»Wiedersehen, Tante!« ruft Claudia der nachdenklich dastehenden Anneliese zu, und sie winkt mit der Hand zurück.
»Wiedersehen!«, flüstert sie, kaum hörbar. Sie fühlt unendliches Bedauern, daß sie sich nicht noch ein wenig mit dem lebhaften und gescheiten kleinen Mädel unterhalten kann.
Da fällt ihr ein, daß ihre Zeit kurz bemessen ist. Sie dreht sich auf dem Absatz um und verläßt den Park.
An diesem Tag ist Anneliese Klaus sehr oft nachdenklich. Und immer sieht sie ein paar erschrockene Kinderaugen vor sich.
*
Mabel Smith hat ihren Einzug in die Villa Salin gehalten. Sie ist eine überschlanke Person, mit hellem Haar, hellen Augen und hat die Nase voller Sommersprossen.
Scheu sieht Claudia zu der neuen Erzieherin auf, zaghaft reicht sie ihr die Hand.
»Guten Tag«, sagt sie und macht einen anmutigen Knicks. Die Engländerin nimmt die Kinderhand.
»Ich hoffe, wir werden gute Freunde, Claudia«, sagt sie dabei in etwas hartem Deutsch. »Du bist doch sicher ein artiges Kind.«
Die Kinderaugen sind mit schlecht verborgener Neugier auf das großflächige Gesicht der blonden Frau geheftet.
»Aber – immer bin ich nicht artig«, versichert sie treuherzig.
»So – o?« Die Engländerin runzelt die Stirn. »Das sagt man doch nicht gleich.«
»Doch«, behauptet Claudia überzeugt. »Papi sagt, ich müßte immer die Wahrheit sagen.«
Ein kurzer Blick streift den Hausherrn, der stumm dabeisteht. Er hat sich die Zeit dazu genommen. Sein Gesichtsausdruck ist undefinierbar.
Das Zimmermädchen Traute erscheint und meldet:
»Der Tee ist serviert.«
Salin wendet sich dem Mädchen zu. »Tee?« fragt er erstaunt.
Traute macht eine entsprechende Handbewegung. »Miß Smith wünschte Tee.«
»Ach so«, meint Salin gelassen, »ich verstehe. Natürlich bekommt Miß Smith ihren Tee. Mir lassen Sie aber einen ordentlichen Kaffee brauen, wenn es geht, recht schnell. Ich habe wenig Zeit.«
»Gewiß, Herr Salin«, erwidert Traute und verschwindet rasch.
»Darf ich bitten?« Salin läßt der Erzieherin den Vortritt und folgt, sein Töchterchen an der Hand, in das sonnendurchflutete Terrassenzimmer.
Miß Smith gibt sich viel Mühe, mit dem Hausherrn in ein Gespräch zu kommen, was ihr aber nicht recht gelingen will, wie sie es auch anfängt. Er ist höflich, aber über ein »ja« und »nein« kommt er nicht hinaus. Dagegen plaudert er munter mit Claudia, was die blonde Frau ärgerlich wahrnimmt.
Schon bald erhebt er sich. »Ich hoffe, daß es Ihnen gelingt, das Vertrauen und die Zuneigung Claudias zu gewinnen«, sagt er verbindlich zu der Erzieherin. »Mich entschuldigen Sie bitte.«
Ärgerlich sieht sie zu dem hochgewachsenen, eleganten Mann, den sie riesig interessant findet, auf. Und ärgerlich erwidert sie:
»Das dürfte wohl nur an Claudia liegen.«
Mit einem belustigten Lächeln neigt er sich zu seinem Töchterchen hinab und küßt es auf beide Wangen. »Also, Kleines, du hast es gehört. Sei recht lieb und brav.«
Eine Verneigung, höflich aber kühl zu der Erzieherin, und er geht rasch aus dem Raum.
Ein interessanter Mann, denkt Miß Smith. Warum er nicht wieder heiratet? Es lohnt sich, wenn man sich um ihn bemüht.
*
»Tag, Rudolf«, sagt Fritz Friedrich zu dem Freund, der mit gelblichem eingefallenem Gesicht in den Kissen ruht, und er verbirgt sein Erschrecken hinter einem erzwungenen Lächeln. Er hat Anneliese Klaus nach Arbeitsschluß in das Krankenhaus begleitet und nimmt neben dem Bett Platz. Anneliese hockt sich leicht auf den Bettrand. Sie forscht mit ihren leuchtenden Blauaugen in Friedrichs Zügen, wird aber nicht klug daraus.
»Findest du Vati besser?« flüstert sie ihm leise zu, als sie nebeneinander am Fenster stehen, da die Schwester beim Fiebermessen ist.
»Ich weiß nicht, Kind«, sagt er gedankenvoll. Aber er weiß genau, daß der Freund ihm nicht gefällt. »Wir werden uns dann beim Oberarzt melden lassen«, verspricht er, und Anneliese seufzt leicht.
»Wie geht es Mutti? Was machen die Kleinen?« erkundigt Rudolf Klaus sich mit matter Stimme, die Anneliese gar nicht mehr an das kräftige Organ des Vaters erinnert. Sie berichtet über alles, was er wissen will, und auch Fried-rich erzählt aus dem Betrieb.
Als Klaus den Kopf ermüdet zur Seite wendet, verlassen die beiden das Krankenzimmer. Schweigend gehen sie den langen Korridor hinunter. Aus der vorletzten Tür tritt die Stationsschwester.
»Ach, da sind Sie ja«, sagt sie und drückt die Tür hinter sich ins Schloß. »Kommen Sie bitte. Doktor Krause hat jetzt Zeit für Sie.«
Sie geht voran und öffnet eine Tür, die auf der anderen Seite liegt. Und dann stehen sie vor dem Arzt. Er ist schmal, drahtig und hat den Kopf eines Schauspielers. Seine Augen sind ernst und gütig.
Anneliese blickt auf seinen Mund, als erwarte sie von ihm ihr Seelenheil.
Sie lauscht seiner Stimme, ohne recht zu verstehen, was er sagt, weil sie nur das eine hören will: »Es geht ihm gut, und er wird bald entlassen werden können.«
Um so mehr erschrickt sie, als sie hört, daß sich der Zustand unerklärlicherweise verschlechtert habe und man zur Amputation schreiten müsse.
Sie umklammert die Armlehnen, daß es sie schmerzt. »Um Gottes willen«, entfährt es ihr, und sie denkt an die kranke Mutter, der jede Aufregung ferngehalten werden muß. »Muß das sein?«
Der Arzt nickt nur.
Armer Vater – durchfährt es sie schmerzhaft – wie wirst du es ertragen?
Sie richtet sich straff empor. Schneeweiß leuchtet ihr Gesicht. »Wenn er nur leben wird, Herr Doktor.«
Darauf bleibt der Arzt ihr die Antwort schuldig. Wieder hallen ihre Schritte im Korridor. Anneliese fühlt einen würgenden Schmerz im Hals.
Als sie das Portal passiert haben, taumelt sie gegen die Steinbrüstung der Freitreppe. Der Druck, der auf ihrem Herzen lastet, macht sich in einem überquellenden Tränenstrom Luft.
Fritz Friedrich dreht sie zu sich herum, so daß ihr Kopf gegen seine Brust zu liegen kommt.
»Nicht zu schwarz sehen, Anneliese. Du bist nicht allein. Onkel Friedrich ist auch noch da.«
»Ach, Onkel Friedrich«, klagt sie leise und trocknet energisch die tränennassen Wangen. »Wir waren alle so glücklich. Vati und Mutti und die Kinder. Wann haben wir einmal etwas von Krankheit gewußt? Und nun soll uns vielleicht sogar Vati genommen wer-den –«
»Aber, Anneliese«, unterbricht er sie rasch, »wer wird denn gleich an das Schlimmste denken?«
Beim Gehen legt er leicht den Arm um ihre Schulter. »Solange der Arzt hofft, hoffe auch ich«, sagt er, und Anneliese schweigt bedrückt. Es soll ein Trost sein, fühlt sie, aber seinen Worten fehlt die Überzeugung.
*
In der kleinen Wohnung des Kraftfahrers Rudolf Klaus ist es merkwürdig ruhig geworden. Die Kinder wissen nicht genau, wie es mit Vati steht. Man hat ihnen nur erklärt, daß er nochmals operiert werden muß.
Sie gehen auf Zehenspitzen an der Tür vorbei, hinter der Onkel Friedrich mit der Mutter spricht. Sie hören aber nur seine Stimme und dazwischen Muttis Schluchzen.
Trotz aller Behutsamkeit, mit der die Kinder umhergehen, sind sie irgendwie leicht reizbar. Selbst die ausgeglichene Anneliese ist anders. Nach außen hin ruhig und gelassen erscheinend, aber innerlich voller Spannung.
Wie wird es Mutti tragen – sinnt sie – und das Herz wird wieder schwer und beginnt ängstlich zu hämmern. Sie möchte hinüberlaufen und fürchtet sich doch vor den forschenden Augen der Mutter, vor denen man nichts verbergen kann, vor allem nicht die eigene Angst vor dem Kommenden.
Sie fährt sich rasch über die brennenden Augen und schrickt zusammen, als sich eine Hand auf ihre Schulter legt. Sie sieht in Fritz Friedrichs ernstes Gesicht.
»Was macht Mutti?« flüstert sie.