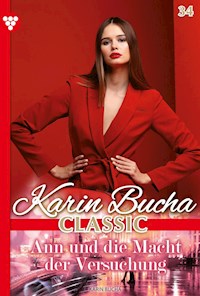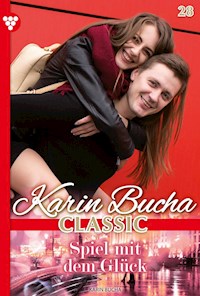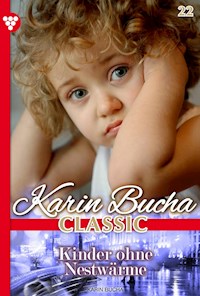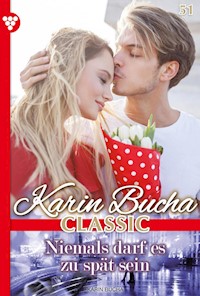
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Karin Bucha Classic
- Sprache: Deutsch
Karin Bucha ist eine der erfolgreichsten Volksschriftstellerinnen und hat sich mit ihren ergreifenden Schicksalsromanen in die Herzen von Millionen LeserInnen geschrieben. Dabei stand für diese großartige Schriftstellerin die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach Fürsorge, Kinderglück und Mutterliebe stets im Mittelpunkt. Karin Bucha Classic ist eine spannende, einfühlsame geschilderte Liebesromanserie, die in dieser Art ihresgleichen sucht. Rudolf Hermann hat noch nie einen Chauffeur benötigt. Auch jetzt steuert er den schweren Wagen durch die Toreinfahrt, hält vor dem langgestreckten Gebäude, in dem seine Geschäftsräume untergebracht sind, und ehe er aussteigt, verharrt er eine Weile regungslos hinter dem Lenkrad. Der Mann, der immer in Bewegung ist, von dem man nur rastloses Schaffen gewohnt ist, sitzt zusammengeduckt hinter der Windschutzscheibe und starrt aus brennenden, todernsten Augen ins Leere. Eine grenzenlose Gleichgültigkeit ist über ihn gekommen, und nur der eine Wunsch beherrscht ihn, einmal die Augen zu schließen, nichts denken zu müssen und ruhen – ruhen. Aber da sind Gedanken wie tausend Ameisen, die sein Gehirn durchwühlen. Immer wieder laufen sie auf das eine zu: Ich bin erledigt! Ich bin restlos fertig! Alles Schaffen, das aufreibende Schuften war umsonst. Es ist zu Ende mit mir. Er schließt die Augen. Jetzt müßte ein Mensch neben ihm stehen, der ihm sanft über die heiße Stirn streift. Kühle, wohltuende Hände müßten da sein. Ein weicher Mund müßte gute, sanfte Worte zu ihm sagen und ihm bestätigen, daß er nichts versäumt hat, daß er schuldlos ist an diesem geschäftlichen Zusammenbruch. Ja – und dieser Mensch mußte Stefanie, seine Frau, sein, die er doch als blutjunger, unerfahrener Mensch geheiratet hat, weil er sie sinnlos liebte. Nur für sie und für die rasch aufeinander folgenden Kinder hat er geschuftet. Ihnen hat er ein sorgloses Leben bieten wollen. Alles, was er einst als Sohn eines Maurerpoliers entbehren mußte, hat er seiner Frau und den Kindern geschaffen. Er hat schweigend zugesehen, wie sie das Geld sinnlos zum Fenster hinauswarfen, weil er spürte, daß sie nur dann glücklich waren. Und er hat in dieser seltsamen Ehe das Lachen immer mehr verlernt. Langsam steigt er die Stufen zum Eingang empor, geht den langen Korridor und an den Glastüren vorüber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karin Bucha Classic – 51 –Niemals darf es zu spät sein
Karin Bucha
Rudolf Hermann hat noch nie einen Chauffeur benötigt. Auch jetzt steuert er den schweren Wagen durch die Toreinfahrt, hält vor dem langgestreckten Gebäude, in dem seine Geschäftsräume untergebracht sind, und ehe er aussteigt, verharrt er eine Weile regungslos hinter dem Lenkrad.
Der Mann, der immer in Bewegung ist, von dem man nur rastloses Schaffen gewohnt ist, sitzt zusammengeduckt hinter der Windschutzscheibe und starrt aus brennenden, todernsten Augen ins Leere. Eine grenzenlose Gleichgültigkeit ist über ihn gekommen, und nur der eine Wunsch beherrscht ihn, einmal die Augen zu schließen, nichts denken zu müssen und ruhen – ruhen.
Aber da sind Gedanken wie tausend Ameisen, die sein Gehirn durchwühlen. Immer wieder laufen sie auf das eine zu: Ich bin erledigt! Ich bin restlos fertig! Alles Schaffen, das aufreibende Schuften war umsonst. Es ist zu Ende mit mir.
Er schließt die Augen. Jetzt müßte ein Mensch neben ihm stehen, der ihm sanft über die heiße Stirn streift. Kühle, wohltuende Hände müßten da sein. Ein weicher Mund müßte gute, sanfte Worte zu ihm sagen und ihm bestätigen, daß er nichts versäumt hat, daß er schuldlos ist an diesem geschäftlichen Zusammenbruch.
Ja – und dieser Mensch mußte Stefanie, seine Frau, sein, die er doch als blutjunger, unerfahrener Mensch geheiratet hat, weil er sie sinnlos liebte.
Nur für sie und für die rasch aufeinander folgenden Kinder hat er geschuftet. Ihnen hat er ein sorgloses Leben bieten wollen. Alles, was er einst als Sohn eines Maurerpoliers entbehren mußte, hat er seiner Frau und den Kindern geschaffen. Er hat schweigend zugesehen, wie sie das Geld sinnlos zum Fenster hinauswarfen, weil er spürte, daß sie nur dann glücklich waren. Und er hat in dieser seltsamen Ehe das Lachen immer mehr verlernt.
Langsam steigt er die Stufen zum Eingang empor, geht den langen Korridor und an den Glastüren vorüber. Schemenhaft sieht er helle und dunkle Köpfe über Schreibmaschinen und Schreibtisch gebeugt. Sonst hat er freundlich hier und da gegrüßt. Heute geht er mit zusammengepreßten Lippen und todernsten Augen vorüber, die nichts sehen. Die nichts sehen wollen.
Grußlos durchquert er das Zimmer seiner Sekretärin und verschwindet in seinem Zimmer. Stöhnend, noch im leichten Sommermantel, läßt er sich am Schreibtisch nieder. Seine Hand zuckt vorwärts und bleibt zögernd in der Luft hängen.
Sekunden vergehen, dann drückt er einen der Knöpfe, und wenig später klopft es an seine Tür.
Emil Weber, sein Prokurist und Freund, tritt ein. Er ist zehn Jahre älter als Hermann. Sie waren als junge Menschen zusammen bei einer Firma. Hermann als Maurer und Weber als junger Angestellter. Als er dann von Stefanies Geld das Bauunternehmen gründete, holte er ihn in sein junges Unternehmen und hat es nie zu bereuen brauchen.
»Nun?« Lautlos tritt Emil Weber näher. Er trägt ein Bündel Akten unter dem Arm und betrachtet das mutlose Gesicht seines Chefs und Freundes besorgt. »Hat es geklappt?«
Hermann macht eine leichte Handbewegung, dann birgt er stöhnend das Gesicht in den Händen. Emil Weber weiß alles. Ihm ist ganz elend zumute. Er spürt einen Schmerz in sich wie damals, als ihn die gute, geliebte Frau für immer verließ. Ganz schnell, aus einem stillen, aber großen Glück hat der Tod sie herausgerissen. Seither hat er sich dem Unternehmen mit Haut und Haaren verschrieben.
»Es ist aus«, reißt Hermanns rauhe Stimme ihn aus seinen schmerzlichen Gedanken. »Alles vorbei. Wir müssen das Objekt weitergeben und werden alles Geld bis auf einen winzigen Rest verlieren.«
Weber tritt näher an den Schreibtisch heran. Seine Hand ruht auf der Schulter Hermanns. Wenn sie unter sich sind, sagen sie »du« zueinander.
»Wir werden mit dem Rest, und sei er noch so klein, von vorn beginnen«, tröstet er begütigend.
Hermann fährt herum. Er starrt den Freund und Vertrauten an. Dann lacht er bitter auf.
»Auf den Rest wartet bereits meine Frau. Sie braucht das Geld. Sie kann und will nicht verzichten, wie sie sagt.« Er stöhnt abermals auf. »Ich bin ein entsetzlicher Feigling. Ich kann es ihr nicht sagen, daß sie mir damit die letzte, die allerletzte Chance nimmt, das Unternehmen zu retten.«
»Dann werde ich es ihr sagen!« Durch die hagere Gestalt Webers geht es wie ein Ruck. »Du warst bisher viel zu gutmütig deiner Familie gegenüber.«
»Ich weiß es ja, Emil«, unterbricht Hermann ihn verzweifelt. »Ich brachte es niemals übers Herz, ihnen nur einen Wunsch abzuschlagen. Ich bin ja an allem schuld.«
»Natürlich bist du schuld«, sagt Weber bitter. »Du hast gearbeitet wie ein Pferd, du hast nur an das Wohl und Wehe deiner Frau, deiner Kinder gedacht. Du hast nicht einmal Dankbarkeit gefordert. Es war eine Selbstverständlichkeit für dich, bescheiden zu leben, während die anderen, ach…« Er macht eine ziellose Bewegung mit der Hand durch die Luft. »Und nun quälst du dich noch mit den Gedanken herum, alles verschuldet zu haben. Sprich noch einmal mit deiner Frau. Sie wird es einsehen und dir helfen. Menschenskind, man kann doch eine Firma, die nahezu fünfundzwanzig Jahre besteht, nicht einfach vor die Hunde gehen lassen, Rudolf! So viel Vernunft muß doch wohl deine Frau haben.«
Hermann wirft einen schmerzlichen Blick zu Weber auf. Lieber, guter Freund, sinnt er hinter dessen Worten her. Was weißt du von meiner Frau? Etwas wohl – aber nicht alles. Was weißt du von dem aufreibenden Leben, das ich an Stefanies Seite geführt habe. Du hast sie erkannt, aber nur zu einem kleinen Teil. Du kennst nicht ihre Habgier und den Götzen Geld, dem allein sie huldigt.
Langsam erhebt er sich, löst den Gürtel seines Mantels und wirft ihn über den nächsten Sessel.
»Es ist sinnlos, mit Stefanie zu reden«, sagt er kurz und entschlossen. »Laß uns noch einmal rechnen. Vielleicht langt es nicht einmal, um Stefanie das zurückzugeben, was sie mit in die Ehe gebracht hat.«
Hermann geht zum Fenster hinüber. Er schweigt, und Weber wagt ihn nicht in seinen Gedanken zu stören.
»Rudolf«, sagt er mit aller Wärme, »was auch kommen mag, auf mich kannst du jederzeit rechnen. Ich bin dein Freund. Wir werden das Kommende gemeinsam tragen.«
Hermann schluckt, dann dreht er sich um. Er blickt dem Freund stumm in die Augen.
»Danke«, würgt er hervor, und sich fangend setzt er hinzu: »Laß uns noch einmal die Bücher durchgehen.«
*
Die Räume der Angestellten liegen in Dunkelheit. Nur in Rudolf Hermanns Zimmer brennt bis tief in die Nacht hinein das Licht. Sie sind beide todmüde und haben Schatten unter den Augen. Vielleicht kommt es auch von der entsetzlichen Gewißheit. Hermann wird gerade noch das Geld für seine Frau aufbringen können. Er ist arm, bettelarm.
Als der Fernsprecher anschlägt, zucken sie beide zusammen. Emil Weber nimmt den Hörer ab und meldet sich. Er wird noch einen Schein bleicher und wirft einen scheuen Blick auf Hermann, der, den Kopf in der Hand gestützt, Zahlen auf das Papier malt.
»Du wirst verlangt, Rudolf«, sagt er endlich.
»Stefanie?« flüstert Hermann.
»Nein«, preßt Weber hervor, »das Städtische Krankenhaus – es ist – du sollst –«
Hermann nimmt dem völlig verstörten Mann den Hörer aus der Hand und meldet sich. Eine Frauenstimme, kühl und unpersönlich, spricht zu ihm.
Ein Schauer überläuft ihn. Sein Mund öffnet sich und zittert hilflos, dann hängt er langsam an.
»Lothar«, stößt er hervor, »verunglückt – es steht schlimm um ihn. Man erwartet – mich.«
Wortlos geht Emil Weber zu dem Sessel, wo immer noch Hermanns Mantel liegt, und trägt ihn herbei. »Ich begleite dich selbstverständlich«, sagt er.
Wenig später verlassen sie das Büro und fahren durch die Nacht. Schweigen herrscht zwischen ihnen. Manchmal kommt ein Laut wie tiefes Stöhnen aus Rudolf Hermanns Brust, dann wieder ist nichts als das Summen des Motors zu hören.
Nie wird Rudolf Hermann diese Fahrt zum Krankenhaus vergessen. Zu den sonstigen Vorwürfen, die er sich macht, kommt noch die Erkenntnis: Ich habe mich zu wenig um meine Kinder gekümmert! Ich habe sie völlig dem Einfluß ihrer Mutter überlassen. Es mußte ja einmal mit Lothar so kommen. Von einer Party zur anderen, berauscht und in toller Fahrt dann heimwärts. Was hat er auf seine Vorhaltungen zur Antwort bekommen? Nur ein gleichgültiges Achselzucken. »Das verstehst du nicht, Vater«, war der immer wiederkehrende Reim.
Und nun liegt sein Ältester schwerverletzt im Krankenhaus. Wieder dieses tiefe, qualvolle Stöhnen. Sacht legt Emil Weber seine Hand auf die Hermanns, die das Steuerrad führt, trotz aller Verzweiflung ruhig und sicher.
»Noch lebt Lothar, und wo Leben ist, ist auch Hoffnung«, raunt er leise.
Im Krankenhaus ist man auf Hermanns Besuch schon vorbereitet. Eine Schwester geleitet sie über einen schwach erhellten Korridor, an hohen weißen Türen vorbei.
Der Gang macht eine Biegung. Schon von weitem hört er unbeherrschtes Weinen. Er kennt dieses Weinen, das sich von Minute zu Minute steigern kann. Es ist ein hysterisches Weinen, das auf die Nerven wirkt.
»Stefanie!« Er legt seine Hand auf die Schulter der Frau, die auf der weißen Bank hockt. Ein Kopf ruckt empor. Die Tränen haben eine verheerende Wirkung auf diesem Frauengesicht angerichtet. Tusche und Schminke haben sich gelöst und das Gesicht verschmiert.
Die Augen sind dick verquollen. Als sie den Gatten erkennt, fährt sie mit einem schrillen Schrei empor.
»Psst!« mahnt die Schwester. Sie schüttelt leise den Kopf. Selten hat sie eine so unbeherrschte Frau und Mutter an einem Krankenbett erlebt.
»Sie lassen mich nicht zu ihm, Rudolf. Nimm mich mit, ich werde sonst verrückt. Ich bin die Mutter, ich gehöre an die Seite meines Sohnes.«
Ratlos sieht Rudolf Hermann sich nach dem abseits stehenden Arzt um, der wohl auf ihn gewartet hat. Er tritt etwas heran.
»Es tut mir leid, gnädige Frau«, sagt er bestimmt. »In diesem Zustand kann ich Sie nicht zu dem Kranken lassen. Es sei denn, Sie verhalten sich äußerst ruhig.«
»Ja, ja, alles was Sie wollen, tue ich«, stammelt die Frau und klammert sich an den Gatten.
Gemeinsam betreten sie das schmale, stille Zimmer. Seit Jahren erstmals wieder Seite an Seite, aber es schwingt nichts zwischen ihnen, keine Wärme, keine Liebe. Im Augenblick verbindet sie nur die gemeinsame Sorge um den Sohn.
Rudolf Hermann stutzt, als er das wächserne, von Verbänden umhüllte Gesicht seines Sohnes in den Kissen gewahrt. Eine Schwester erhebt sich und tritt bescheiden seitwärts.
Stefanie Hermann will wieder in lautes Weinen ausbrechen. Da fühlt sie die Hand des Gatten auf ihrem Mund.
»Sei still«, herrscht er sie an, mit rauher, ihm selbst fremd vorkommender Stimme. Da sinkt sie auf den Stuhl und jammert. »Mir wird schlecht, Rudolf.«
Im Nu ist die Schwester neben ihr, nimmt ihren Arm und führt die Wankende hinaus.
Rudolf Hermann ist mit seinem Sohn allein. Lieber Gott, laß ihn nicht sterben! geht es ihm unaufhörlich durch den Kopf. Seine Hand tastet sich vor, legt sich behutsam auf den Arm, das einzige unverletzte Glied, das nicht in Gips liegt und bandagiert ist.
»Lothar, mein Junge!« flüstert er. Die breiten Schultern des einsamen Mannes zucken. Wie sehr er ihn liebt, seinen Ältesten. Jetzt erst kommt ihm das richtig zum Bewußtsein, jetzt, da der Todesengel um das Bett schleicht und die Hände nach dem jungen, blühenden Leben ausstreckt.
Verzeih mir, Lothar, ich war ein Schwächling. Ich habe dich und auch deine Geschwister deiner Mutter überlassen. Sie hat euch zu dem gemacht, was ihr geworden seid.
Schlag noch einmal die Augen auf, Lothar. Sag mir, daß ich nicht alles falsch gemacht habe. Wenn du willst und wenn du mir erhalten bleibst, dann, mein Junge, will ich dir der beste Freund sein.
»Sie dürfen hierbleiben!«
Rudolf Hermann schreckte empor. Tief in den Höhlen liegen seine Augen. Doktor Rauher hat schon oft in so tief verzweifelte Vateraugen geblickt. Aber ihm ist, als liege eine ganz besondere Tragik in diesen Augen.
»Wie lange?« flüstert Hermann. Der Arzt lächelt gütig.
»Solange Sie wollen, bis – bis der Kranke aus der Narkose erwacht.«
Und meine Frau – will Hermann fragen – doch er unterläßt es. Es ist so wundersam, den Sohn einmal ganz für sich allein zu haben, ohne Gezeter, ohne Gekreische und ohne dieses nerventötende, hysterische Weinen. Nur der Anlaß müßte ein anderer sein, nicht so tieftraurig, so hoffnungslos.
In diesen stillen Nachtstunden am Krankenbett seines Sohnes, das Herz von Vorwürfen und Verzweiflung zerrissen, zieht sein Leben in bunten, immer wechselnden Bildern an seinem geistigen Auge vorüber.
Er sieht sich als jungen, verliebten Bräutigam an der Seite der schönen blonden lebenslustigen Stefanie wieder. Er hört die Worte seines verehrten Schwiegervaters, der so bald schon nach der Hochzeit starb: »In deinen Händen weiß ich Stefanies Geld gut aufgehoben, mein Junge.« Und er hatte von Stunde an gearbeitet, um sich dieses geschenkten Vertrauens würdig zu erweisen.
Die Kinder waren gekommen, zuerst Lothar, das schöne dunkelhaarige Kind. Dann kam Cornelia, das anmutige, zarte und bezaubernde Mädchen mit den rotbraunen Locken. Später wurden die Zwillinge geboren, Christian und Christine. Er hat sie selten gesehen, seine Kinder. Selbst nachts, wenn er todmüde in sein Haus zurückkehrte, durfte er den Kleinen nicht über das Haar streichen. »Die Kinder brauchen ihre Nachtruhe«, hatte Stefanie ihn hart angefahren, und er wußte genau, sie nahm am allerwenigsten auf die Kinder Rücksicht, ihr ging es nur darum, ihn zu kränken.
Immer fremder wurden sie sich, immer kälter ihr Verhältnis zueinander. Um den sich immer mehr zuspitzenden Auseinandersetzungen zu entgehen, war er zu seiner Arbeit geflohen. Seine innerliche Vereinsamung wurde immer größer.
Liebten seine Kinder ihn eigentlich? Er weiß es nicht! Manchmal hat er sogar das Gefühl gehabt, daß sie ihn haßten, weil er ihre Lebensführung nicht billigte. Hatte Stefanie Haß in den Kindern großgezogen? Haß gegen ihn, den Vater?
Wie wird es weitergehen, wenn Stefanie erst erfährt, daß er vor dem Nichts steht?
Er ahnt, daß es eine schreckliche Auseinandersetzung geben wird, denn er wird ihr diesmal schonungslos die Wahrheit sagen. Nach ihrem Verhalten wird er die Entscheidung treffen.
Während dieser Erwägungen hält er die unverletzte Hand des Sohnes warm umschlossen. Er sieht nicht, daß hinter den hellen Vorhängen ein neuer Tag graut und sein fahles Licht in das schmale Krankenzimmer wirft.
Er spürt nur plötzlich, wie die Hand in seinen kraftvollen Fingern zu zucken beginnt.
»Lothar!« Tief neigt er sich über das wächserne Gesicht des Sohnes.
Maßlose Angst umklammert sein Herz. Ist das Gesicht nicht bereits vom Tod gezeichnet? Er will sich erheben und zur Klingel greifen, aber er ist wie gelähmt.
Die umschatteten Lider heben sich. Lothars helle Augen blicken verständnislos zur Decke empor. Sein Mund verzieht sich schmerzhaft. Ganz wenig versucht er den Kopf zu drehen und sinkt mit geschlossenen Augen wieder zurück.
Rudolf Hermann hält den Atem an. Er hört das Stöhnen, langanhaltend und qualvoll.
Lothar versucht ein zweites Mal die Augen zu öffnen und den Kopf zu bewegen. Groß sind die hellen Augen auf das gespannte Gesicht des Vaters gerichtet. Die beiden Augenpaare halten einander fest.
»Vater«, flüstert der Kranke erschüttert, »lieber Vater!«
»Sei still, mein Junge«, ganz tief neigt Hermann sich zu dem Kranken hinab. »Hast du große Schmerzen? Soll ich nach dem Arzt klingeln?«
Leichtes Kopfschütteln. Voll Glück spürt Herrmann, wie sich Lothars Finger fest um seine schlingen. Stumm, die Augen wieder geschlossen, liegt Lothar auf seinem Bett.
Die Zeit verrinnt. Regungslos verharrt Hermann und bewacht den leichten Schlummer seines Sohnes.
Herrgott, erhalte ihn mir – fleht Hermann innerlich – vielleicht wird alles noch gut.
Er fährt schreckhaft zusammen, als der Arzt neben ihm steht, gefolgt von der Schwester.
Hermann erhebt sich, taumelt und zieht sich in den Hintergrund des Zimmers zurück. Er hört den Arzt leise mit dem Verletzten sprechen und wie er der Schwester einige Anweisungen gibt.
»Herr Doktor!« Rudolf Hermann hascht nach dem Arm des Arztes, als dieser an ihm vorbeigeht, um das Zimmer zu verlassen. Doktor Rauher macht eine Kopfbewegung, und Hermann folgt ihm. Draußen stehen sie sich gegenüber. »Wird er es überstehen?«
Es ist immer dieselbe Frage, die man ihm, dem Arzt, stellt, und er kann zunächst nie etwas Genaues sagen. »Ich will es hoffen«, weicht er aus. Und als er die Verzweiflung in den hellen Augen des Mannes sieht, erklärt er: »Die Knochenbrüche werden heilen. Natürlich kann man Komplikationen nie voraussehen. Aber ich muß Ihren Sohn noch einmal röntgen wegen innerer Verletzungen.«
»Und wann – wann werden Sie Gewißheit haben?«
»In einer Stunde«, erwidert der Arzt. »Sie dürfen warten, wenn Sie wollen.«
Er geht den Weg wieder zurück und setzt sich auf die Bank, auf der er in der Nacht Stefanie angetroffen hat. Er sieht, wie man seinen Sohn aus dem Zimmer und zum Fahrstuhl rollt. Kein Laut kommt von der fahrbaren Trage. Man hat ihm wohl eine schmerzstillende Spritze verabreicht.
Hermann fröstelt. Ihm ist, als würde er alle Schmerzen erleiden, durch die sich sein Sohn hindurchkämpfen muß.
Er hat sich vornübergebeugt. Die Hände läßt er zwischen den Knien baumeln. Er hat plötzlich Zeit, so viel Zeit. Was augenblicklich zu tun ist, wird von Emil Weber bestens erledigt. Das weiß er.
Sein ganzes Denken gilt seinem Sohn und dem heißen Wunsch nach Gewißheit, damit die furchtbare Angst von ihm genommen wird.
Er fährt empor, als Doktor Rauher vor ihm steht. Im Nu springt er auf die Beine.
»Nun?«
Nie wird Hermann das Lächeln des Arztes vergessen, der ihm gleich sympathisch war. Es ist beruhigend und begütigend zugleich.
»Keine inneren Verletzungen«, sagt er hoffnungsvoll und greift schnell zu, denn die kraftvolle Gestalt Hermanns gerät ins Taumeln.
»Hoppla, hoppla«, lacht Doktor Rauher leise auf. »Sie wollen doch nicht schlappmachen?« Schon lange hat er bemerkt, wie elend der Mann aussieht.
Hermann hat sich schnell gefangen. »Also dürfen wir hoffen?« stammelt er, und Doktor Rauher nickt. »Gehen Sie zu ihm. Er ist bei Bewußtsein.«
Und wieder sitzt Rudolf Hermann neben Lothar, und wieder finden sich ihrer beiden Hände. Schweigen herrscht zwischen ihnen. Wie eine Insel des Friedens, zumal der Kranke augenblicklich schmerzfrei ist unter der Wirkung der Spritze, so erscheint Hermann dieses Zimmer.
Und dann wird dieses beglückende Schweigen zwischen Vater und Sohn jäh unterbrochen.
Es beginnt mit dem harten Aufsetzen hoher Hacken auf den Fliesen draußen vor der Tür, die geräuschvoll aufgerissen wird, und Stefanie Hermann stürzt ins Zimmer.
Rudolf Hermann zuckt zusammen. Solange er sich zurückerinnert, ist Stefanie immer geräuschvoll aufgetreten.
»Lothar, mein Junge«, weint sie auf. »Wie konnte das nur geschehen? Mein Gott, was habe ich diese Nacht durchgemacht. Bald gestorben bin ich vor Schreck und Aufregungen. Hast du Schmerzen? Warum verziehst du den Mund so?« Und sie neigt sich über das noch blasser gewordene Gesicht des Kranken und beginnt es mit Küssen zu bedecken.
»Du sagst doch gar nichts, Liebling?« jammert Stefanie Hermann. »Bist du hier auch gut aufgehoben? Gefällt dir das Zimmer? Oder soll ich mit dem Arzt sprechen, daß man dir einen anderen Raum einräumt?«
»Mama, bitte«, fleht Lothar, und seine Augen suchen den Blick seines Vaters.
»Du hast mir meine Fragen gar nicht beantwortet, Lothar«, drängte Stefanie Hermann abermals. »Gefällt es dir hier nicht?«
Hermann macht diesem einseitig geführten Gespräch ein Ende.
»Siehst du nicht, wie sehr Lothar leidet?« raunt er ihr erbittert zu, und seine Hand zwingt sie zum Stillsitzen.
Entsetzt hängen die schönen, aber kühlen blauen Augen der Frau an dem harten Gesicht des Gatten.
»Ich meine es doch nur gut mit ihm«, beginnt sie abermals zu schluchzen. »Das ist doch kein Zimmer für meinen Sohn. Ich werde sofort veranlassen, daß er umgebettet wird.«
»Du wirst dich ganz still verhalten, hörst du? Lothar leidet große Schmerzen. Wenn es der Arzt gestattet und wenn es Lothars Wunsch ist, dann meinetwegen. Jetzt laß den Jungen in Ruhe.«
»Mama, bitte, geh«, kommt es schwach aus den Kissen.
Stefanie Hermann läßt die Tränen abermals fließen.
»Hörst du das?« stößt sie beleidigt hervor. »Wir sollen gehen.«
»Nein, Vater soll bei mir bleiben«, bittet der Kranke und dreht das Gesicht ein wenig der Wand zu.
»Lothar!« Das ist ein einziger empörter Aufschrei.
»Gnädige Frau, darf ich Sie hinausbegleiten?« Verstört sieht die Frau empor. Keiner hat den Arzt kommen hören, aber er war Zeuge der für ihn sehr inhaltsreichen Unterhaltung.
Willenlos gehorcht sie. An der Tür wirft sie noch einen Blick nach dem Bett zurück. Aber Lothar hält die Augen geschlossen. Sie schluchzt noch einmal auf und läßt sich dann davonführen.
Stefanies Tränen sind schnell versiegt; eine unbändige Wut beherrscht sie. Man hat sie regelrecht hinausgeschmissen. Vom Krankenbett des Sohnes verjagt. Das wird sie Rudolf heimzahlen.
»Nach Hause«, herrscht sie vor dem Portal den Chauffeur an und klettert in den Wagen, der eigens zu ihrer Verfügung steht, samt Fahrer. In steifer Haltung sitzt sie allein im Fond. Ihre Gedanken überschlagen sich hinter der Stirn.
Tausend Qualen durchlebt Rudolf Hermann. Aber in ihm ist eine winzige Hoffnung. Vielleicht wird Lothar leben.
Er ist selbst am Ende seiner Kraft. Die Aufregungen, die durcharbeitete Nacht, dann der Schock über das Unglück seines Sohnes, die durchgrübelte Nacht am Krankenbett und nun die langen einsamen Stunden als treuer Wächter haben ihm arg zugesetzt.
»Ich glaube, Sie müssen nun einmal an sich denken.« Doktor Rauher neigt sich flüsternd Hermann zu. »Die Nachtschwester übernimmt Ihr Amt. Sie haben Schlaf ebenfalls nötig.«
Mühsam hält Hermann die Augen offen. Er nickt. Noch einen liebevollen Blick wirft er auf den Kranken, der vor sich hin dämmert und nicht viel davon weiß, was um ihn herum vor sich geht.
»Morgen komme ich wieder«, flüstert Hermann zurück und verläßt das Krankenhaus.
*
Mit einer Taxe fährt Rudolf Hermann vor dem Grundstück vor, das er seiner Familie geschaffen hat. Ein weiter Park, gut gepflegt mit breiten, kiesbestreuten Wegen, Blumenrabatten und blühenden Büschen.
Hinter hohen Bäumen versteckt das Wohnhaus, im englischen Landhausstil erbaut und mit allem Komfort der Neuzeit eingerichtet. Langsam, den Hut in der Hand, geht er die breite Auffahrt hinauf. Der Abendwind spielt mit seinem Haar, das so dicht wie früher und nur an den Schläfen schlohweiß ist.
Er atmet die würzige Luft in tiefen Zügen. Er hat sich vorbereitet auf das, was geschehen muß.
Die Halle, mit der breiten Treppe, die nach oben führt und ein gewundenes Geländer trägt, ist schwach erleuchtet. Keiner der Angestellten ist sichtbar.
Er bleibt ein paar Minuten lauschend stehen, dann steigt er in das erste Stockwerk empor, geht über den jeden Laut dämpfenden Teppich und klopft an die Tür zum Schlafzimmer seiner Frau an.
»Wer ist da? Hat man denn keine Minute Ruhe in diesem Haus?«
»Ich bin es – Rudolf«, sagt er, seine Stimme zur Festigkeit zwingend.
Eine gewisse Zeit vergeht. Er hört Geräusche hinter der Tür, tapsende Schritte, und dann öffnet seine Frau.
»Mein Gott«, sagt sie ärgerlich. »So spät suchst du mich auf?«
Er sieht sie ernst und eindringlich an. Keine Frage nach dem Jungen. Sie sieht gepflegt wie immer aus.
»Was starrst du mich so an?«
»Ich habe mit dir zu reden, Stefanie, und erwarte dich in meinem Arbeitszimmer.«
»Du lieber Gott.« Stefanie Hermann hält mit beiden Händen den seidenen Morgenrock über der Brust zusammen. »Hat das nicht Zeit bis morgen?«
»Nein! Es muß jetzt sein, jetzt sofort.« Das klingt unnachgiebig, und erstmals versucht sie nicht ihren Willen durchzusetzen.
»Ich komme«, erwidert sie kurz und schlägt ihm die Tür vor der Nase zu.