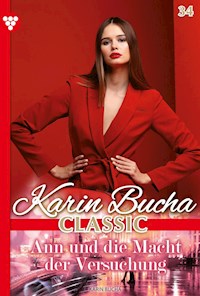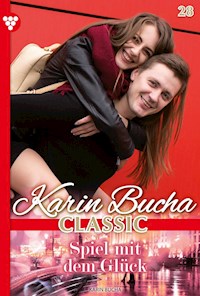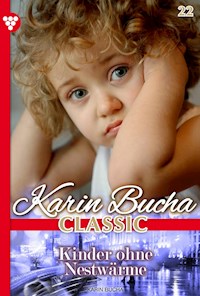Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Karin Bucha Classic
- Sprache: Deutsch
Karin Bucha ist eine der erfolgreichsten Volksschriftstellerinnen und hat sich mit ihren ergreifenden Schicksalsromanen in die Herzen von Millionen LeserInnen geschrieben. Dabei stand für diese großartige Schriftstellerin die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach Fürsorge, Kinderglück und Mutterliebe stets im Mittelpunkt. Karin Bucha Classic ist eine spannende, einfühlsame geschilderte Liebesromanserie, die in dieser Art ihresgleichen sucht. Auf dem blassen Antlitz der jungen Frau, die in der kahlen Zelle hin und her wandert, erscheint ein gequälter Ausdruck, als sich die schwere Eisentür in den Angeln bewegt. Den Kopf etwas vorgeneigt, verharrt sie wartend inmitten des Raumes, der sie seit Wochen von der Außenwelt trennt. »Kommen Sie mit«, sagt der Wärter mit einer Stimme, die keinerlei Mitleid mit der schönen Gefangenen verrät. Gleichgültig, monoton, so wie das Leben seit Wochen für Ina Cornelius abrollt. Aber sie haben sie noch nicht zerbrochen, die endlosen Nächte und Tage zwischen den Vernehmungen, Besprechungen mit dem Anwalt und Hoffen auf baldigen Termin. Neben der gedrungenen Gestalt des Wärters geht sie die kühlen weißen Gänge entlang. Es ist ein Weg, den sie nun schon wochenlang fast täglich zurücklegen muß, sie zu Verhören führt, sie an ihren Nerven zerren. Diesmal öffnet der Wärter die Tür des Sprechzimmers vor ihr. »Sie haben Besuch.« Ina Cornelius muß, geblendet von dem Sonnenschein, der voll auf sie fällt, für Sekunden die Augen schließen. »Doktor, Sie?« Es klingt erstaunt. Gewöhnlich sucht ihr Anwalt sie in ihrer Zelle auf. Mit bezwingender Herzlichkeit streckt sie ihm die Hand entgegen. »Gnädige Frau«, sagt er tief bewegt. »Sie wissen, weshalb ich gekommen bin?« »Sicher. Der Tag der Hauptverhandlung liegt fest.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karin Bucha Classic – 64 –Verlass mich nicht, Angela!
Als ein Mann um seine Liebe kämpfen mußte
Karin Bucha
Auf dem blassen Antlitz der jungen Frau, die in der kahlen Zelle hin und her wandert, erscheint ein gequälter Ausdruck, als sich die schwere Eisentür in den Angeln bewegt.
Den Kopf etwas vorgeneigt, verharrt sie wartend inmitten des Raumes, der sie seit Wochen von der Außenwelt trennt.
»Kommen Sie mit«, sagt der Wärter mit einer Stimme, die keinerlei Mitleid mit der schönen Gefangenen verrät. Gleichgültig, monoton, so wie das Leben seit Wochen für Ina Cornelius abrollt.
Aber sie haben sie noch nicht zerbrochen, die endlosen Nächte und Tage zwischen den Vernehmungen, Besprechungen mit dem Anwalt und Hoffen auf baldigen Termin.
Neben der gedrungenen Gestalt des Wärters geht sie die kühlen weißen Gänge entlang. Es ist ein Weg, den sie nun schon wochenlang fast täglich zurücklegen muß, sie zu Verhören führt, sie an ihren Nerven zerren.
Diesmal öffnet der Wärter die Tür des Sprechzimmers vor ihr.
»Sie haben Besuch.«
Ina Cornelius muß, geblendet von dem Sonnenschein, der voll auf sie fällt, für Sekunden die Augen schließen.
»Doktor, Sie?« Es klingt erstaunt. Gewöhnlich sucht ihr Anwalt sie in ihrer Zelle auf.
Mit bezwingender Herzlichkeit streckt sie ihm die Hand entgegen.
»Gnädige Frau«, sagt er tief bewegt. »Sie wissen, weshalb ich gekommen bin?«
»Sicher. Der Tag der Hauptverhandlung liegt fest.«
Sie weist mit einer anmutigen Bewegung auf den Stuhl, von dem der Besucher sich bei ihrem Eintritt erhoben hat, nicht als stünde sie im Sprechzimmer des Untersuchungsgefängnisses, sondern als empfänge sie in ihrer prachtvollen Villa den Besuch des Dr. Albert Merz.
Der Rechtsanwalt läßt sich nieder, nachdem Ina Cornelius eine Ecke der Holzbank eingenommen hat. Erwartungsvoll schaut sie ihren Verteidiger an.
»Nun, Doktor, Sie sprechen ja nicht?«
Dr. Merz zuckt leicht zusammen. Zu deutlich liegt die Bewunderung in seinen Augen, deren Blick allerdings verblüffend verwandlungsfähig ist.
»Verzeihen Sie«, murmelt er und fährt ernst und sachlich fort: »In drei Tagen stehen Sie vor den Richtern, gnädige Frau, und es hat sich nichts geändert. Presse und Öffentlichkeit sind gegen Sie…«
»Und Sie, Doktor?« unterbricht sie ihn, die Augen groß und fragend auf ihn gerichtet.
»Ich?« Er springt auf und geht ein paar Schritte im Raum hin und her, bleibt vor ihr stehen und sagt im beschwörenden Ton: »Natürlich glaube ich an Ihre Unschuld, Ina Cornelius, aber darum geht es doch nicht. Es geht um Sie, um Ihren Kopf. Sprechen Sie doch endlich, ich bitte Sie, erschweren Sie mir mein Amt nicht unnütz. Seit Wochen bemühe ich mich Ihre Ruhe und Gelassenheit zu durchdringen, vergebens, Sie tragen einen Panzer, und ich zerbreche mir vergeblich den Kopf, was verbergen Sie dahinter?«
Sie macht eine müde Handbewegung.
»Ich habe alles gesagt, was ich sagen durfte. Ich warte…«
»… auf das Urteil?« fällt er hastig und erbittert ein.
»Auf meinen Mann«, entgegnet sie ruhig, und ein schönes Lächeln verklärt ihr Antlitz.
Kopfschüttelnd betrachtet er die Frau, deren Augen ins Unbestimmte gerichtet sind.
»Und wenn Ihr Gatte nicht kommt?«
»Er kommt!« Unerschütterlicher Glaube liegt in den zwei Worten, daß es ihm seltsam ans Herz greift.
»Ina Cornelius«, fragt er beschwörend, »woher nehmen Sie dieses unerschütterliche Vertrauen?«
Ihre Augen kehren zu ihm zurück.
»Aus der Liebe zu meinem Mann, Doktor Merz«, sagt sie einfach. »Meinen Hilferuf muß er erhalten haben. Ich weiß, er läßt mich in meiner Not nicht allein.« Danach bleibt es bedrückend still.
Zum ersten Mal ist ihr, als griffe eine eiskalte Hand an ihr Herz und preßte es zusammen. Was wird, wenn Peter nicht kommt? – Wenn sie die Liebe des Gatten zu hoch bewertet? – Lieber Gott! irrt es ihr verzweifelt durch den Sinn. Verliere ich nun doch noch die Nerven?
Nein! Nein! Alles bäumt sich auf in ihr. Er kommt! Er liebt mich doch. Er kommt!
Dr. Merz läßt keinen Blick von diesem ausdrucksvollen Antlitz.
Wovor fürchtet Ina Cornelius sich?
Langsam steht sie auf und reicht ihm die Hand.
»Auf Wiedersehen, Doktor«, sie lächelt schmerzlich, »in drei Tagen sehen wir uns wieder.«
Der Rechtsanwalt vermag nicht zu antworten. Er preßt seine Lippen sekundenlang auf den schmalen Handrücken der Frau und sieht hinter der schlanken Gestalt her, bis sich die Tür hinter ihr geschlossen hat.
»In drei Tagen«, murmelt er und ergreift hastig Hut und Aktentasche. Noch nie hat ihn ein Fall so sehr mitgenommen wie der Ina Cornelius’, die angeklagt ist, den Gatten ermordet zu haben, von deren Unschuld er jedoch überzeugt ist.
*
Peter Cornelius läuft wie ein Irrer in dem Vorzimmer, einem weiten, marmorbelegten Raum, hin und her. Er knallt ordentlich mit den Hacken auf, als könne der Mann, der hinter der gepolsterten Tür sitzt, es hören. Und er soll es hören. Er soll ihn endlich empfangen.
Hinter ihm schlürft es über den Fußboden. Ruckartig wendet Cornelius sich um und geht auf den alten weißhäutigen Diener zu.
»Wie lange soll ich hier noch warten?« fragte er, sich zur Ruhe zwingend. Als der Alte sich achselzuckend abwenden will, packt Cornelius ihn an der Brust. »Hiergeblieben!« donnert er. »Ich will wissen, ob Besuch beim Chef ist.«
»Ich – ich weiß das nicht«, stammelt der Mann erschrocken.
Cornelius’ Griff löst sich. Der alte taumelt und fängt sich wieder. Wie der Blitz, man sollte es seinen alten Beinen nicht zutrauen, ist er verschwunden.
Cornelius geht auf die Tür zu, reißt sie auf, öffnet die Doppeltür und steht im nächsten Augenblick Albartan gegenüber.
Mit verbindlichem Lächeln, hinter dem doch Staunen liegt, kommt die massige Gestalt auf Cornelius zu.
»Herr Cornelius«, sagt er geschmeidig und streckt dem unerwünschten Besucher die Hand entgegen. »Haben Sie es so eilig?«
»Nicht eine Minute habe ich noch zu verlieren, Herr Albartan«, sagt er eisig. »Ich habe meine Wünsche schriftlich niederlegen müssen. Sie versprachen mir, sich sofort zu entscheiden und haben mich warten lassen. Mit nichtssagenden Worten versucht man mich abzufertigen. Ich verlasse nicht eher diesen Raum, bis ich klarsehe.«
Sekundenlang forscht Albartan in dem Gesicht des hochgewachsenen Mannes, in dem die Augen vor Erregung wetterleuchten.
Dann wendet er sich gelassen dem riesigen Schreibtisch zu und weist auf den Sessel davor.
»Hm!« macht er aus der Tiefe seines Sessels heraus. »Und was nennen Sie klarsehen?«
»Ich muß drei Tage Urlaub haben. Ist daran etwas unklar?«
Cornelius hat vor dem Schreibtisch Aufstellung genommen, den Sessel verschmähend. Und der Mann hinter dem Schreibtisch spürt, daß er einen bis zum Äußersten entschlossenen Menschen vor sich hat.
»Das ist mir auch klar. Sie haben uns nur über die Gründe im unklaren gelassen, Peter Cornelius.«
Das Lächeln ist aus seinen Zügen verschwunden. Seine Stimme klingt kühl und sachlich. Aber damit weiß Cornelius mehr anzufangen als mit dieser lächelnden Freundlichkeit.
»Es geht um ein Menschenleben!«
»Und was haben Sie damit zu tun?« Der Zeiger der Uhr rückt unaufhörlich vorwärts. Es drängt, wenn er das Abendflugzeug noch erreichen will. Er stützt die Hände schwer auf die Schreibtischplatte und schreit: »Was ich damit zu tun habe? Ein Mensch leidet um mich. Und dieser Mensch ist meine Frau. Hören Sie, Albartan, es geht um meine Frau. Ich muß drei Tage Urlaub haben.«
Albartan macht eine ablehnende Handbewegung.
»Sie haben sich schriftlich verpflichtet, das Termin nicht zu verlassen, bis die Erfindung abgeschlossen ist. Sie wissen, daß wir hermetisch von der Außenwelt abgeschlossen sind. Unsere Arbeit bedingt das, Cornelius. Sie sollten Ihre Frau mitbringen. Sie kamen nur mit Ihrem Kind hier an.«
»Mein Gott, damals erkrankte meine Frau unter rätselhaften Umständen. Die Ärzte verboten eine Reise. Ich mußte pünktlich hier erscheinen. Was sollte ich tun?«
Die helle Verzweiflung springt Cornelius aus den Augen. Schweißperlen netzen seine Stirn.
»Gut, Peter Cornelius. Indessen ist Ihre Frau aber nicht nachgekommen. Wir gaben Ihnen damals noch eine Nachfrist. Heute ist eine Einreise Ihrer Gattin unmöglich. Auch das ist Ihnen bekannt.«
»Selbstverständlich ist mir das bekannt. Ich habe Ihnen aber schon schriftlich erklärt, daß man meine Frau des Mordes an mir angeklagt hat. Ich lebe aber. Meine Frau kann sich nicht einmal verteidigen, weil sie nicht über meinen Aufenthalt sprechen darf.« Peter Cornelius schreit es förmlich heraus. »Hören Sie, ich lebe! Es gibt überhaupt kein Überlegen. Ich muß zu meiner Frau.«
Wieder fällt die kühle Stimme ein: »Welche Sicherheiten bieten Sie uns, daß Sie pünktlich zurückkehren?«
Cornelius steht hoch aufgerichtet vor dem Chefingenieur.
»Ich verpfände Ihnen mein Ehrenwort.«
Die Blicke der beiden Männer begegnen sich. Cornelius’ in sich gefestigter Persönlichkeit scheint das Mißtrauen des Chefs zerstreut zu haben, ja, es ist, als schlinge sich plötzlich ein gemeinsames Band um sie.
Albartan erhebt sich und kommt um den Schreibtisch herum.
»Cornelius«, sagt er, und diesmal liegt Wärme in seinen Worten, »Sie wissen, ich habe an höherer Stelle Rechenschaft abzulegen. Mir genügt Ihr Ehrenwort, meinen Vorgesetzten aber nicht.
Sie müssen bedenken, Sie sind der Kopf einer Erfindung, die unter allen Umständen geheimgehalten werden muß. Wenn wir Sie laufenlassen, ist auch die Erfindung wertlos für uns, aber sie würde geradezu zu einer Gefahr, ja, es käme zu einer Katastrophe, tauchte sie plötzlich an anderer Stelle auf. Sie verstehen?«
»Nein!« sagte Cornelius kalt. »Ich höre nur, daß Ihnen mein Ehrenwort nicht genügt. Das empört mich. Ich habe mich schriftlich verpflichtet, das Terrain nicht zu verlassen. Das stimmt. Jetzt sind aber Momente eingetreten, die mich zwingen, meine Arbeit für kurze Zeit zu unterbrechen, ich betone, nur zu unterbrechen. Was Sie sonst noch andeuten, verstehe ich nicht.«
Albartan hebt leicht die Schultern. »Schade!«
»Welche Sicherheiten verlangen Sie sonst noch von mir?«
»Ihre Tochter.«
»Meine kleine Britta?« Cornelius starrt den Sprecher an, als habe er nicht recht verstanden. »Ein unschuldiges Kind ziehen Sie in Männerangelegenheiten?«
Der Blick Albartans irrt zur Seite, als schäme er sich.
»Ich habe Anweisungen von oben.
»Ach so«, Cornelius zieht die Mundwinkel verächtlich herab. »Es ist also alles schon fertig.«
»Cornelius!« Albartan streckt mit einer bittenden Gebärde Cornelius die Hand entgegen. »Ich habe Ihnen schon erklärt, nicht ich verlange, sondern diejenigen, denen ich verantwortlich bin.
Sie haben keine Zeit mehr zu verlieren. Sie erhalten den erbetenen Urlaub von drei Tagen. Nach Ablauf dieser Zeit kehren Sie zurück und alles ist in schönster Ordnung. Allerdings, eine Einreise Ihrer Gattin gestattet man jetzt nicht mehr. Weshalb zögern Sie noch?«
Ja, weshalb zögere ich eigentlich? denkt Peter Cornelius. Weil es ihn empört, daß man sich an seinem Kind schadlos halten will? Blödsinn! Er kommt in drei Tagen zurück.
Er strafft sich.
»Gut. Ich erkläre mich einverstanden.«
Es scheint, als würde Albartan aufatmen. Er nimmt hinter seinem Schreibtisch Platz, öffnet eine der Schubladen und bringt ein Bündel Papiere zum Vorschein.
»Hier, alles liegt bereit, was Sie zu Ihrer Reise benötigen. Bis zur Grenze benutzen Sie das Flugzeug. Tuchow hat Auftrag, Sie zum Flughafen zu fahren. Ihre kleine Tochter bringen Sie heute noch in die Villa ›Vellose‹.«
Wie ein Ruck geht es durch Cornelius’ Körper.
»Sie machen eine Gefangene aus dem Kind?«
»Unsinn!« Albartan wehrt mit einer beschwichtigenden Handbewegung ab. »Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Selbstverständlich darf die Erzieherin das Kind weiterhin betreuen. Es wird alles getan, um dem kleinen Fräulein den Aufenthalt in Villa ›Vellose‹ so angenehm wie möglich zu machen. Sind Sie nun zufrieden?«
»Ich füge mich Ihren Anordnungen«, weicht Cornelius aus, nimmt seine Papiere in Empfang und verabschiedet sich kühl von seinem Vorgesetzten.
Er spürt, daß seine Nerven bis zum Reißen gespannt sind.
Heim zu Britta, denkt er. Er muß die reine Nähe seines Kindes atmen, um ruhiger zu werden.
*
Britta Cornelius ist ein ganz entzückendes Geschöpf, feingliedrig wie die Mutter und von derselben dunklen Schönheit.
Mit einem Jubellaut schlingt sie die Ärmchen um des Vaters Hals.
»Bleibst du bei mir, Papi?«
Cornelius schüttelt den Kopf.
»Geht nicht Herzchen, Papi muß verreisen.«
»Oh, zu Mami?« Britta herzt den Vater stürmisch. »Holst du endlich Mami zu uns? Das wird aber schön, Papi. Mami lassen wir nie wieder fort – nie wieder, Papi, nicht wahr?«
Trauer senkt sich über Cornelius’ Züge. Er darf ja Ina nicht mitbringen.
»Bringst du Mami mit, Papa?« forscht Klein-Britta mit kindlicher Hartnäckigkeit.
»Vielleicht, Britta«, weicht er aus, und setzt das Kind zu Boden. »So, Herzchen, nun lauf schnell zu Gitta und bitte sie zu mir. Ich habe mit ihr zu sprechen.«
»Ja, Papi, ich laufe ganz schnell«, versichert die Kleine ernsthaft und springt munter davon.
Cornelius läßt einen langen Blick hinter der anmutigen Kindergestalt herlaufen, dann tastet dieser über die elegant ausgestattete Halle des Hauses. Wahrhaftig, man hat ihm ein prachtvolles Heim zur Verfügung gestellt – ein goldenes Gefängnis, das zu ertragen wäre, wenn Ina es mit ihm teilen könnte.
Seufzend wendet er sich seinem Arbeitszimmer zu, und eine halbe Stunde später hat er mit Gitta Mendis, die mit ganzem Herzen an Frau Ina und dem Kind hängt, alles Nötige besprochen.
»Nicht weinen«, tröstete Cornelia gütig. »Tuchow, mein Fahrer, bringt Sie mit Britta in die Villa ›Vellose‹. In drei Tagen bin ich zurück. Abschied nehme ich nicht von dem Kind. Kann ich mich auf Sie verlassen?«
»Unbedingt.«
Mit einem festen Händedruck verabschiedet er sich von dem jungen, gereiften Mädchen.
Eine weitere halbe Stunde später hat er alles für sich gepackt und geordnet. Da fährt auch schon Tuchow vor, verläßt den dunklen geschlossenen Wagen und kommt auf das Haus zu.
Cornelius übergibt seinen Koffer dem Fahrer.
»Zum Flughafen!«
Nun denkt er nur noch eins: Ich komme, Ina! – Ina, ich komme!
*
Der Zuhörerraum im Verhandlungssaal des Schwurgerichts ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Auch die Presse ist vollzählig erschienen. Nur diejenigen, die zur Gesellschaft und zu Ina Cornelius’ Bekanntenkreis zählen, sind ferngeblieben.
Über dem weiten Raum liegt es wie Wettergewölk, als sei quer ein mit elektrischer Spannung geladenes Netz gespannt.
Reden und Widerreden toben hin und her, und Dr. Merz steht auf verlorenem Posten.
Die Herzen der Frauen schlagen Ina Cornelius entgegen, sie spüren, daß hinter den Aussagen der schönen Angeklagten eine tiefe Liebe verborgen liegt, um deretwillen sie sich in Schweigen hüllt. Zumindest gehört ihr die Zuneigung der Jugend, die noch von Liebe und Treueschwüren träumt.
Dr. Merz zittert um die Frau, denn er weiß, daß er die schwächste Stellung im Kampf um die Freiheit Ina Cornelius’ einnimmt.
»Ina Cornelius!« ruft der Vorsitzende die Angeklagte auf.
Die junge Frau erhebt sich.
In aufrechter Haltung geht sie auf den Stuhl vor dem Richtertisch zu.
Die Lehne mit beiden Händen umklammernd, sieht sie auf die Männer, die sie nun schon seit Stunden quälen. Atemlose Spannung liegt über dem Raum.
Ina Cornelius sieht ergreifend schön aus. Ein schlichtes Samtkleid, als einzigen Schmuck eine weiße Blende um den Halsausschnitt, umschließt knapp den Körper, von dem Bildhauer behauptet haben, er sei es wert, in Stein festgehalten zu werden.
Sie ist blaß. Die Augen dunkel umrändert, übergroß, beherrschen das zarte Antlitz.
In der Stimme des Vorsitzenden liegt deutlich Ironie.
»Angeklagte, behaupten Sie immer noch, daß Ihr Mann lebt?«
Ina Cornelius’ Stimme ist dunkel und voll wie der schwingende Ton einer Glocke.
»Ja. Ich weiß, daß mein Mann lebt«, sagt sie bestimmt.
Raunen geht durch die Menge, es steigt an und sinkt wieder zu Stille herab, als der Vorsitzende eine unwillige Bewegung nach dem Zuhörerraum hin macht.
»Erzählen Sie uns doch kein Märchen«, sagt er ungehalten. »Einwandfreie Zeugen haben den Toten als Ihren Gatten identifiziert. In der Voruntersuchung wurden alle Beweise gegen Sie zusammengetragen.
Sie haben nichts getan, um Ihre Unschuld zu beweisen. Sie behaupten nur immer, Ihr Gatte lebe. Warum meldet er sich nicht?
Sie halten uns zum Narren, Ina Cornelius.« Er beugt sich über den Tisch und spöttelt unnachgiebig: »Ich will es Ihnen sagen. Er kann sich nicht melden, weil er nicht mehr lebt.«
War sie jetzt von einer bewunderungswürdigen Ruhe, wird sie unruhig, nervös und reibt die Hände hilflos gegeneinander.
Der Vorsitzende fährt fort: »Auch ein Freund Ihres Hauses, Herr Dr. Vierstett, ist bereit, unter Eid auszusagen, daß der Tote der Ingenieur Dr. Peter Cornelius ist. Wie erklären Sie sich das?«
Für den Bruchteil einer Sekunde irrt ihr Blick hinüber auf die Zeugenbank zu Dr. Vierstett. Ina fröstelt. Dann blickt sie zu dem Vorsitzenden auf.
»Wenn Herr Dr. Vierstett bereit ist, seine Aussagen zu beeiden, dann schwört er einen Meineid.«
Wieder erhebt sich Stimmengewirr. Kommt jetzt die erwartete Sensation?
Ruhig fragt der Vorsitzende weiter.
»Herr Dr. Vierstett war ein Freund Ihres Hauses. Wollen Sie uns erklären, weshalb er Ihnen wohl Schaden zufügen sollte?«
Ohne Zögern kommt die Antwort.
»Dr. Rudolf Vierstett will sich an mir rächen.«
Kaum ist es gesagt, preßt sie die Lippen zusammen und schließt vorübergehend die Augen. Es ist ihr widerlich, etwas preisgegeben zu haben, was nur ihre Person angeht. Aber sie fühlt, jetzt darf sie sich nicht wieder in Schweigen hüllen. Nun muß sie weitersprechen, und der Vorsitzende nimmt auch gleich seine Chance wahr.
»Angeklagte, Sie sprechen von Rachegefühlen. Können Sie diese motivieren?«
Ina Cornelius legt den Kopf ein wenig in den Nacken. Nicht einen Blick wirft sie in die Richtung, wo Dr. Vierstett, ein Mann von interessantem Aussehen, sitzt und von dem sie genau weiß, daß er sie haßt. Die Beine hat er übereinandergeschlagen, und die Augen in die Luft gerichtet, als würde ihn das alles nicht berühren. Selbst jetzt, da er angegriffen wird, zeigt er verblüffende Gelassenheit.
»Ja«, spricht Ina Cornelius ruhig, nachdem sie ihre anfängliche Scheu überwunden hat. »Dr. Vierstett wurde von mir abgewiesen, nachdem er mich allzu aufdringlich mit seinen Liebesanträgen verfolgte. Er wurde immer lästiger. Meinem Mann habe ich das alles verschwiegen, ich wollte ihn nicht beunruhigen. Einmal hat Vierstett sogar versucht, mir Gewalt anzutun. Da habe ich ihn geschlagen, mitten ins Gesicht. Wenn er heute gegen mich aussagt, dann ist das die Antwort auf meinen Schlag.«
Ina Cornelius bedeckt die Augen mit der Hand. Die Erinnerung hat sie überwältigt, der Ekel gepackt.
Totenstille herrscht im Saal. Die Blicke wandern von der Frau zu dem Mann, den sie anklagt.
»Dr. Vierstett, bitte«, fordert der Vorsitzende zum Näherkommen auf. »Was haben Sie dazu zu sagen?«
Vierstetts Stimme ist ohne jede Erregung.
»Frau Cornelius hat eine rege Phantasie. Was sie erzählt, ist gelogen.«
»Nein! Nein!« ruft Ina Cornelius erregt dazwischen. »Ich lüge nicht. Ich sage die Wahrheit.«
Tumult erhebt sich im Saal. Keiner achtet auf das kleine Intermezzo am Saaleingang, der von zwei Hütern der Ordnung bewacht wird. Erst als eine sonore, durchdringende Stimme sich erhebt und die anderen verstummen läßt, richtet die Aufmerksamkeit der Anwesenden sich auf den Mann im Ledermantel, der mit imponierender Ruhe in die Totenstille ruft: »Ina Cornelius lügt nicht. Ich bin Peter Cornelius!«
Nur die Schritte sind hörbar, mit denen Peter Cornelius den Richtertisch erreicht.
»Peter!« Ein Aufschrei durchbricht die Stille.
»Ina!«
Peter Cornelius fängt die geliebte Frau in seinen Armen auf, spürt aber gleichzeitig, daß er eine Ohnmächtige umfangen hält. Hilflos schaut er sich um. Da springt schon Dr. Merz hinzu.
Ohrenbetäubender Lärm erhebt sich. Rufe werden laut! Schimpfworte wirbeln durcheinander.
Die Männer am Richtertisch tuscheln eifrig und ratlos miteinander.
Der Vorsitzende versucht sich durchzusetzen. Aber seine Glocke verschafft sich erst nach minutenlangem Läuten Geltung. Seine Stimme hat allen Klang verloren.
»Die Verhandlung wird unterbrochen. Der Zuschauerraum ist zu räumen.«
*
In des Gatten Arm gebettet, liegt Ina Cornelius in einem Zimmer des Hotels »Allicance«, wohin man sie nach den Aufregungen schnell gebracht hat.
Sie hat die Augen zur Decke gerichtet, und die Arme an den Körper gepreßt. Eigenartige Geräusche schwirren ihr durch den Kopf. Noch sieht sie sich im Mittelpunkt einer sensationshungrigen Menge. Dann wieder verwischen sich die Laute und eine beängstigende Stille umgibt sie, unterbrochen durch Schritte, die sich nahen. Schlüssel hört sie rasseln, und sie muß laufen, immerzu laufen, und dann dringen Stimmen auf sie ein: »Du lügst! Ina Cornelius, du lügst!«
»Nein! Nein!« schreit sie gequält auf, und der Gatte nimmt sie fest an sein Herz. Keinen Blick läßt er von dem zarten Antlitz, auf dem sich die Erlebnisse der letzten Wochen widerspiegeln.
»Ina, Liebes. Alles ist vorbei«, beschwichtigt er sie liebevoll und streichelt sanft über Wangen und Haar der geliebten Frau. »Keiner darf dich mehr quälen. Ich bin bei dir. Alles ist gut. Du bist frei.«
Wie ein Kind kuschelt sie sich fester an ihn. Sie schaut ihn groß an, und dann schließt sie die dunklen Augen, lächelt weich und hingebend.
»Alles ist gut«, wiederholt sie flüsternd. Cornelius rührt sich nicht. Als ihre gleichmäßigen Atemzüge verraten, daß sie eingeschlummert ist, zieht er vorsichtig seinen Arm unter ihrem Rücken hervor und erhebt sich.
Die Stimme dämpfend, wendet er sich an Dr. Merz, der im Hintergrund gesessen hat und jetzt naher kommt.