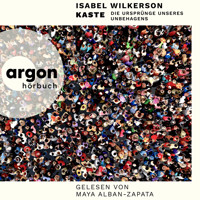Isabel Wilkerson
Kaste
Die Ursprünge unseres Unbehagens
Aus dem Amerikanischen vonJan Wilm
Im Gedenken an meine Eltern, die das Kastensystem überlebt haben, und im Gedenken an Brett, der sich ihm widersetzt hat
»Ich bin oft genug in die Keller von Polizeiwachen geschleift worden, und ich habe Geheimnisse verzweifelter weißer Männer und Frauen gesehen, gehört und ertragen, die sie bei mir gut aufgehoben wussten, weil mir ohnehin niemand glauben würde. Sie würden mir nicht glauben, weil sie wüssten, dass ich die Wahrheit sage.«
James Baldwin, Nach der Flut das Feuer
»Würde die Mehrheit die Wurzel dieses Übels kennen, wäre der Weg zu seiner Beseitigung nicht weit.«
Albert Einstein, Rede an die Urban National League1
INHALT
Der Mann in der Menge
TEIL EINSToxine im Permafrost und ringsum steigende Hitze
1 Das Nachleben von Krankheitserregern
Die Vitalfunktionen der Geschichte
2 Ein altes Haus und ein Infrarotlicht
3 Ein US-amerikanischer Unberührbarer
Ein unsichtbares Programm
TEIL ZWEIDie willkürliche Konstruktion menschlicher Unterscheidung
4 Ein endlos aufgeführtes Theaterstück und die Entstehung der Kaste in den USA
5 »Die Form, die wir für euch vorgesehen haben«
6 Das Maß der Menschlichkeit
7 Durch den Nebel Delhis zu den Parallelen zwischen Indien und den USA
8 Die Nazis und die Intensivierung des Kastenwesens
9 Die Bösartigkeit des Schweigens
TEIL DREIDie acht Säulen der Kaste
Die Grundlagen der KasteDie Ursprünge unseres Unbehagens
1. SÄULE Der göttliche Wille und die Naturgesetze
2. SÄULE Vererbbarkeit
3. SÄULE Endogamie und die Reglementierung von Heirat und Geschlechtsverkehr
4. SÄULE Reinheit versus Verunreinigung
5. SÄULE Berufliche Hierarchie: Die Jatis und die Schlammschwelle
6. SÄULE Entmenschlichung und Stigma
7. SÄULE Terror als Vollstreckung, Grausamkeit als Mittel der Kontrolle
8. SÄULE Angeborene Überlegenheit versus angeborene Unterlegenheit
TEIL VIERDie Tentakel der Kaste
Braune Augen versus blaue Augen
10 Zentrale Fehlbesetzung
11 Bedrohung des Status der dominanten Gruppe und die Prekarität der höchsten Stufe
12 Ein Sündenbock für die Vergehen der Welt
13 Das unsichere Alphatier und der Zweck eines Underdogs
14 Wie Kaste ins Alltagsleben eindringt
15 Die dringende Notwendigkeit einer unteren Stufe
16 Die Angst vor dem letzten Platz: eingekerkert in einem überfluteten Keller
17 An den frühen Frontlinien der Kaste
18 Satchel Paige und die Unlogik der Kaste
TEIL FÜNFDie Konsequenzen der Kaste
19 Die Euphorie des Hasses
20 Der zwangsläufige Narzissmus der Kaste
21 Das deutsche Mädchen mit dem dunklen gewellten Haar
22 Das Stockholm-Syndrom und der Fortbestand der untergeordneten Kaste
23 Stoßtruppen an den Grenzen der Hierarchie
24 Cortisol, Telomere und die Letalität der Kaste
SECHSTER TEILGegenbewegungen
25 Eine Änderung des Drehbuchs
26 Wendepunkt und Wiederaufleben der Kaste
27 Die Symbole der Kaste
28 Demokratie auf dem Stimmzettel
29 Der Preis, den wir für ein Kastensystem zahlen
TEIL SIEBENDas Erwachen
30 Die heilige Schnur abwerfen
Die Radikalisierung der herrschenden Kaste
31 Das Herz ist die letzte Grenze
EPILOGEine Welt ohne Kaste
DANK
ANMERKUNGEN
LITERATUR
Der Mann in der Menge
Es existiert eine berühmte Schwarz-Weiß-Fotografie aus der Zeit des Dritten Reichs. Es handelt sich um ein Bild, das 1936 in Hamburg aufgenommen wurde und hundert oder mehr Werftarbeiter zeigt, die im Glast der Sonne in dieselbe Richtung blicken. Den rechten Arm starr ausgestreckt, führen sie vereint den Hitlergruß aus, um ihre Führertreue zu demonstrieren.
Wenn man genau hinsieht, kann man oben rechts auf dem Bild einen Mann erkennen, der sich von denanderen abhebt. Sein Gesicht ist sanft, aber unnachgiebig. Auf heutigen Versionen des Fotos ist oft ein roter Kreis um den Mann herumgezogen – oder es deutet ein Pfeil auf ihn. Der Mann ist umgeben von Mitbürgern, die im Bann der Nazis stehen. Er hält die Arme vor der Brust verschränkt, während die steifen Handflächen der anderen nur Zentimeter von ihm entfernt in der Luft schweben. Er allein verweigert den Hitlergruß. Er ist der einzige Mann, der gegen den Strom schwimmt.
Aus unserer heutigen Sicht ist er der einzige Mensch in der Menge, der auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Alle um ihn herum liegen tragisch, verhängnisvoll, kategorisch falsch. In diesem Moment war er alsEinziger in der Lage, dies zu erkennen.
Man vermutet, sein Name war August Landmesser. Damals konnte er nicht ahnen, welch mörderischen Weg die Hysterie um ihn herum einschlagen würde. Doch er hatte längst genug gesehen, um diesen Weg abzulehnen. Jahre zuvor war er selbst in die NSDAP eingetreten. Inzwischen wusste er jedoch aus erster Hand, dass die Nazis die Deutschen mit Lügen über jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Ausgestoßenen der damaligen Zeit, mästeten, dass die Nazis selbst in dieser frühen Phase des Reichs bereits Terror, seelische Qualen und Zerrüttung verursacht hatten. Er wusste, dass jüdische Menschen alles andere als Untermenschen waren, dass sie deutsche Bürgerinnen und Bürger waren, Menschen wie alle anderen auch. Er war ein Arier, der in eine Jüdin verliebt war, doch die kürzlich erlassenen Nürnberger Rassengesetze hatten ihre Beziehung illegalisiert. Es war ihnen untersagt, zu heiraten oder eine sexuelle Beziehung zu führen, was die Nazis als »Blutschande« bezeichneten.2
Seine persönlichen Erfahrungen und seine enge Verbindung zur Kaste der Sündenböcke erlaubten ihm, die Stereotypeund die Lügenzu durchschauen, die von anfälligen Mitgliedern – bedauerlicherweise der Mehrheit – der herrschenden Kaste so bereitwillig übernommen wurden. Obwohl er selbst Arier war, hatte er durch seine Offenheit für die Menschlichkeit derjenigen, die als unter seiner Würde angesehen wurden, ein Interesse an ihrem Wohlergehen, denn ihr Schicksal war mit dem seinen verbunden. Er sah, was seine Landsleute nicht sehen wollten.
In einem totalitären Regime wie dem Dritten Reich war es ein Akt der Tapferkeit, gegen einen ganzen reißenden Fluss anzuschwimmen. Wir alle möchtenglauben, dass wir wie er gewesen wären. Wir könnten uns glauben machen, dass wir, wenn wir arische Bürgerinnen und Bürger im Dritten Reich gewesen wären, sicher alles durchschaut hätten, dass wir uns wie er darüber erhoben hätten, dass wir diejenigen gewesen wären, die dem Autoritarismus und der Brutalität bei aller Massenhysterie dennoch widerstanden hätten.
Wir möchten nur zu gerne glauben, dass wir den schwierigeren Weg des Widerstands gegen die Ungerechtigkeit zur Verteidigung der Ausgestoßenen eingeschlagen hätten. Doch wenn die Menschen nicht bereit sind, ihre Ängste zu überwinden, Unannehmlichkeiten und Spott über sich ergehen zu lassen, die Verachtung von Angehörigen, Nachbarinnen, Kollegen und Freundinnen zu erleiden und bei vielleicht allen, die sie kennen, in Ungnade zu fallen, mit Ausgrenzung und sogar Verbannung konfrontiert zu werden, dann ist es für jeden Menschen statistisch unmöglich, menschlich unmöglich, dieser Mann zu sein. Was bräuchte es, zu diesem Mann zu werden, ganz gleich, zu welcher Zeit? Was bräuchte es heute, dieser Mann zu sein?
TEIL EINS
TOXINE IM PERMAFROST UND RINGSUM STEIGENDE HITZE
1
Das Nachleben von Krankheitserregern
Im gespenstischen Sommer von 2016 rollte eine ungewöhnliche Hitzewelle über die sibirische Tundra hinweg, gerade an den Grenzen dessen, was man einst »das Ende der Welt« nannte. Oberhalb des Polarkreises und weit entfernt von den tektonischen Platten, die in der amerikanischen Politik aufeinanderprallten, stieg die Temperatur unter der Erdoberfläche an, zusätzlich drückte die Hitze von oben auf die Erde, wobei die Luft auf der russischen Jamal-Halbinsel unvorstellbare 35 Grad Celsius erreichte. Waldbrände brachen aus und Methanblasen gurgelten unter dem gewöhnlich gefrorenen Boden der Polarregion. Bald erkrankten die Kinder der einheimischen Hirten an einer ihnen unbekannten Krankheit, die viele der Menschen sich nicht erklären konnten. Ein zwölfjähriger Junge bekam hohes Fieber und Magenschmerzen, dann verstarb er. Die russischen Behörden riefen den Notstand aus und begannen, Hunderte von erkrankten Kindern des Hirtenvolks der Nenzen in das nächstgelegene Krankenhaus in Salechard auszufliegen. Wissenschaftler fanden schließlich heraus, was die sibirischen Siedlungen befallen hatte. Die abnorme Hitze hatte sich viel tiefer als sonst in den russischen Permafrost hineingefressen und ein Giftgas freigesetzt, das seit 1941, während des letzten Weltkriegs, eingeschlossen gewesen war. Es handelte sich um einen Milzbranderreger, der vor Jahrzehnten ganze Rentierherden niedergerafft hatte und in den Tierkadavern verborgen lag, die tief im Permafrost schlummerten. In jenem Sommer war einer dieser verseuchten Kadaver an die Oberfläche gekommen, aufgetaut, und der Erreger war erwacht, geradeso intakt und kraftvoll wie eh und je.3 Die Sporen des Bakteriums verstreuten sich rasch über das Weideland, infizierten die Rentiere und sprangen auf die Hirten über, die die Tiere züchteten und von ihnen lebten. Der Milzbrand – wie die Reaktivierung der menschlichen Krankheitserreger des Hasses und des Tribalismus in diesem sich entspinnenden Jahrhundert – war niemals ausgestorben. Er hatte auf der Lauer gelegen, schlummernd, bis extreme Umstände ihn an die Oberfläche und zurück ins Leben beförderten.
Am anderen Ende der Erde war die älteste und mächtigste Demokratie der Menschheit in Aufruhr wegen einer Wahl, die die westliche Welt lähmen und zu einem psychischen Bruch in der Geschichte der USA führen würde, der wahrscheinlich über Generationen hinweg analysiert und seziert werden wird. In jenem Sommer und bis in den Herbst hinein sowie in den darauffolgenden Jahren waren inmitten des Geredes über Einreisebeschränkungen für muslimische Menschen, über nasty women, Grenzmauern und über die Bezeichnung von Ländern als »Dreckslöcher« immer wieder dieselben ungläubigen Rufe zu vernehmen: »Das sind nicht die Vereinigten Staaten«, »Ich erkenne mein Land nicht wieder« oder »Das ist nicht, wer wir sind.« Allein, dies war und ist unser Land, und das war und ist, wer wir sind, ob wir es nun wussten und begriffen oder nicht.
Die Temperatur stieg an – in der Arktis wie auch bei zufälligen Begegnungen in den USA. Im Spätsommer dieses Jahres war ein weißer Mann, ein Künstler in New York City, einem demokratischen Hafen in einem verlässlich blauen Bundesstaat, einer weißen Frau mittleren Alters in Brooklyn dabei behilflich, ihre Einkäufe in eine U-Bahn Richtung Coney Island zu tragen.
Damals war es unmöglich, Gesprächen über Politik aus dem Weg zu gehen. Es war ein Wahlkampf, wie es ihn noch nie zuvor gegeben hatte. Zum ersten Mal in der Geschichte kandidierte eine Frau für das Amt der Präsidentin der Vereinigten Staaten. Die Kandidatin war weitläufig bekannt, eine nüchterne und nach Einschätzung einiger Kommentatoren überqualifizierte nationale Persönlichkeit, konventionell und besonnen, wenn auch für ihre Kritiker wenig inspirierend, mit einem sicheren Gespür für jede Politik und jede Krise, mit der sie sich würde befassen müssen. Ihr Gegenkandidat war ein ungestümer Milliardär, ein Reality-TV-Star, der dazu neigte, jeden zu beleidigen, der sich von ihm selbst unterschied, ein Mann, der nie ein öffentliches Amt bekleidet hatte und dem Experten nicht den Hauch einer Chance einräumten, die Vorwahlen seiner Partei zu gewinnen, geschweige denn die Wahl zur Präsidentschaft.
Bevor der Wahlkampf beendet war, stellte der Kandidat der Kandidatin während einer Fernsehdebatte, die in alle Welt übertragen wurde, wie ein Stalker nach. Er prahlte damit, Frauen an den Genitalien zu berühren, machte sich über Menschen mit Behinderung lustig und rief zu Gewalt gegen die Presse und all diejenigen auf, die nicht seiner Meinung waren. Seine Anhängerinnen und Anhänger verhöhnten die Kandidatin und skandierten bei Massenkundgebungen, die der Milliardär anführte, sie solle verhaftet werden: »Lock her up!« Seine Äußerungen und Aktivitäten wurden als so derb empfunden, dass einigen Nachrichtenreportagen ein Warnhinweis für Erziehungsberechtigte vorangestellt wurde.4
Es handelte sich hier um einen Kandidaten, der »so offensichtlich nicht für den Job qualifiziert war«, schrieb der Guardian 2016, »dass seine Kandidatur eher wie ein böser Streich wirkte als eine ernsthafte Bewerbung um das Weiße Haus.«5
Oberflächlich betrachtet ging es nicht um das, was man in den USA gemeinhin als »race« bezeichnet. Sowohl die Kandidatin als auch der Kandidat waren weiß und gehörten der historisch dominanten Mehrheit des Landes an. Doch die Kandidatin vertrat die liberalere Partei, die sich aus einem Flickenteppich von Koalitionen zusammensetzte, die, grob gesagt, aus humanistisch gesinnten sowie marginalisierten Menschen bestanden. Der Kandidat vertrat die konservative Partei, die in den letzten Jahrzehnten als Behüterin einer alten Gesellschaftsordnung angesehen worden war und die vor allem die Interessen der weißen Wählenden vertrat.
Die beiden waren so unterschiedlich wie zwei Himmelspole, und sie wurden von den Anhängern des jeweils anderen Lagers gleichermaßen verabscheut. Die Extreme dieses Wahlkampfes zwangen die US-amerikanische Bevölkerung, sich für eine Seite zu entscheiden und entweder ihre Loyalität zu erklären oder einen Weg zu finden, um sie herumzutänzeln. Als der Künstler aus Brooklyn an einem ganz gewöhnlichen Tag der älteren Frau beim Einkaufen zur Hand ging, wandte sie sich unaufgefordert an ihn, um zu erfahren, wem er seine Stimme geben werde. Der Künstler, der progressiv gesinnt war, sagte, er habe vor, die Demokratin zu wählen, die erfahrenere Kandidatin. Die ältere Frau mit den Lebensmitteln muss dies bereits geahnt haben, und seine Antwort passte ihr nicht. Wie Millionen anderer US-Amerikanerinnen und -Amerikaner, die zur historisch dominanten Mehrheit gehören, hatte sie sich von den unverblümten Appellen des nativistischen Milliardärs bezirzen lassen.
Nur wenige Wochen zuvor hatte dieser gesagt, er könne jemanden auf der Fifth Avenue erschießen, und seine Anhänger würden ihn trotzdem wählen, derart ergeben seien sie ihm.6 Die mit Lebensmitteln überladene Frau war eine von ihnen. Im blauesten aller Blue States hatte sie seinen Ruf erhört und seine Botschaften verstanden. Sie nahm es auf sich, den Künstler auf den Irrtum seines Denkens hinzuweisen und ihn zu belehren, warum es dringend notwendig sei, dem Richtigen die Stimme zu geben.
»Ja, ich weiß, dass er manchmal eine große Klappe hat«, räumte sie ein und näherte sich ihrem potenziellen Konvertiten. »Aber er wird uns wieder mächtig machen in der Welt.«
Damals, noch vor den Debatten und den sich überschlagenden Enthüllungen, wurde dem Mann aus Brooklyn klar, dass ein Reality-TV-Star mit der geringsten Erfahrung von allen, die je für das Präsidentenamt kandidiert hatten, aller historischer Widrigkeiten und Schreckensbeispiele zum Trotz, der Führer der freien Welt werden könnte.
Der Wahlkampf war zu mehr als einer politischen Rivalität geworden – es war ein existenzielles Ringen um die Vorherrschaft in einem Land, dessen demografische Strukturen sich gewandelt hatten. Menschen, die wie der Künstler aus Brooklyn und die Dame auf dem Weg nach Coney Island aussahen, deren Vorfahren aus Europa stammten, gehörten seit der Gründung der Republik zur historischen Mehrheit, zur dominierenden ethnischen Kaste in einer unausgesprochenen Hierarchie. Doch in den Jahren, die diesem Moment vorausgegangen waren, hatte sich im Radio und im Kabelfernsehen herumgesprochen, dass der Anteil der weißen Bevölkerung schrumpft. Im Sommer 2008, hatte das U. S. Census Bureau, das Volkszählungsamt, die Prognose ausgegeben, dass ab 2042 erstmals in der Geschichte der USA die Weißen nicht mehr die Mehrheit in einem Land bilden würden, das nie eine andere Konstellation gekannt hatte.7
Anschließend war im Herbst desselben Jahres, inmitten einer verheerend anmutenden Finanzkrise und wie um einen möglichen Niedergang der lange Zeit dominanten Kaste anzukündigen, ein Schwarzer, ein Mann aus der historisch untersten Kaste, zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden. Sein Aufstieg löste sowohl verfrühte Verkündungen einer Welt ohne Segregation als auch eine ganze Protestbewegung aus, die ihren einzigen Zweck darin sah, zu beweisen, dass der Präsident nicht in den USA geboren worden war, eine Kampagne, die von ebenjenem Milliardär angeführt wurde, der 2016 selbst für das Präsidentenamt kandidierte.
Unter der Oberfläche war also ein leises Grollen zu vernehmen, Neuronen, die erregt waren durch die Aussicht auf einen gerechten Kämpfer für die dominante Kaste, ein Sprachrohr für ihre Ängste. Einige Leute sahen sich dadurch ermutigt. Ein Polizeichef in South New Jersey sprach davon, Schwarze »niederzumähen«, und beklagte sich darüber, dass die Kandidatin der Demokraten sich »allen Minderheiten beugen« würde. In jenem September schlug dieser Mann auf einen Schwarzen Teenager in Handschellen ein; man hatte den Jungen festgenommen, weil er unerlaubt in einem Pool geschwommen war. Der Polizist packte ihn am Kopf und rammte ihn laut Zeugenaussagen »wie einen Basketball« gegen einen Türpfosten aus Metall. Als die Präsidentenwahl näher rückte, sagte der Polizeichef zu seinen Beamten, der Reality-TV-Star sei »die letzte Hoffnung der Weißen.«8
Auf der ganzen Welt begriffen die Menschen die Tragweite dieser Wahl. Zuschauende in Berlin und Johannesburg, Delhi und Moskau, Peking und Tokio blieben bis spät in die Nacht oder bis zum nächsten Morgen vor ihren Fernsehern sitzen, um die Wahlergebnisse an diesem ersten Dienstag im November des Jahres 2016 zu verfolgen. Für viele außerhalb der USA war es unerklärlich, dass der Ausgang der Wahl nicht von der einfachen Mehrheit der Wählerstimmen abhing, sondern von den Wahlleuten im Electoral College, einer amerikanischen Erfindung aus der Gründungszeit der Sklaverei, nach der jeder Bundesstaat ein eigenes Mitspracherecht bei der Wahl des Präsidenten hat, basierend auf den Stimmen der jeweiligen Wahlleute sowie dem Ergebnis der gesamten Direktstimmen des bundesstaatlichen Wahlkreises.9
Bis dahin hatte es in der Geschichte des Landes nur fünf Wahlen gegeben, bei denen das Wahlleute-Kollegium oder ein ähnlich undurchsichtiger Teil des politischen Apparats die Entscheidung des Volkes überstimmt hatte, zwei davon im 21. Jahrhundert. Einer dieser beiden Fälle war die Wahl von 2016, eine Kollision ungewöhnlicher Umstände.10
Die Vereinigten Staaten sollten einen Kurs einschlagen in Richtung Isolationismus, Stammesdenken, Abschottung und Protektionismus, Anbetung von Reichtum sowie Raffgier auf Kosten anderer und sogar des Planeten selbst. Nachdem die Stimmen ausgezählt waren und der Milliardär zum Sieger erklärt worden war, konnte sich ein Mann auf einem Golfplatz in Georgia zum Entsetzen der Welt und derjenigen, die vielleicht weniger tief in die ethnische und politische Geschichte des Landes eingeweiht waren, freier fühlen, sich zu äußern. Der Mann war ein Sohn der Konföderierten Staaten von Amerika, die gegen die Vereinigten Staaten und für das Recht auf Versklavung anderer Menschen in den Bürgerkrieg gezogen waren.
Die Wahl war ein Sieg für ihn und für die Gesellschaftsordnung, in die er hineingeboren worden war. Zu den Menschen, die ihn umgaben, sagte er: »Ich erinnere mich an eine Zeit, in der jeder wusste, wo er hingehörte. Höchste Zeit, dass wir dorthin zurückkehren.«
Das Gefühl, zur alten Ordnung und zur rechtmäßigen Hierarchie der Vorfahren zurückzukehren, verbreitete sich bald im ganzen Land in einer schlagzeilenträchtigen Welle aus Hassverbrechen und Massengewalt. Kurz nach dem Tag der Amtseinführung tötete ein weißer Mann in Kansas einen indischen Ingenieur und forderte einen seiner indischen Kollegen auf, sein »Land zu verlassen«, als er auf sie schoss. Einen Monat später setzte sich ein weißer US-Army-Veteran mit dem erklärten Ziel, Schwarze zu töten, in einen Bus von Baltimore nach New York. Am Times Square verfolgte er einen 66-jährigen Schwarzen und erstach ihn mit einem Schwert. Er sollte der erste Anhänger der »White Supremacy« werden, der im Bundesstaat New York wegen Terrorismus verurteilt wurde.
In einem überfüllten Pendlerzug in Portland, Oregon, gab ein weißer Mann rassistische, antimuslimische Beleidigungen von sich und griff zwei Teenagerinnen an, von denen eine einen Hidschab trug. »Verpisst euch verdammt nochmal«, schimpfte er. »Wir wollen hier Amerikaner.« Als drei weiße Männer die jungen Frauen verteidigten, stach der Angreifer auf die Männer ein. »Ich bin Patriot«, sagte der Angreifer der Polizei auf dem Weg ins Gefängnis, »und ich hoffe, dass jeder, den ich niedergestochen habe, tot ist.« Tragischerweise überlebten zwei der Männer ihre Verletzungen nicht. Im folgenden Sommer waren die Augen der Weltöffentlichkeit auf eine Auseinandersetzung um Denkmäler der Konföderierten Staaten in Charlottesville, Virginia gerichtet. Während einer Demonstration gegen den Hass raste ein weißer Mann mit seinem Wagen in eine Menschenmenge und tötete eine junge weiße Frau namens Heather Heyer.
Was Massenerschießungen betrifft, wurde 2017 zum bisher tödlichsten Jahr der jüngeren amerikanischen Geschichte. In Las Vegas ereignete sich das landesweit größte Massaker dieser Art, gefolgt von einer Massenerschießung nach der anderen an öffentlichen Schulen, auf Parkplätzen, auf den Straßen der Großstädte und in Supermärkten im ganzen Land. Im Herbst 2018 wurden bei dem schlimmsten antisemitischen Angriff auf US-amerikanischem Boden elf Menschen in einer Synagoge in Pittsburgh ermordet. Außerhalb von Louisville in Kentucky versuchte ein Mann, einen ähnlichen Angriff auf eine Kirche Schwarzer Gläubiger auszuüben, indem er an den verschlossenen Türen rüttelte, um einzubrechen und Mitglieder der Gemeinde während ihrer Bibelstunde zu erschießen. Da es ihm nicht gelang, die Türen aufzubrechen, ging der Mann zu einem nahegelegenen Supermarkt und tötete die ersten Schwarzen Menschen, die er sah – eine Schwarze Frau auf dem Parkplatz, die Lebensmittel einkaufen wollte, und einen Schwarzen Mann, der mit seinem Enkel Plakatkarton kaufte. In den Nachrichten hieß es, ein bewaffneter Passant habe den Schützen zufällig auf dem Parkplatz gesehen, was die Aufmerksamkeit des Täters erregt habe. »Nicht schießen«, soll der Passant gesagt haben, »dann schieße ich auch nicht. Weiße töten keine Weißen.«
In den darauffolgenden Monaten, als der neue Präsident internationale Abkommen aufkündigte und Diktatoren umgarnte, fürchteten viele Beobachtende das Ende der Republik. Im Alleingang trat der neue Staatschef der ältesten Demokratie der Welt aus dem Pariser Abkommen aus, dem zufolge sich die Nationen der Welt im Kampf gegen den Klimawandel zusammengeschlossen hatten, und sein Handeln ließ viele in tiefe Sorge über einen bereits verlorenen Wettlauf zum Schutz des Planeten verfallen.
Schon bald ging eine Gruppe führender Psychiaterinnen und Psychiater, die von Berufs wegen nur dann über ihre Diagnosen sprechen dürfen, wenn ein Mensch eine Gefahr für sich selbst oder seine Umwelt darstellt, den außergewöhnlichen Schritt, die US-amerikanische Öffentlichkeit davor zu warnen, dass der neu gewählte Führer der freien Welt ein bösartiger Narziss und eine Gefahr für die Öffentlichkeit sei. Im zweiten Jahr der Regierung saßen Kinder von Eingewanderten an der südlichen Landesgrenze hinter Gittern, getrennt von ihren Eltern, während sie um Asyl baten. Jahrzehntealte Gesetze zum Schutz für Luft, Wasser und gefährdete Arten wurden kurzerhand gekippt. Mehrere Wahlkampfberater wurden im Zuge von sich ausweitenden Korruptionsermittlungen zu Haftstrafen verurteilt, und der amtierende Präsident wurde als Agent einer ausländischen Macht bezeichnet.
Die Oppositionspartei hatte alle drei Zweige der Regierung verloren und zerbrach sich den Kopf darüber, wie sie handeln könnte. Es gelang ihr zwar, 2018 das Repräsentantenhaus zurückzuerobern, doch damit verfügte die Partei dennoch nur über ein Sechstel der Regierung – also die Hälfte der Legislative –, und deshalb zögerte sie zunächst, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten, das in ihre Zuständigkeit fiel. Viele befürchteten eine Gegenreaktion, sie hatten Angst, die Basis des Milliardärs zu erzürnen, die zwar eine Minderheit der Wählenden darstellte, aber überwiegend aus Menschen der herrschenden Kaste bestand.
Die Unbeirrbarkeit der Anhänger des Präsidenten und die Verzweiflung der Opposition schienen das System der Checks and Balances zur gegenseitigen Kontrolle aller Gewalten des Staats, von dem man ausging, es sei unverbrüchlich im Fundament der Nation verankert, zu kompromittieren, mit der Folge, dass die USA mit den Worten eines Vorsitzenden der Demokratischen Partei in South Carolina, eine Zeit lang drohten, »keine voll funktionsfähige Demokratie« mehr zu sein.11
Zu Beginn des dritten Amtsjahres wurde von den Gegnern des Präsidenten im Unterhaus ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet. Die Loyalisten im Senat sprachen ihn frei, wobei die Stimmverteilung entlang von Parteigrenzen verlief und die Spannungen im ganzen Land widerspiegelte. Es war erst das dritte Amtsenthebungsverfahren dieser Art in der Geschichte des Landes.12 Inzwischen waren mehr als 300 Tage ohne ein Pressebriefing des Weißen Hauses vergangen – ein Washingtoner Ritual der Rechenschaftspflicht. Es war so sang- und klanglos verschwunden, dass nur ein geringer Teil der Bevölkerung diesen zusätzlichen Bruch der Normalität zu bemerken schien.13
Dann brachte die schlimmste Pandemie seit mehr als einem Jahrhundert die Menschheit zum Stillstand. Der Präsident tat die Ursache als chinesisches Virus ab, das wie ein Wunder verschwinden würde, bezeichnete die wachsende Unruhe im Land als Schwindel, der von den Medien kolportiert worden sei, und verunglimpfte alle, die anderer Meinung waren oder ihn zu warnen versuchten. Innerhalb weniger Wochen verbuchten die Vereinigten Staaten die höchsten Fallzahlen auf dem Globus, Gouverneure baten inständig um Tests und Beatmungsgeräte, Krankenschwestern wickelten sich in Müllsäcke, um sich vor Ansteckung zu schützen, während sie die Erkrankten versorgten. Das Land verlor die Fähigkeit, schockiert zu sein; das Unfassbare wurde zu einem Teil des Alltags.
Was war mit den USA geschehen? Was könnte der Grund dafür sein, dass Millionen von Wählenden sich dafür entschieden hatten, gegen alle Gewohnheit das Land in die Hände einer unerfahrenen Person zu legen, die weder im Krieg noch in einem öffentlichen Amt gedient hatte und deren Rhetorik ein gefundenes Fressen für Extremisten zu sein schien?14 Waren es die Menschen im Landesinneren gewesen, die sich gegen die Eliten an den Küsten auflehnten? Waren die Angestellten im Bergbau und in der Autoindustrie in einer stagnierenden Wirtschaft unruhig geworden? War ein Teil der Wählerschaft einfach bereit für einen Wechsel? War es wirklich wahr, dass die Frau im Rennen um die Präsidentschaft – die erste, die es in greifbare Nähe des höchsten Amts der Nation geschafft hatte – einen »heillosen Schlamassel« von einer Kampagne geführt hatte, wie es zwei altgediente Politikjournalisten ausdrückten?15 Lag es daran, dass die sogenannten »urban voters«, sprich die Schwarzen Wähler, nicht zur Wahl gegangen waren, die evangelikalen – also die weißen – Wähler jedoch schon? Wie konnten so viele Menschen, einfache Angestellte, die auf Krankenversicherung und Bildung für ihre Kinder, auf den Schutz des Wassers, das sie trinken, und der Löhne, die sie ernähren, angewiesen sind, »gegen ihre eigenen Interessen stimmen«, wie zahlreiche Progressive während dieses Wendepunkts in der politischen Geschichte zu sagen pflegten? So lauteten einige der beliebtesten Fragen und Mutmaßungen in der Folgezeit, und an einigen mag durchaus etwas Wahres dran gewesen sein.
Es hatte den Anschein, der Boden unter unseren Füßen hätte sich über Nacht verschoben. Seit Langem haben wir Erdbeben als Folge der Kollision tektonischer Platten definiert, bei der eine Erdebene unter die andere gekeilt wird, und wir glaubten, dass das innere Ringen unter der Erdoberfläche nur allzu leicht zu erkennen sei. Bei klassischen Erdbeben spüren wir, wie der Boden unter uns erzittert und knackt, wir erkennen die Verwüstung der Landschaften oder die darauffolgenden Tsunamis.
Die Wissenschaft hat erst vor Kurzem entdeckt, dass den bekannteren Erdbeben, die leicht zu messen sind, während sie sich ereignen und deren Zerstörung unmittelbar eintritt, häufig längere, langsame, katastrophale Erschütterungen vorausgehen, die zwanzig Meilen oder mehr unter uns rumpeln, so tief, dass wir sie nicht spüren. Weil sie in der Stille wirkten, blieben sie so lange unentdeckt, bis sich ein großes Beben an der Oberfläche ankündigte. Erst seit Kurzem verfügt die Geophysik über eine Technologie, die empfindlich genug ist, um diese unsichtbaren tiefergelegenen Erschütterungen im Erdkern zu messen. Man bezeichnet diese Erschütterungen als stille Erdbeben. Und erst vor Kurzem haben uns die Umstände in dieser Ära der menschlichen Zerrissenheit dazu gezwungen, auch nach den unsichtbaren Erschütterungen des menschlichen Herzens zu suchen, um die Ursprünge unseres Unbehagens zu erkunden.
Zum Zeitpunkt jener schicksalhaften US-Wahl versuchten sich die Menschen in Sibirien, am nördlichsten Ende der Welt, von der Hitze zu erholen, die sie Monate zuvor heimgesucht hatte. Dutzende der einheimischen Hirtenvölker waren umgesiedelt worden, einige standen unter Quarantäne, und ihre Zelte mussten desinfiziert werden. Die Behörden begannen mit Massenimpfungen der überlebenden Rentiere und ihrer Hirten. Man hatte jahrelang auf Impfungen verzichtet, da der letzte Ausbruch schon Jahrzehnte zurücklag und man der Meinung war, das Problem gehöre der Vergangenheit an. »Offenbar ein Fehler«, sagte ein russischer Biologe gegenüber einer Nachrichtenseite.16 Das Militär musste abwägen, wie die zweitausend toten Rentiere am besten zu entsorgen waren, um eine Verbreitung der Sporen zu verhindern.17 Zur Auslöschung des Erregers genügte es nicht, die Kadaver bloß zu vergraben. Man musste sie auf Feldern bei bis zu 500 Grad Celsius verbrennen und anschließend die Asche sowie das umliegende Land mit Bleichmittel behandeln, um die Sporen abzutöten und die Bevölkerung zu schützen.18
Vor allem aber – und für die Menschheit insgesamt noch viel beunruhigender – lautete die Botschaft des Jahres 2016 und des ausklingenden zweiten Jahrzehnts des noch jungen Jahrtausends: dass die zunehmende Hitze in den Ozeanen der Erde und im Herzen der Menschen lange verschüttete Bedrohungen wieder aufleben lassen könnte; dass einige Krankheitserreger niemals ausgerottet, sondern nur eingedämmt werden und vielleicht bestenfalls mit immer besseren Impfstoffen gegen ihre zu erwartenden Mutationen kontrolliert werden können.
Was die Menschheit gelernt hat, ist hoffentlich, dass ein uraltes und widerstandsfähiges Virus vielleicht eines mehr als alles andere erfordert: das Wissen um seine allgegenwärtige Gefahr, die Vorsicht zum Schutz vor Ansteckung und die Wachsamkeit gegenüber seiner Langlebigkeit, seiner Fähigkeit, zu überwintern, zu mutieren und zu überleben, bis das Pathogen wieder zum Leben erwacht. Es schien so, als könnten diese Infektionskrankheiten nicht vernichtet werden, jedenfalls noch nicht; sie konnten nur kontrolliert und antizipiert werden, und wie bei jedem Virus waren Voraussicht und Umsicht, die Weisheit, diese Krankheiten niemals nur als gegeben zu erachten und ihre Langlebigkeit niemals zu unterschätzen, vielleicht die wirksamsten Gegenmittel, zumindest bis auf Weiteres.
Die Vitalfunktionen der Geschichte
Wenn wir uns einer ärztlichen Behandlung unterziehen, beginnt der Arzt oder die Ärztin nicht mit der Behandlung, ohne unsere Krankengeschichte aufzunehmen – und nicht nur unsere eigene, sondern auch die unserer Eltern und Großeltern. Die Ärztin untersucht uns erst, wenn wir viele Formularseiten ausgefüllt haben, die uns bei der Ankunft ausgehändigt werden. Die Ärztin stellt erst dann eine Diagnose, wenn sie die Vorgeschichte kennt, die über Generationen zurückreicht.
Während wir die Formularseiten zu unserer medizinischen Vergangenheit und unseren aktuellen Beschwerden ausfüllen – wessen unser Körper ausgesetzt war und was er überstandenhat –, hilft es uns nicht, bestimmte Beschwerden zu verheimlichen, oder die volle Wahrheit darüber zu leugnen, warum wir hier sind. Kein Problem wurde je dadurch gelöst, dass man es ignoriert hat.
Auf Entdeckungen in den tieferliegenden Ebenen der Geschichte des eigenen Landes zu stoßen, ähnelt der Feststellung, dass in der eigenen Familie Alkoholismus oder Depressionen existieren, dass Selbstmord häufiger als gewöhnlich vorkommt oder dass man durch die Fortschritte der medizinischen Genetik entdeckt, dass man die Marker einer BRCA-Mutation für Brustkrebs geerbt hat. Man steckt nicht den Kopf in den Sand, weil man sich schämt oder schuldig fühlt für diese Entdeckungen. Und wenn man klug ist, verbietet man sich auch nicht, darüber zu sprechen. Man tut das Gegenteil, man informiert sich. Man spricht mit Menschen, die dasselbe durchgemacht haben, und mit Spezialistinnen, die auf dem Gebiet forschen. Man lernt die Folgen und Widrigkeiten und die Möglichkeiten der Behandlung kennen. Man kann beten oder meditieren. Dann trifft man Vorkehrungen, um sich selbst und die nachfolgenden Generationen zu schützen, und setzt sich dafür ein, dass sich diese Dinge, was immer sie auch sind, nicht wiederholen.
2
Ein altes Haus und ein Infrarotlicht
Der Bauaufseher zielte mit seinem Infrarotobjektiv auf einen unförmigen Bogen in der Decke, ein unsichtbarer Lichtstrahl suchte die Schichten von Putzträgern ab, um zu untersuchen, was dem bloßen Auge verborgen blieb. Dieses Haus war vor Generationen gebaut worden, und ich hatte eine kleine Beule in einer Ecke des Verputzes in einem Nebenzimmer entdeckt, sie allerdings als bloße Einbildung abgetan. Mit der Zeit hatte sich die Beule in der Decke zu einer Welle ausgewachsen, die sich trotz des neuen Daches vergrößerte und weiter wölbte. Ein altes Haus ist eine eigene Art der Andacht, eine alte verwitwete Tante, der man eine Geschichte entlocken muss, ein Mysterium, eine Reihe ineinandergreifender Rätsel, die der Lösung harren. Warum ist diese Dachuntersicht in der südöstlichen Ecke einer Dachtraufe versteckt? Was verbirgt sich hinter diesem verfärbten Stück Ziegelstein? Bei einem alten Haus ist die Arbeit nie wirklich getan.
Die USA sind ein altes Haus. Wir können die Arbeit an ihm niemals für beendet erklären. Wind, Überschwemmung, Dürre und menschliche Umbrüche setzen einem Bauwerk zu, das bereits mit den Mängeln zu kämpfen hat, die schon dem ursprünglichen Fundament innewohnten. Lebt man in einem alten Haus, möchte man nach einem Sturm vielleicht nicht in den Keller gehen, um zu sehen, was der Regen angerichtet hat. Jedoch: Wer nicht hinschaut, tut dies auf eigene Gefahr. Die Eigentümerin eines alten Hauses weiß, dass das, was man ignoriert, niemals verschwindet. Was immer auch dort lauert, wird schwären, ob man nun hinsehen will oder nicht. Unwissenheit schützt nicht vor den Folgen der Untätigkeit. Was immer man wegwünscht, wird an einem nagen, bis man den Mut aufbringt, sich ihm zu stellen.
Wir in der entwickelten Welt sind wie Hausbesitzerinnen, die ein Haus auf einem Grundstück geerbt haben, das äußerlich schön anzusehen ist, dessen Boden aber aus instabilem Lehm und Gestein besteht, das sich über Generationen hinweg anhebt und absenkt, dessen Risse geflickt, dessen tiefere Brüche aber jahrzehnte- und sogar jahrhundertelang unbeachtet geblieben sind. Viele Menschen mögen zu Recht sagen: »Ich habe nichts damit zu tun, wie all das angefangen hat. Ich kann nichts für die Sünden der Vergangenheit. Meine Vorfahren haben keine Native Americans angegriffen, und sie haben auch niemanden versklavt.« Und natürlich: Keiner von uns war hier, als dieses Haus errichtet wurde. Unsere unmittelbaren Vorfahren mögen nichts damit zu tun gehabt haben, doch hier sind wir, die jetzigen Bewohnerinnen und Bewohner eines Hauses mit Spannungsrissen, verbogenen Wänden und einem brüchigen Fundament. Wir sind die Erbinnen und Erben von allem, was an diesem Haus richtig oder fehlerhaft ist. Wir haben die unebenen Säulen oder Balken nicht gebaut, aber wir müssen mit ihnen umgehen.
Und jede weitere Verschlechterung liegt nur an uns.
Die Risse und querverlaufenden Spalten werden sich nicht von selbst wieder fügen. Die Giftstoffe werden nicht verschwinden, sondern sich ausbreiten, durchsickern und mutieren, wie es bereits geschehen ist. Leben Menschen in einem alten Haus, so gewöhnen sie sich an die Eigenheiten und Gefahren, die in einem alten Gemäuer lauern. Sie stellen Eimer unter eine feuchte Decke, stützen ächzende Fußböden ab, lernen, die verrotteten Holzstufen im Treppenhaus auszulassen. Das Unangenehme wird akzeptabel, und das Inakzeptable wird lediglich unpraktisch. Lebt man nur lange genug damit, wird das Undenkbare zur Normalität. Sind wir über Generationen hinweg damit konfrontiert, lernen wir zu glauben, dass das Unbegreifliche die Art und Weise ist, nach der das Leben nun einmal verläuft.
*
Der Bauaufseher stand vor dem Rätsel der verzogenen Decke und hielt zunächst einen Sensor an die Oberfläche, um sie auf Feuchtigkeit zu überprüfen. Da das Ergebnis nicht eindeutig war, zückte er die Infrarotkamera, um das Problem mit einer Art Röntgenaufnahme sichtbar zu machen. Nun war es ihm möglich, hinter den Putz zu spähen, hinter das, was tapeziert oder übermalt worden war, so wie wir es heute in dem Haus, in dem wir alle leben, ebenfalls tun müssen, um eine vor langer Zeit erbaute Struktur betrachten zu können.
Was in anderen alten Häusern Bolzen und Balken, ist in den USA das Kastensystem, ein unsichtbares Skelett, das jenes Gebäude stützt, das wir unser Zuhause nennen. Die Kaste ist die Infrastruktur unserer Spaltung. Sie ist die Architektur der menschlichen Hierarchie, der unbewusste Code von Anweisungen zur Aufrechterhaltung einer – in unserem Fall – 400 Jahre alten Sozialordnung. Ein Blick auf die Kaste ist so, als würde man das Röntgenbild des Landes vors Licht halten.
Ein Kastensystem ist ein künstliches Konstrukt, eine feststehende und festverankerte Rangordnung menschlicher Werte, die die vermeintliche Überlegenheit einer Gruppe gegenüber anderen Gruppen auf der Grundlage von Abstammung und weiteren unveränderlichen Merkmalen festlegt, Merkmalen, die abstrakt gesehen neutral wären, denen aber in einer existenziellen Hierarchie eine Bedeutung zugeschrieben wird, die die dominante Kaste begünstigt, deren Vorfahren sie geschaffen haben. Ein Kastensystem bedient sich starrer, oft willkürlicher Grenzen, um die hierarchisierten Gruppierungen zu trennen, sie voneinander zu unterscheiden und an den ihnen zugewiesenen Plätzen zu halten.
Im Laufe der Menschheitsgeschichte haben sich drei Kastensysteme herauskristallisiert. Das tragisch intensivierte und als überwunden geltende Kastensystem von Nazi-Deutschland. Das seit Jahrtausenden bestehende Kastensystem Indiens. Und die sich wandelnde, unausgesprochene, ethnische Kastenpyramide in den Vereinigten Staaten. Alle drei stützten sich auf die Stigmatisierung derjenigen, die als minderwertig galten, um die Entmenschlichung zu rechtfertigen und rational zu begründen, die notwendig war, die Menschen auf den untersten Rängen zu fixieren. Ein Kastensystem hat Bestand, weil es häufig als göttlicher Wille gerechtfertigt wird, der einem vermeintlichen Naturgesetz entstammt, in der gesamten Kultur verstärkt und über Generationen weitergegeben wird.
In unserem Alltag ist Kaste die wortlose Platzanweiserin in einem dunklen Theatersaal, die uns mit der Taschenlampe durch die Gänge zu den uns zugewiesenen Plätzen für die Aufführung bringt. In der Hierarchie der Kaste geht es nicht um Gefühle oder Moral. Es geht um Macht – welche Gruppen sie besitzen und welche nicht. Es geht um Ressourcen – welche Kaste sie verdient und welche nicht; wer die Ressourcen erwerben und kontrollieren darf und wer nicht. Es geht um Respekt, Autorität und Kompetenz – wem diese zugestanden werden und wem nicht. Als Mittel, um weiten Teilen der Menschheit einen Wert zuzuweisen, beeinflusst die Kaste jede und jeden Einzelnen von uns, auch wenn es uns häufig gar nicht bewusst ist. In uns verankert sie eine unbewusste Rangordnung menschlicher Eigenschaften und legt die Regeln, Erwartungen und Stereotype fest, die zur Rechtfertigung von Gewalt gegen ganze Gruppen innerhalb unserer Spezies eingesetzt werden. Im US-amerikanischen Kastensystem nennen wir das Merkmal des Ranges Race, die ethnische Einteilung von Menschen auf Grundlage ihres Aussehens. In den USA ist Race das wichtigste und sichtbarste Werkzeug der Kaste. Wenn Race die Sprache ist, in der wir von klein auf über Menschen nachdenken, in der wir sie sehen und wahrnehmen, dann ist die Kaste die ihr zugrundeliegende Grammatik. Sie ist der Leitfaden, wie wir sprechen und wie wir Informationen verarbeiten, ohne dass wir darüber nachdenken müssten. Selbst Menschen, die nie gelernt haben, wie unsere Grammatik funktioniert, wenden sie instinktiv richtig an. Sie »wissen«, dass ein transitives Verb ein Objekt erfordert, dass ein Subjekt ein Prädikat verlangt; ohne darüber nachzudenken, kennen sie den Unterschied zwischen der dritten Person Singular und der dritten Person Plural. Wir sprechen vielleicht von Race und bezeichnen Menschen als Schwarz oder weiß oder lateinamerikanisch oder asiatisch oder Indigen, ohne uns bewusst zu machen, dass sich hinter jeder Bezeichnung eine jahrhundertelange Geschichte und die Zuweisung von Fähigkeiten und Werten über körperliche Merkmale in einer Struktur menschlicher Hierarchie verbirgt.
Das Aussehen von Menschen, oder besser gesagt, die Race, der sie zugeordnet werden oder der man sie zugehörig glaubt, ist der sichtbare Hinweis auf ihre Kaste. Es ist das historische Zeichen für die Öffentlichkeit, wie sie zu behandeln sind, wo sie leben sollen, welche Anstellungen ihnen zugetraut werden, ob sie in diesen Stadtteil oder an jenen Platz in einem Sitzungssaal gehören; ob sie mit Autorität über dieses oder jenes Thema sprechen dürfen; ob ihnen in einem Krankenhaus Schmerzmittel verabreicht werden; ob es wahrscheinlich ist, dass ihre Nachbarschaft an eine Giftmülldeponie angrenzt oder ob kontaminiertes Trinkwasser aus ihren Hähnen fließt; ob es in der fortschrittlichsten Nation der Welt wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, dass sie eine Geburt überleben werden; ob sie von Polizisten ungestraft erschossen werden können.
Wir wissen, dass die Buchstaben des Alphabets neutral und für sich genommen bedeutungslos sind, bis sie zu einem Wort zusammengesetzt werden, das selbst ebenfalls erst größere Bedeutung erlangt, wenn es in einen Satz eingefügt und von denen, die es sprechen, interpretiert wird. So wie Schwarz und Weiß auf Menschen angewandt wurden, die ganz buchstäblich keines von beiden waren, sondern eher Abstufungen von Braun und Beige und Elfenbein, genau so stellt das Kastensystem Menschen an Polen gegenüber und besetzt die Extreme sowie die Abstufungen dazwischen mit Bedeutungen. Anschließend gießt das Kastensystem diese Bedeutungen in die entsprechende Form, in gesellschaftliche Rollen, die von den Menschen der jeweiligen Kaste ausgefüllt werden müssen.
Kaste und Race sind weder Synonyme noch schließen sie sich gegenseitig aus. Kaste ist das Knochengerüst, Race ist die Haut. Race ist, was sichtbar ist: die körperlichen Merkmale, denen historisch eine willkürliche Bedeutung verliehen wurde, die rückwirkend veränderbar ist, wenn es den Bedürfnissen der herrschenden Kaste in den heutigen Vereinigten Staaten förderlich scheint. Kaste ist die mächtige Infrastruktur, die jede soziale Gruppe an ihrem Platz fixiert.
Kaste ist etwas Festes und Starres. Race ist flüssig und oberflächlich. Während sich die Anforderungen, um als weiß zu gelten, im Laufe der Jahrhunderte gewandelt haben, ist die Tatsache einer herrschenden Kaste seit ihren Anfängen stets konstant geblieben – wer immer der Definition von Weiß entsprach, egal zu welchem Zeitpunkt in der Geschichte, erhielt die gesetzlichen Rechte und die Privilegien der herrschenden Kaste. Vielleicht noch entscheidender und tragischer ist, dass am anderen Ende der Leiter die unterste Kaste ebenfalls von Anfang an als Nullpunkt festgesetzt wurde, der von all den anderen Kasten unmöglich unterschritten werden kann.
So werden wir alle in ein stummes, jahrhundertealtes Kriegsspiel hineingeboren und in Teams eingeteilt, für die wir uns nicht selbst entschieden haben. Die Kaste, der wir im US-amerikanischen System der menschlichen Kategorisierung zugewiesen werden, wird verkündet durch die Teamuniform, die unseren mutmaßlichen Wert und unsere Fähigkeiten signalisiert. Dass es einigen von uns gelingt, über diese künstlichen Trennlinien hinweg dauerhafte Verbindungen zu anderen herzustellen, zeugt von der Schönheit des menschlichen Geistes.
Zufällige körperliche Merkmale als Hinweise auf unsere inneren Fähigkeiten, unsere Talente und unseren Wert zu verstehen, ist vielleicht die geschickteste Methode, die je von einer Kultur zur Verwaltung und Aufrechterhaltung eines Kastensystems entwickelt wurde.
Der Politikwissenschaftler Andrew Hacker schreibt über die Verwendung physischer Merkmale zur Bildung menschlicher Kategorien: »Als soziale und menschliche Einteilung übertrifft sie alle anderen – sogar das Geschlecht –, was die Intensität und die Unterordnung angeht.«19
3
Ein US-amerikanischer Unberührbarer
Im Winter 1959, nachdem Martin Luther King jr. und seine Frau Coretta den Busboykott von Montgomery angeführt hatten, der infolge der Verhaftung von Rosa Parks entstanden war, landeten King und seine Frau in Indien, in der Stadt, die damals Bombay hieß, um das Land von Mahatma Gandhi, dem Vater des gewaltlosen Protests, zu besuchen. Bei ihrer Ankunft wurden sie mit Kränzen geschmückt, und King sagte zu den Reportern: »In andere Länder reise ich vielleicht als Tourist, nach Indien aber komme ich als Pilger.«
Lange hatte King bereits von einer Reise nach Indien geträumt, und auf Einladung von Premierminister Jawaharlal Nehru blieben sie einen ganzen Monat im Land. King wollte sich endlich selbst ein Bild von dem Ort machen, dessen Kampf um die Befreiung von der britischen Herrschaft ihn zu seinem eigenen Kampf für Gerechtigkeit in den USA inspiriert hatte. Er wollte die sogenannten Unberührbaren treffen, die Menschen der untersten Kaste des alten indischen Kastensystems, über die er gelesen hatte und für die er Sympathien hegte und die ein Jahrzehnt nach der Unabhängigkeit Indiens noch immer benachteiligt waren.
Er stellte fest, dass die Menschen in Indien die Unterdrückung der Schwarzen in den USA verfolgt hatten und von dem Busboykott wussten, den er angeführt hatte. Wo immer er auftauchte, drängten sich die Menschen auf den Straßen von Bombay und Delhi um ihn und baten um ein Autogramm.
Eines Nachmittags reisten King und seine Frau an die Südspitze des Landes, in die Stadt Trivandrum im Bundesstaat Kerala, und besuchten Schülerinnen und Schüler einer Highschool, deren Familien Unberührbare waren. Der Schulleiter stellte King vor.
»Ihr lieben jungen Menschen«, sagte er, »ich möchte euch einen Kameraden unter uns Unberührbaren aus den Vereinigten Staaten von Amerika vorstellen.«
King war fassungslos. Er hatte nicht erwartet, dass dieser Begriff auf ihn angewandt werden würde. Anfangs störte er sich daran. Er war von einem anderen Kontinent eingeflogen, hatte den Premierminister zum Galadinner getroffen. Er sah den Zusammenhang nicht, begriff nicht, was das indische Kastensystem mit ihm zu tun hatte, warum die Menschen der niedrigsten Kaste in Indien ihn, einen US-amerikanischen Schwarzen und einen Ehrengast, als Angehörigen einer ebenso niedrigen Kaste und als einen der ihren ansehen würden. »Einen Moment lang«, schrieb er, »war ich schockiert und verärgert, dass man mich einen Unberührbaren nannte.«
Dann begann er über die Lebenswirklichkeit der Menschen nachzudenken, für die er kämpfte: 20 Millionen Menschen, die in den USA seit Jahrhunderten auf den niedrigsten Rang verwiesen werden, die »noch immer in einem luftdichten Käfig der Armut ersticken«, die in isolierten Ghettos unter Quarantäne stehen und in ihrem eigenen Land im Exil leben.
Und er sagte sich: »Ja, ich bin ein Unberührbarer, und jeder Negro in den Vereinigten Staaten von Amerika ist ein Unberührbarer.«20
In diesem Moment begriff er, dass das Heimatland der Freiheit ein Kastensystem kreiert hatte, das dem indischen nicht unähnlich war, und dass er sein ganzes Leben lang innerhalb dieses Systems gelebt hatte. Dies war es, was sich hinter den Kräften verbarg, gegen die er in den Vereinigten Staaten kämpfte.
*
Was Martin Luther King jr. an jenem Tag über sein Land erfuhr, hatte seinen Ursprung genommen, lange bevor die Vorfahren unserer Vorfahren überhaupt ihren ersten Atemzug getan hatten. Mehr als anderthalb Jahrhunderte vor der Amerikanischen Revolution hatte sich auf dem umkämpften Boden dessen, was die Vereinigten Staaten werden sollten, eine menschliche Hierarchie herausgebildet, ein Konzept des Geburtsrechts, die Versuchung der berechtigten Expansion, die die erste Demokratie der Welt in Gang setzen sollte.
Diese künstlich geschaffene Rangordnung würde die Gedanken der Menschen verzerren, während Gier und Selbstsucht das menschliche Gewissen in den Hintergrund drängte, um Land und Körper zu rauben, von denen die Eroberer überzeugt waren, beides sei ihr rechtmäßiges Eigentum. Wenn sie diese Wildnis verwandeln und nach ihren Vorstellungen zivilisieren wollten, mussten sie die bereits dort lebenden Menschen unterwerfen, sie versklaven oder vertreiben und diejenigen aus ihren Heimatländern, die sie für minderwertig hielten, an jenen Ort bringen, um das Land zu formen und zu beackern und den Reichtum, der in den fruchtbaren Böden und Küsten lag, an sich zu ziehen.
Um ihre Vorhaben zu rechtfertigen, griffen sie auf bereits bestehende Vorstellungen von ihrer eigenen zentralen Stellung zurück, die durch ihre selbstdienliche Auslegung der Bibel noch untermauert wurden, und schufen eine Hierarchie darüber, wer was tun durfte, wer was besitzen konnte, wer oben und wer unten und wer dazwischen stand. Die Menschen der dominanten Gruppe stammten aus Europa; innerhalb dieser Gruppe wiederum standen die englischen Protestanten an der Spitze, da ihre Waffen und Ressourcen im blutigen Kampf um Nordamerika letztendlich den Sieg bringen sollten. Alle übrigen würden in absteigender Folge auf der Grundlage ihrer Nähe zu den als am höchsten angesehenen Völkern eingeordnet. Die Rangfolge würde sich fortsetzen, bis man ganz unten am Boden angelangte mit afrikanischen Gefangenen, die zum Aufbau der Neuen Welt hertransportiert wurden und den Siegern für alle Tage dienen sollten, eine Generation nach der nächsten, zwölf an der Zahl.
Es entwickelte sich ein Kastensystem, das auf dem Aussehen der Menschen basierte, eine verinnerlichte Rangordnung, unerkannt und unausgesprochen, von normalen Bürgerinnen und Bürgern, die sich bis zum heutigen Tag unbewusst daran halten und danach handeln. Gerade die Unsichtbarkeit der Kaste verleiht ihr Macht und Langlebigkeit.
Der Begriff Kaste wird nicht oft zur Beschreibung der Vereinigten Staaten gebraucht. Man verortet ihn eher in Indien oder im Europa zur Zeit des Feudalismus. Einige Anthropologen und Forscherinnen, die sich mit Race in den USA beschäftigen, verwenden den Begriff jedoch schon seit Jahrzehnten. Einer der ersten US-Amerikaner, der den Begriff der Kaste früh aufgriff, war der Abolitionist und US-Senator Charles Sumner, der vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg gegen die Segregation im Norden kämpfte. »Die Trennung der Kinder in den öffentlichen Schulen von Boston aufgrund ihrer Hautfarbe oder Ethnie«, schrieb er, »liegt in der Natur der Kaste und ist ein Verstoß gegen die Gleichheit.« Er zitierte einen anderen Humanisten: »Die Kaste trifft Unterscheidungen, wo Gott keine Unterscheidungen vorgenommen hat.«21
Wir können die gegenwärtigen Umwälzungen wie auch fast alle Wendepunkte in der US-amerikanischen Geschichte nicht vollständig begreifen, ohne die menschliche Rangordnung zu berücksichtigen, die uns allen eingepflanzt wurde. Das Kastensystem und die Versuche, diese Hierarchie zu verteidigen, aufrechtzuerhalten oder abzuschaffen, lagen dem amerikanischen Bürgerkrieg und der Bürgerrechtsbewegung ein Jahrhundert später zugrunde und durchdringen bis heute die US-amerikanische Politik des 21. Jahrhunderts. So wie die DNA der Code für die Zellentwicklung ist, so ist die Kaste das Betriebssystem für die wirtschaftliche, politische und soziale Interaktion in den Vereinigten Staaten, und das seit ihrer Entstehung.
Der schwedische Sozialökonom Gunnar Myrdal und ein Team der begabtesten Forscher der USA legten 1944 ein 2.800 Seiten starkes, zweibändiges Werk vor, das vielen noch immer als die umfassendste Studie über Race in den USA gilt: An American Dilemma. Interessanterweise führte Myrdals Untersuchung ihn zu der Erkenntnis, dass der treffendste Begriff, um die Funktionsweise der US-amerikanischen Gesellschaft zu beschreiben, jedoch nicht Race sei, sondern Kaste. Er kam zu dem Schluss, dass das Bemühen, »die Rassengrenze aufrechtzuerhalten, für den gewöhnlichen Weißen die ›Funktion‹ hat, das Kastensystem aufrechtzuerhalten, den Negro an seinem Platz zu halten.«22
Der Anthropologe Ashley Montagu war einer der Ersten, die die Kategorie der Rasse als eine menschliche Erfindung brandmarkten, ein soziales Konstrukt, kein biologisches, und er argumentierte, dass wir bei der Suche nach einem Verständnis für die Unterschiede und Ungleichheiten in den Vereinigten Staaten typischerweise in den Treibsand und die Mythologie von Race geraten seien. »Wenn wir von dem Rassenproblem in Amerika sprechen«, schrieb er 1942, »meinen wir in Wirklichkeit das Kastensystem und die Probleme, die dieses Kastensystem in den USA erzeugt.«23
Unter den führenden White Supremacists des vorigen Jahrhunderts herrschte größtenteils Einigkeit über die Zusammenhänge zwischen dem indischen Kastensystem und dem des US-amerikanischen Südens, wo das konsequenteste legale Kastensystem des Landes existierte. »Die verzweifelten Bemühungen der herrschenden Oberschicht in Indien, die Reinheit ihres Blutes zu bewahren, sind bis zum heutigen Tag in ihrem sorgfältig geregelten Kastensystem erhalten geblieben«, schrieb Madison Grant, ein populärer Eugeniker, in seinem Bestseller von 1916, The Passing of the Great Race. »In unseren Südstaaten verfolgen die Züge mit getrennten Abteilen für Schwarze und Weiße und die soziale Diskriminierung genau denselben Zweck.«24
*
Ein Kastensystem neigt dazu, alle Menschen eines Landes zu beeinflussen. Seine Codes werden wie Mineralien aufgenommen und legen die Erwartungen fest, wo auf der Leiter man sich befindet. »Der Fabrikarbeiter, der niemanden hat, auf den er ›herabschauen‹ kann, sieht sich selbst als dem Negro haushoch überlegen an«, stellte der Yale-Wissenschaftler Liston Pope 1942 fest. »Der Schwarze ist sein letzter Vorposten gegen das soziale Vergessen.«25
Im Jahr 1913 nahm es ein prominenter Pädagoge aus den Südstaaten namens Thomas Pearce Bailey auf sich, etwas zusammenzustellen, was er das ethnische Glaubensbekenntnis des Südens nannte. Es handelte sich dabei um die zentralen Grundsätze des Kastensystems. Einer dieser Grundsätze lautete: »Der niedrigste Weiße soll mehr zählen als der höchste Schwarze.«26
Im selben Jahr kam ein Mann, der als Unberührbarer in den Central Provinces von Indien geboren wurde, aus Bombay nach New York City. Bhimrao Ambedkar reiste im Herbst in die Vereinigten Staaten, um an der Columbia University Wirtschaftswissenschaften zu studieren und sich mit den Unterschieden zwischen Race, Kaste und Klasse zu befassen. Da er nur wenige Blocks von Harlem entfernt wohnte, konnte er die gesellschaftliche Stellung seiner Mitstudierenden selbst mit ansehen. Er schloss gerade seine Masterarbeit ab, als der Film Die Geburt einer Nation, die aufrührerische Hommage an die Konföderierten Südstaaten, in New York City Premiere hatte. Das war 1915. Ambedkar studierte anschließend in London weiter, bevor er nach Indien zurückkehrte, wo er der Anführer der Unberührbaren und ein herausragender Intellektueller wurde, der an der Ausarbeitung einer neuen indischen Verfassung mitwirkte. Er setzte sich dafür ein, die abwertende Bezeichnung Harijans, die Unberührbaren, abzuschaffen. Stattdessen bezeichnete er sein Volk als Dalits, was »gebrochene Menschen« bedeutet und was sie aufgrund des Kastensystems durchaus waren.
Es ist schwer zu sagen, welche Auswirkungen seine Auseinandersetzung mit der sozialen Ordnung in den USA auf ihn persönlich hatte. Doch im Laufe der Jahre schenkte er, wie viele Dalits es taten, der untersten Kaste der Vereinigten Staaten größere Aufmerksamkeit. Das indische Volk war sich der Notlage der versklavten afrikanischen Menschen und ihrer Nachkommen in den USA vor dem Bürgerkrieg schon lange bewusst gewesen. In den 1870er-Jahren, nach dem Ende der Sklaverei und während der kurzen Zeitspanne des Aufstiegs Schwarzer Menschen, die als Reconstruction bekannt wurde, fand ein indischer Sozialreformer namens Jotiba Phule Inspiration in der Arbeit der Abolitionistinnen und Abolitionisten. Er äußerte die Hoffnung, »dass sich seine Landsleute an ihrem edlen Beispiel orientieren mögen.«27
Viele Jahrzehnte später, im Sommer 1946, als Ambedkar erfuhr, dass Schwarze US-Amerikanerinnen und -Amerikaner bei den Vereinten Nationen den Schutz von Minderheiten beantragten, wandte er sich an den bekanntesten Schwarzen Intellektuellen seiner Zeit, W. E. B. Du Bois. Er teilte Du Bois mit, dass er ein »Forscher des Negro-Problems« sei, der die Situation von der anderen Seite des Ozeans aus studiert habe und der Meinung sei, dass sie womöglich ein und dasselbe Schicksal teilten.
»Es gibt so viele Ähnlichkeiten zwischen der Lage der Unberührbaren in Indien und der Lage der Negros in den USA«, schrieb Ambedkar an Du Bois, »dass die Erforschung des Letzteren nicht nur naheliegend, sondern notwendig ist.«28
Du Bois antwortete Ambedkar, dass er mit seiner Arbeit vertraut sei und »großes Mitgefühl mit den Unberührbaren in Indien« habe.29 Du Bois war es gewesen, der für die Ausgegrenzten in beiden Ländern zu sprechen schien, als er das geteilte Bewusstsein ihrer Existenz feststellte. Und Du Bois war es auch, der sich Jahrzehnte zuvor auf ein indisches Konzept berufen hatte, um der bitteren Klage seines Volkes in den USA eine Stimme zu verleihen: »Warum hat Gott mich zu einem Ausgestoßenen und Fremden in meinem eigenen Haus gemacht?«30
*
Ich habe die Arbeit an diesem Buch mit dem gleichen Wunsch begonnen, über die Ozeane hinweg zu blicken, um besser zu verstehen, wie all dies in den Vereinigten Staaten seinen Anfang nahm: wie zufällige, unveränderliche physische Merkmale mit einer bestimmten Bedeutung aufgeladen wurden; die über Jahrhunderte weitergegebene Hierarchie, die die Politik und die persönlichen Interaktionen bestimmt und lenkt. Was sind die Ursprünge und die Funktionsweise der Hierarchie, die in das tägliche Leben und die Lebenschancen jedes Menschen eingreifen, der in den USA lebt, und die mit beunruhigender Regelmäßigkeit und Konsequenz in mein eigenes Leben eingedrungen sind?
Ich begann, das US-amerikanische Kastensystem zu erforschen, nachdem ich mich fast zwei Jahrzehnte lang mit der Geschichte des Jim-Crow-Südens befasst hatte, dem legalen Kastensystem, das durch die Versklavung verfestigt wurde, bis in die frühen 1970er-Jahre andauerte und also bis in die Lebensspanne vieler heutiger US-Amerikanerinnen und -Amerikaner hineinwirkte. Während der Arbeit an meinem Buch The Warmth of Other Suns entdeckte ich, dass ich nicht über Geografie und Umsiedlung schrieb, sondern über das Kastensystem der USA, eine künstliche Hierarchie, in der fast alles, was man tun oder nicht tun kann, auf dem eigenen Aussehen beruht. Ich hatte über ein stigmatisiertes Volk geschrieben, sechs Millionen an der Zahl, die im Süden nach der Befreiung vom Kastensystem strebten, und ich entdeckte, dass die Hierarchie sie verfolgte, wohin auch immer sie gingen, und dass sich der Schatten der Kaste bis in die indische Diaspora und über die Menschen, die darin leben, wirft.
Für dieses Buch wollte ich die Ursprünge und die Entwicklung der Priorisierung einer Gruppe von Menschen über eine andere begreifen und die Folgen für die vermeintlichen Nutznießenden und die Benachteiligten aufzeigen. Da ich mich selbst als lebendes, atmendes Kastenexperiment in der Welt bewege, wollte ich die Hierarchien verstehen, die ich und Millionen anderer Menschen überwinden mussten, um unsere Arbeit und unsere Träume zu verwirklichen.
Das bedeutete zum einen, das bekannteste Kastensystem der Welt – das indische – zu betrachten und die Parallelen, Überschneidungen sowie Kontraste zwischen dem Kastensystem in meinem eigenen Land und dem ursprünglichen System der Kaste zu untersuchen. Auch versuchte ich, das molekulare, konzentrierte Böse zu begreifen, welches das Kastensystem in Nazi-Deutschland hervorgebracht hatte, und ich fand verblüffende, beunruhigende Verbindungen zwischen den USA und Deutschland in den Jahrzehnten vor dem Dritten Reich. Nachdem ich die Geschichte aller drei Hierarchien durchforstet und eine Fülle von Studien über das Kastenwesen in vielen Disziplinen durchgesehen hatte, begann ich, die Parallelen zu systematisieren und die wesentlichen gemeinsamen Merkmale dieser Hierarchien zu identifizieren. Sie sind das, was ich als die acht Säulen des Kastenwesens bezeichne; Merkmale, die in allen drei Hierarchien auf beunruhigende Weise vorzufinden sind. Meine Recherchen führten mich über die USA hinaus nach London, Berlin, Delhi und Edinburgh. Ich entschied mich, Einblicke in das Kastenwesen zu geben – einige dieser Einblicke entstammen meinen eigenen Erfahrungen, andere wurden mir zugetragen.
Zwar versucht dieses Buch, die Auswirkungen der Kaste auf alle Menschen zu berücksichtigen, die in der Hierarchie gefangen sind. Jedoch schenkt es den Menschen an den Polen des amerikanischen Kastensystems die größte Aufmerksamkeit: denjenigen an der Spitze, europäischstämmigen US-Amerikanerinnen und -Amerikanern, die seine Hauptnutznießenden waren, und denjenigen am unteren Ende, den Schwarzen Menschen afrikanischer Abstammung, gegen die das Kastensystem seine ganze Macht der Entmenschlichung richtete und immer noch richtet.
*
Das US-amerikanische Kastensystem nahm seinen Ursprung in den Jahren nach der Ankunft der ersten versklavten Menschen aus Afrika in der Kolonie Virginia im Sommer 1619, als die Kolonie versuchte, noch klarer zu unterscheiden, wer auf Lebenszeit versklavt werden konnte und wer nicht. Im Laufe der Zeit gewährten die Kolonialgesetze den englischen und irischen Schuldknechten größere Privilegien als den Menschen aus Afrika, die an ihrer Seite arbeiteten, und bald wurden alle Menschen europäischer Abstammung zu einer neuen Identität verschmolzen: Sie galten alle als Weiße und waren somit das exakte Gegenteil von Schwarzen. Der Historiker Kenneth M. Stampp bezeichnet diese Unterteilung der Ethnien als ein »Kastensystem, das diejenigen, die aufgrund ihres Aussehens eine rein kaukasische Abstammung beanspruchen konnten, von denjenigen trennte, deren Aussehen darauf hindeutete, dass einige oder alle ihrer Vorfahren Negros waren.« All jene, die der kaukasischen Kaste, wie er sie nannte, angehörten, »glaubten an die ›weiße Vorherrschaft‹ und hielten ein hohes Maß an Kastensolidarität aufrecht, um diese Vorherrschaft zu sichern.«31
Geburtsort dieses Kastensystems in den USA ist der amerikanische Süden. Es ist der Ort, an dem die Mehrheit der untersten Kaste die längste Zeit zu leben verurteilt war. Hier wurde das Kastensystem formalisiert und am brutalsten durchgesetzt. Hier wurden die Grundsätze der Beziehungen zwischen den Kasten zementiert, bevor sie sich auf den Rest des Landes ausbreiteten, was den Schriftsteller Alexis de Tocqueville 1831 zu der Feststellung veranlasste: »Das Vorurteil […] scheint mir noch stärker zu sein, da wo die Sklaverei nicht mehr vorhanden ist, als da, wo man sie nicht abgeschafft hat, und am unduldsamsten zeigt es sich in den Staaten, wo die Knechtschaft stets unbekannt war.«32
Um unser Selbstverständnis neu zu kalibrieren, verwende ich Begriffe, die für gewöhnlich eher mit Menschen in anderen Kulturen assoziiert werden: dominante Kaste, herrschende Mehrheit, bevorzugte Kaste oder Oberkaste anstelle von oder zusätzlich zu weiß. Mittlere Kaste anstelle von oder zusätzlich zu asiatisch oder Latinx. Untergeordnete Kaste, niedrigste Kaste, unterste Kaste, missbilligte Kaste, historisch stigmatisiert anstelle von afroamerikanisch. Ursprüngliche, eroberte oder Indigene Völker anstelle von oder zusätzlich zu Native American. Marginalisierte Menschen zusätzlich zu oder anstelle von Frauen jeglicher Ethnie sowie Minderheiten aller Art.
Manches davon mag wie eine Fremdsprache anmuten. In gewisser Weise ist es das auch, und das soll es auch sein. Denn um die USA wirklich zu verstehen, müssen wir unsere Augen für das verborgene Wirken eines Kastensystems öffnen, das diesen Namen nie trug, aber zu unser aller kollektivem Nachteil Bestand hat, um zu sehen, dass wir mehr miteinander und mit anderen Kulturen gemeinsam haben, als wir uns wagen anzuerkennen.
Während meiner Recherche stieß ich auf zahlreiche Gleichgesinnte aus der Vergangenheit – Soziologinnen, Anthropologen, Ethnografinnen, Schriftsteller –, deren Arbeit mich durch die Zeit und über Generationen hinweg trug. Viele hatten sich gegen den Strom gewandt, und ich spürte, dass ich eine Tradition fortsetzte und nicht allein war.
Mitten in der Forschungsarbeit erfuhren einige indische Menschen, die hier in den USA leben und das indische Kastensystem erforschen, von meinem Unterfangen. Sie luden mich ein, auf einer Eröffnungskonferenz über Kaste und Race an der Universität von Massachusetts in Amherst zu sprechen, jener Stadt, in der W. E. B. Du Bois geboren wurde und wo sich heute sein Archiv befindet.
Dort erzählte ich den Anwesenden, dass ich ein sechshundertseitiges Buch über die Jim-Crow-Ära im amerikanischen Süden, die Zeit der nackten weißen Vorherrschaft, verfasst hatte, in dem das Wort Rassismus allerdings auf keiner Seite zu finden war. Ich sagte ihnen, dass ich, nachdem ich mich 15 Jahre lang mit dem Thema beschäftigt und die Aussagen der Überlebenden dieser Ära gehört hatte, schließlich einsah, dass der Begriff unzureichend sei. Kaste sei zutreffender. Sie waren schockiert und ermutigt zugleich. Das indische Essen, das man mir beim Empfang serviert hatte, wurde kalt, weil unser Austausch bis in die Nacht hinein dauerte.
Bei einer Abschlusszeremonie, von der ich im Vorfeld nichts erfahren hatte, überreichten mir die Gastgeberinnen und Gastgeber eine bronzefarbene Büste des Schutzpatrons der Geringgeborenen Indiens, Bhimrao Ambedkar, des Dalit-Führers, der vor so vielen Jahrzehnten Briefe mit Du Bois ausgetauscht hatte. Es fühlte sich an, als würde ich in eine Kaste aufgenommen, der ich vielleicht auf eine gewisse Weise immer schon angehört hatte. Immer wieder erzählten sie von ihren Erlebnissen, und ich reagierte mit persönlicher Anerkennung, als ob ich eine bestimmte Wendung oder ein bestimmtes Ergebnis vorwegnehmen wollte. Zu ihrem Erstaunen begann ich zu erkennen, wer von den indischstämmigen Menschen unter uns hoch- und wer niedriggeboren war, und zwar nicht anhand ihres Aussehens, wie man es in den USA tun könnte, sondern anhand der ganz menschlichen Reaktion auf Hierarchien – die sich im Falle einer Person der oberen Kaste zum Beispiel in einer auffälligen Selbstsicherheit ausdrückte, was Haltung und Auftreten betraf, sowie in einer sichtbaren Erwartung, im Mittelpunkt zu stehen.
Nach einem Vortrag ging ich auf eine Referentin zu, deren Kaste ich durch Beobachtung ihrer Interaktionen mit anderen ausgemacht hatte. Ich bemerkte, dass sie sich reflexartig über die Dalit-Rednerin gestellt und sich angemaßt hatte, zu erklären, was die Dalit gerade gesagt oder gemeint hatte. Auf diese Weise nahm sie beinahe automatisch – und vielleicht unbewusst – eine autoritäre Position ein.