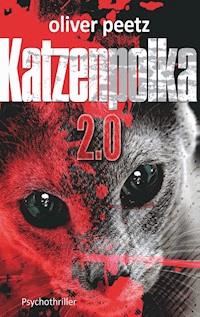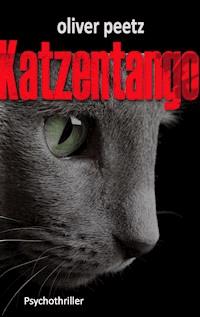
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der junge Iho wächst im sozialen Brennpunkt einer Großstadt auf. Jugendkriminalität, Gewalt und Drogen bestimmen in diesem Ghetto den Alltag. In einem Keller begegnet der ängstliche Junge einer Gruppe verwahrloster Jugendlicher, die sich bei einem Ritual in einen ohnmachtsähnlichen Trancezustand versetzen. Iho, der sich auf das seltsame Ritual einlässt, verliert dabei das Bewusstsein und liegt mehrere Stunden ohnmächtig auf dem kalten Boden des Kellers. Alleingelassen von der Gruppe. Als er zu sich kommt, hat sich etwas verändert. Er hat sich verändert. Er folgt der Stimme in seinem Kopf und beginnt zu morden. Als Ihos geliebte Mutter an seinem fünfzehnten Geburtstag stirbt, verbringt er noch mehrere Tage mit der Toten in der Wohnung. Der aufkommende Druck der Öffentlichkeit zwingt ihn schließlich, das Viertel zu verlassen. Zu Fuß und ohne Ziel. Nach Tagen und Nächten der Entbehrungen kommt es durch eine geheimnisvolle Katze zu einer schicksalhaften Begegnung mit einem alten Mann, der allein in einem abgelegenen Waldgebiet wohnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch widme ich meiner Tochter Malina
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Notiz eines jüdischen Mädchens
Kapitel 2: Notizen eines deutschen Arztes
Kapitel 3: Unbeschwerte Kindheit
Kapitel 4: Beutejagd
Kapitel 5: Die Stimme wird lauter
Kapitel 6: Die andere Seite
Kapitel 7: Wahres Glück
Kapitel 8: Mutter
Kapitel 9: Seelenverwandtschaft
Kapitel 10: Tango-Finale
Kapitel 1
Notiz eines jüdischen Mädchens
Geschrieben im Winter 1943
Entdeckt im April 1945
Bei der Befreiung Nazideutschlands durch alliierte Streitkräfte im Frühjahr 1945 entdeckte ein amerikanischer Soldat in einer der zahlreichen Baracken eines Konzentrationslagers eine Blechschachtel. Sie befand sich in einem Hohlraum hinter einer Bretterwand versteckt und gehörte der vierzehnjährigen Anna Rosenthal, die, genau wie ihre Eltern, in dem Lager ermordet worden war. Neben ein paar Habseligkeiten, einem Foto, ein paar Knöpfen und einer kleinen Handpuppe fand man auch folgende Notiz des Mädchens in dieser Schachtel:
Jetzt, da ich Gewissheit habe, dass ich sterben werde, habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. Ganz im Gegenteil. Hier bedeutet es mein Ende, aber auf der anderen Seite ist es fürwahr der Anfang und die Wiederkehr. Ich bete jetzt bald stündlich, dass es zum Abschluss kommen mag und ich diesen Ort des Grauens verlassen kann. All das Leid, welches sie uns antun, all die Schreie und das Elend sind nicht in Worte zu fassen.
Es ist schon seltsam, aber ich bin mir gewiss, in der Stunde des Todes wird meine Seele zu einem Engel werden, auf dass ich dem Schöpfer des Universums dienen darf, in alle Ewigkeit.
Nur zu gerne würde ich meine geliebte Mutter und meinen lieben Vater noch einmal in die Arme schließen, um ihnen zu sagen, dass ich eine schöne Kindheit hatte, ihretwegen.
So kalt scheinen doch das Blut und die Herzen derer zu sein, die mit unbarmherziger Grausamkeit in diesem Lager unser Schicksal bestimmen. Als stünden sie auf einer Empore mit unserem Schöpfer selbst, und mir zweifelt an Gerechtigkeit in diesen Tagen, so sehr fehlt mir doch der Halt meiner geliebten Eltern. Und ich weiß nicht einmal, ob sie am Leben sind.
Ich werde sie wiedersehen, aber wohl erst im ewigen Leben. Und irgendwann werden sich unsere Peiniger verantworten müssen. Dort auf der anderen Seite.
Kapitel 2
Notizen eines deutschen Arztes
Niedergeschrieben im Winter 1943
Von Polizeibeamten im Herbst 1981 entdeckt
Es kommen immer neue Züge mit Waggons in das Lager. Ich kann von meinem Schreibtisch aus durch ein Fenster direkt auf die gegenüberliegende Rampe sehen, von der täglich hunderte von Juden hergebracht werden. Der Strom reißt nicht ab, und bei dem Anblick dieser Vielzahl, die hierher deportiert wird, hege ich ernsthafte Zweifel an der von Hitler angelegten Endlösung bezüglich der Judenfrage. Aber es obliegt mir nicht, dieses in Frage zu stellen, und so werde ich weiter meiner täglichen Arbeit nachgehen und „sie“ untersuchen, befragen, zählen, kategorisieren.
Bei dem Gedanken daran wird mir direkt übel, aber ich bin Arzt und Offizier, und ich habe Haltung zu bewahren, obwohl es mir schwerfällt.
Es ist in der Tat eine primitive, von niederen Instinkten getriebene Rasse, der man nicht trauen darf. Heimtücke und Hinterlist stehen in ihren Augen geschrieben. Bei jedem Einzelnen ist es zu erkennen, ausnahmslos. Und selbst die jüngere Generation, die Kinder jener Untermenschen, scheinen mit dieser tiefverwurzelten und mit Sicherheit genetisch bedingten Veranlagung behaftet zu sein.
Nur in den Augen der ganz Kleinen, der Einjährigen und der Säuglinge, ist diese Unart im Blick noch nicht zu vernehmen. Wobei mir hierzu allerdings die nötigen Fallstudien fehlen, um dieses Phänomen genauer beurteilen zu können. Die meisten der Kinder im Alter von unter vier Jahren überleben den Transport hierher ohnehin selten bis gar nicht. Bei den derzeitigen Außentemperaturen jetzt im Februar grenzt es an ein Wunder, wenn überhaupt eine Handvoll lebendig aus einem Waggon herauskommt.
Es ist eine seltsame, kränkliche Rasse, eine schlechte Laune der Natur, die es zu bereinigen gilt. Sie gehören nicht auf diese Erde, und es muss unser aller Streben sein sie auszumerzen. Könnte ich doch nur einen Weg finden, diese Brut schneller auszurotten. Die Männer allesamt schmalbrüstig, weinerlich, ganz gleich welchen Alters. Sie sind nicht zum Arbeiten geboren, diese Juden. Vielleicht resultiert ihre Gier nach Geld, Gold und Reichtum aus ihrer gebrechlichen körperlichen Verfassung. Wie sonst wäre es zu erklären, dass nicht einer unter den männlichen Erwachsenen dabei ist, der auch nur annähernd die Anzeichen von körperlicher Tüchtigkeit aufweist. Sie sind nicht für Produktivität geschaffen. Und sie wirken verschlagen, als dürfe man sie nie aus den Augen lassen, da sie einen sonst hintergehen oder einem gar Schlimmeres antun. Außerdem besitzen sie ein ausgezeichnetes schauspielerisches Talent, welches sie ungehemmt und mit perfider Perfektion einsetzen, um an ihre persönlichen, niederträchtigen Ziele zu gelangen. Sie besitzen keinerlei Rückgrat, und wenn ich diesen Juden bei meinen Untersuchungen mitteile, dass ich ihnen Terpentin zu Versuchszwecken injizieren werde, dann weinen und jammern sie wie Babys.
Ihre Gier nach Reichtum lässt sich mit einem Virus gleichsetzen, von dem dieses Volk befallen scheint, wie einst die spanischen Inquisitoren. Selbst in ihren Namen dreht sich alles ums Gold. Goldmann, Goldbaum, Goldblum und wie sie sich alle nennen.
Das Ergaunern von Gold hat bei ihnen höchste Priorität, und fast ein jeder hat bei der Ankunft im Lager etwas davon bei sich. Sei es in Form von einer Uhr, einer Kette, Schmuck oder Zahngold. Sie trennen sich nur mit äußerst beharrlichem Widerwillen von diesen Besitztümern. Es kommt mir manches Mal vor, als gäben sie ihre eigenen Kinder bei der Sortierung leichteren Herzens weg.
Viele von denen versuchen ihre Wertsachen gar zu verstecken, indem sie sich ihr Gold oder andere Wertgegenstände rektal einführen. Eine Ungeheuerlichkeit, die an Widerwertigkeit nicht mehr zu überbieten ist und die Erbärmlichkeit dieser Rasse beschreibt.
Bei meinen Untersuchungen gebe ich ihnen einmalig Gelegenheit, mir ihr vorsätzliches Zurückhalten der Wertsachen zu gestehen. Sind sie geständig, müssen sie sich unter Aufsicht und nach Einnahme von Rizinusöl entleeren. Eine Prozedur, die mich bis in meine Träume verfolgt und von der mir regelmäßig übel wird, obgleich ich als Arzt einiges gewohnt bin. Wenn sie jedoch leugnen, gibt es keine Gnade, denn ich verabscheue ihre Lügen. Dann mache ich sie auf. Bäuchlings angeschnallt auf einer OP- Liege, mit einer Kissenrolle unter dem Hüftbereich, schneide ich sie auf, und es erinnert stark an das Ausweiden eines frischen Fisches. Ich mache vom Anus her einen Skalpellschnitt über den Steiß, um dadurch zügig und mit einer Hand an ihr stinkendes Versteck zu gelangen. Es ist ein hohes Maß an Selbst-beherrschung und Kraftaufwand von Nöten, denn sie wollen schreien, und sie winden sich, entwickeln aus diesen mageren Körpern heraus plötzlich ungeahnte Kräfte. Und nur mit Hilfe meiner Assistenten gelingt es relativ zügig sie aufzuschneiden und ihnen die Wertsachen dort zu entnehmen. Es bedarf hier in meinen schriftlichen Aufzeichnungen keiner besonderen Erwähnung, was für Unannehmlichkeiten dadurch entstehen. Manch einer ist dabei verstorben, aber die Trefferquote liegt bei über achtzig Prozent, und so sind sie eigens Schuld an dieser Situation. Sie hatten ihre Chance, allesamt.
Bei den Frauen ist es nicht anders. Sie sind unzüchtig und wollüstig, lassen keine Gelegenheit aus, um sich ihren sexuellen Trieben hinzugeben.
Meine Frage, ob sie sich auf sexuelle Handlungen einlassen würden, wenn dadurch Verwandte, der Ehemann beispielsweise oder die Kinder freikommen würden, bejahen diese ruchlosen Personen fast ausnahmslos. Wenn ich dann mit ihnen fertig bin, gehen sie tatsächlich davon aus, jemand Nahestehendem würde die so schändlich erkaufte Freiheit gewährt werden. Was für ein dummes, jämmerliches Volk.
Es ist eine charakterlose Rasse, für die kein Platz vorgesehen ist oder war, und wenn man …
»Ja bitte!«
»Entschuldigen Sie die Störung, Doktor Heyde, aber hier ist ein Mann, der behauptet krank zu sein und Sie dringend sprechen zu müssen.«
»Registriert oder Neuankömmling?«
»Direkt vom Zug.«
»So, so. Gerade eingetroffen und schon die ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen. Da bin ich aber gespannt, bei solch maßloser Unverfrorenheit. Bringen Sie diesen Mann rein.«
»Bitte … bitte entschuldigen Sie, Doktor. Ich bin krank, habe die Röteln … vermutlich. Sie wissen es besser … aber …«
»Was aber?«
»Meine Frau … man hat meine Frau … mich von meiner Frau getrennt … bitte kann ich meine …«
»Ihre Frau? Nur eine weitere Hure, und deswegen unterbrechen Sie mich bei meiner Schreibarbeit?«
»Bitte … ich flehe Sie an.«
»Hören Sie auf zu heulen, Sie Memme. Und kommen Sie zu mir.«
»Ich …«
»Sie sollen zu mir kommen. Halt! Bis dahin und nicht weiter.«
»Ich sagte ja, ich bin krank, habe die Röteln …«
»Die Röteln? Wache! Entfernen Sie augenblicklich diese Person. Lassen Sie sie eliminieren …«
»Was? Nein … bitte … nicht.«
»… und waschen Sie sich anschließend gründlich. Am besten nehmen Sie ein Vollbad, der Mann hat eine schwere, ansteckende Krankheit. Und eliminieren Sie alle Neuankömmlinge mit den gleichen Symptomen, also diesen rötlichen Flecken im Gesicht. Und jetzt raus hier!«
Nun werde ich schon genötigt mich einer Lüge zu bedienen, um nicht weiter bei meiner Arbeit gestört zu werden. Ich hege große Zweifel, ob weitere Versuche und die Untersuchungen dieser Menschen zum gewünschten Erfolg führen. Sie sind absonderlich und undurchsichtig. Aber es obliegt mir nicht, dieses zu beurteilen.
Als Arzt und Offizier habe ich meine Pflicht zu tun. Also werde ich weiter meiner Arbeit nachgehen und diese rattenähnlichen Individuen analysieren. Möge Gott uns von dieser Plage befreien.
Dr. Johann Paul Heyde
14. 2. 1943
Kapitel 3
Unbeschwerte Kindheit
Vierzig Jahre später …
Mein Name ist Iho. Das sind die Anfangsbuchstaben meines dreiteiligen Vornamens, denn eigentlich heiße ich Ignaz-Horst-Otto. Das waren die Namen meiner Vorfahren väterlicherseits. Alle drei starben in einem Krieg. Ich wundere mich, dass es mich überhaupt gibt. Ignaz war mein Ururgroßvater. Er starb in der Schlacht bei Weißenburg im deutschfranzösischen Krieg. Das Bajonett eines jungen Franzosen bereitete ihm das Ende. Er sah es noch kommen, bevor die am Gewehrlauf aufgepflanzte Klinge sein Auge durchbohrte und tief in sein Gehirn eindrang. Er war sofort tot.
Mein Urgroßvater fiel im ersten Weltkrieg in der Schlacht um Verdun. Wieder die Franzosen. Ihn hatte es allerdings nicht so gut getroffen wie Ignaz. Urgroßvater Horst starb durch Schwefellost. Besser bekannt unter der Bezeichnung Senfgas, das in den letzten Jahren des Krieges mehr und mehr zum Einsatz kam. Und durch welches Horst, wie viele andere seiner Kameraden auch, qualvoll erstickte. Dabei hatte er seine Gasmaske – die zur Standard- Ausrüstung der Soldaten in den Schützengräben von Verdun gehörte – schon längst aufgesetzt. Allerdings hatte er beim Wechseln des Atemfilters vergessen, einen neuen Filter einzusetzen, und so atmete er das Gas ungeschützt ein und erstickte auf dem belgischen Schlachtfeld.
Opa Otto starb im nächsten großen Krieg, dem zweiten Weltkrieg. Oma hatte oft und viel davon erzählt. Wie genau er allerdings ums Leben kam, blieb ein Rätsel. Er kämpfte an der Ostfront in Russland, und vermutlich starb er an Hunger und Unterkühlung. Erfroren in Eis und Schnee der harten russischen Winter, denn er kam nie in Stalingrad an. Soviel war bekannt.
Aber zurück zu meinem Namen. Was meine Eltern oder besser gesagt mein Vater sich bei meiner Geburt dabei gedacht hatte – er entschied das alleine –, kann ich nicht sagen. Entweder war er betrunken oder er wollte mich gleich zu Beginn meines Lebens bestrafen. Oder beides. Das konnte er gut, der alte Herr. Saufen und Strafen verhängen.
Meine Mutter weinte tagelang, als sie von der Namensgebung erfuhr. Die drei Namen hatte mein Vater ganz klammheimlich, ohne Mutters Wissen, in das Stammbuch eintragen lassen.
Als dann die Krankenschwester mit mir auf dem Arm ins Zimmer der Entbindungsstation trat und freudestrahlend meinte: Hier ist der kleine Ignaz-Horst-Otto, war Mutter völlig entsetzt. Sie beharrte darauf, dass es sich bei dem Kind um eine Verwechslung handeln müsste. Ihr Junge hätte nicht so einen selten dämlichen Namen. Genau das sagte sie spontan. Richtig intensiv wird sie sich damals in der Zeit nach meiner Geburt nicht mit mir beschäftigt haben, sonst hätte sie doch erkannt, dass es sich um ihren eigenen Sohn handelte und nicht um eine Verwechslung. Ich meine, selbst im Alter von ein oder zwei Tagen, kann man Säuglinge doch unterscheiden.
Nachdem mein Vater meine Mutter dann von der Richtigkeit des Kindes und des Namens überzeugt hatte, war mein Name und damit ich – keine zwei Tage nach meiner Geburt – das Streitthema der kommenden Jahre. Später dann, nachdem ich langsam begriffen hatte, was mein Vater mir damit antat, suchte ich nach einer Möglichkeit diesen Namen loszuwerden. Ich überlegte hin und her, und irgendwann kam ich auf die glorreiche Idee, einfach die Anfangsbuchstaben meiner Vorfahren zu nutzen, um daraus Iho zu formen.
Mutter küsste mich ohne Unterlass, als ich ihr die rettende Idee mitteilte. Und sie ließ von dem Augenblick an keine Situation ungenutzt, um mich – im Beisein meines Vaters – mit dem neugewonnenen Namen anzusprechen. Sie betonte ihn bewusst provokant, und ich wurde erneut Anlass und Mittelpunkt ihrer Streitigkeiten. Mir war es egal. Ich war nun Iho.
Und als Iho steckte ich zehn Jahre später in ernsthaften Schwierigkeiten.
Ich kämpfte um mein Leben, denn ich war kurz davor zu ersticken. Sollte das wirklich mein Ende sein? Sterben, in so jungen Jahren? Panik überkam mich, und mir wurde schwarz vor Augen. Durchhalten!
Aber das war leichter gesagt als getan, denn ich bekam keine Luft mehr, und mir wurde übel. Atemnot! Meine Augen brannten von dem dichten, beißenden Qualm. Ohne mir den Pullover vor Mund und Nase zu halten, hätte ich es gar nicht mehr ausgehalten.
Wie machen die anderen das nur? Die sitzen noch ganz ruhig da, obwohl der Innenraum des Autos schon so verqualmt ist, dass man nicht mehr nach draußen sehen kann.
Wie halten die anderen das hier drinnen aus? Meine Lunge brennt, und mit jedem Atemzug wird es schlimmer und das Atmen schwieriger.
Aber ich wollte unter gar keinen Umständen der Erste sein. Kein Weichei. Kein Loser. Sie würden mich dann in den nächsten Tagen immer wieder aufsuchen. Sie würden keine Gelegenheit auslassen, um mich wieder zu beschimpfen und wahrscheinlich auch zu ohrfeigen, auf mich einzuprügeln und über mich zu lachen.
So wie beim letzten Mal, da war ich aus Versehen mit meinem Fahrrad durch ihr Revier gefahren, und sie hatten mich verfolgt. Drei ausländische Jungs, älter und größer und auf ihren Fahrrädern viel schneller als ich.
Eigentlich waren sie cool. Man durfte nur nicht gegen ihre Regeln verstoßen oder sie sonst irgendwie reizen. Dann konnte man ganz gut mit ihnen zurechtkommen. Und das musste man in unserem Viertel auch, denn dort herrschte Kriminalität und Gewalt. Es bestand aus schäbigen Wohnblocks, in denen Menschen aus der sogenannten Unterschicht eine Bleibe fanden. Die Sozialschwachen, mit einem hohen Ausländeranteil. Das Viertel galt als sozialer Brennpunkt. Alkohol und Drogen standen auf der Tagesordnung sowie Überfälle auf alte Damen, denen man die Handtaschen klaute. Und vor dem Supermarkt stand ständig ein Polizeiwagen, weil man wieder einmal jemanden beim Klauen erwischt hatte. Am Kiosk kam es Abend für Abend zu Streitigkeiten zwischen den Säufern und Pennern, die dort ständig herumhingen und das billige Bier in sich hineinschütteten.
Für meinen Vater waren die Ausländer am schlimmsten und an allem schuld. Er schimpfte über die Kopftücher der türkischen Frauen und geriet regelmäßig in Wut, wenn die Großfamilien im Sommer abends draußen auf dem Rasen saßen und Lamm grillten. Er schrie sie dann oft vom Balkon aus an, dass sie sich zurück in ihre Heimat verziehen sollten und schmiss mit irgendwelchen Dingen, die er gerade in die Finger bekam, nach ihnen. Wenn ich ihm dabei zu sah und er mich bemerkte, dann grinste er mich von oben an und tat so, als wäre es ein Spiel. Aber nur ganz kurz. Sobald er die da unten wieder im Visier hatte, änderte sich sein Gemütszustand erneut auf „Aggression“. Ich verstand diesen Wechsel seiner Emotionen nie. Er war in allen Belangen ein Rätsel für mich. Vielleicht war er auch nur zu oft unter dem Einfluss von Alkohol. Wie dem auch sei. Wir waren ständig in Konflikt. Vater und ich untereinander und wir beide gegen die Bande dort draußen.
Wenn man wie ich noch zusätzlich klein und schwach war, hatte man schlechte Karten. Man war immer und überall irgendwelchen Attacken ausgesetzt. Dauerstress.
Ich war also damit beschäftigt, um mein Leben zu radeln, denn ich hatte gegen eine ihrer Regeln verstoßen. Nachdem mir bewusst geworden war, dass ich Mist gebaut hatte und sie hinter mir her waren, war ich so heftig in die Pedale getreten, dass meine Beine schon nach wenigen Metern anfingen zu schmerzen und zu brennen.
Ich ignorierte die Schmerzen, und ich ignorierte meine Schwäche. Vermutlich half mir dabei mein durch Angst ausgelöstes körpereigenes Adrenalin. Aber es nützte nichts. Sie holten mich ein und drängten mich ab, sodass ich mit dem Lenkrad meines Rades an einem Zaun hängenblieb und stürzte.
Das war‘s.
Der eine von ihnen, der Anführer dieses Trios, verpasste mir gleich eine Ohrfeige.
»Was sollte das denn, du kleiner Wichser?! Was hast du über unseren Platz zu fahren, hä?«
Und dann bekam ich auch schon die zweite Ohrfeige. Die anderen beiden Jungen traktierten mich mit schmerzhaften Tritten, und ich wusste nicht, wie ich mich schützen sollte. Ich wollte das nicht. Viel lieber hätte ich zu ihnen gehört, als mich jetzt verprügeln zu lassen.
Ich hatte Angst, wollte aber nicht ängstlich oder feige wirken. Ich wollte einfach nur irgendwie aus dieser Situation rauskommen. Niemand mochte als Junge von älteren Jungs verprügelt werden.
»Hört doch auf, bitte!«
Ich flehte und bettelte wie ein Mädchen, nur um mich aus dieser Situation zu befreien, und ich schämte mich augenblicklich für meine jämmerliche Art. Das wollte ich noch viel weniger, als von ihnen verhauen zu werden. Es kam einfach aus mir heraus. Ein Impuls. Der klägliche Versuch meine Haut zu retten. Er scheiterte und machte mich vor ihnen nur noch kleiner, als ich ohnehin schon war.
»Du Waschlappen! Seht euch das Opfer an!«
Wieder bekam ich eine Ohrfeige, und mein Kopf flog unkontrolliert zur Seite. Sie äfften mich nach, machten sich über mich lustig, amüsierten sich.
»Hört doch auf, bitte. Buääh. Heul doch!«
Sie lachten laut und gehässig, und ihr Anführer schlug mich erneut, während die beiden anderen die Ventile aus den Reifen meines Rades drehten und die Luft rausließen. Sie lachten alle drei wieder, meinten, dass ich ein kleiner Scheißer wäre, eine deutsche Kartoffel und doch besser zu Mutti laufen sollte. Ich sah runter auf den Boden. Zum einen, weil ich mich schämte und Angst hatte. Zum anderen, um den Schlägen zu entgehen. Es war die Haltung eines Gedemütigten, in der ich verharrte.
Als der Anführer mich auf einmal anschrie, dass ich ihn gefälligst ansehen sollte, hörte das Gelächter der anderen sofort auf. Jetzt bekam ich richtig Angst, meine Knie begannen heftig zu zittern, und aus dem Augenwinkel sah ich, dass der Anstifter mächtig wütend aussah. Ich bekam es kaum mit, als er mir mit der Faust ins Gesicht schlug. Er war viel zu schnell in seinen Bewegungen. Ich konnte dem Schlag nicht ausweichen. Dieses Geräusch, als seine Faust mein Auge traf … ein fauler Apfel, der mit hoher Geschwindigkeit auf eine Wand trifft.
Dann wurde es angenehm dunkel. Ich fiel in ein riesiges, schwarzes Nichts.
Als ich wieder zu mir kam, waren sie weg und meine Hose auch. Ich musste erstmal warten, bis ich mich wieder zurechtfand und erkannte, wo ich war und was passiert war.
Ich hatte Blut im Mund, viel Blut. Durch die Dauer der Ohnmacht war es halb geronnen und verklebte mir die Mundhöhle. Ein riesiges Karamellbonbon mit Blutgeschmack. Ich hätte mich fast übergeben. Mein linkes Auge war zugeschwollen und schmerzte heftig. Ich spürte meinen Puls in der Augenhöhle, und die Haut spannte von der Wange bis zur Braue. Es hätte mich nicht gewundert, wenn alles wie eine überreife Tomate aufgeplatzt wäre.
Ich wollte nicht, dass mich jemand in dieser kläglichen Situation ohne Hose sah. Das wäre der Gipfel der Erniedrigung gewesen. Ein schales Gefühl von Einsamkeit und Selbstmitleid gesellte sich zum Geschmack von Blut.
Es konnte jederzeit jemand vorbeikommen, schließlich war es ja ein Wohngebiet. Was ich bräuchte war ein Loch, das sich auftat und in dem ich einfach verschwinden könnte. Und wo befand sich meine Hose? Alles drehte sich. Ich hatte Schmerzen. Es war kalt, und ich kämpfte mit den Tränen. Schließlich fand ich meine Cordhose, sie war an den Rahmen meines demolierten Rades angeknotet. Ich kroch auf allen Vieren, wie ein Hund mit Hüftleiden, immer in der bangen Angst von irgendjemandem gesehen zu werden.
Mein Rad? Ich liebte dieses Rad, und jetzt war es nur noch ein Haufen Schrott.
Sie hatten es komplett zertreten. Vorn und hinten waren die Felgen verbogen, und einzelne Speichen ragten wie kleine Antennen in die Luft. Der Lenker war abgebrochen, und der Sattel steckte verkehrt herum aufgespießt auf der Sattelstange. Es war ein jämmerlicher Anblick. Ich brauchte eine Ewigkeit, um meine Hose von dem Rahmen abzubekommen.
Ich sah mich immer wieder um und weinte. Zum Glück kam in dieser Zeit niemand vorbei.
Nachdem ich meine Hose wieder angezogen hatte, machte ich mich auf den Weg nach Hause. Wie ein geprügelter Hund. Mein Fahrrad musste ich tragen. Schieben oder fahren ging ja nicht mehr. Aber ich wollte es da nicht liegen lassen, obwohl ich wusste, dass es Schrott war. Das war für mich so, als würde man einen Freund zurücklassen. So wie in den Western, wenn der angeschossene Cowboy sagte: Lass mich hier liegen, reite du weiter. Ich werde die Indianer aufhalten und der andere Cowboy wusste, dass sein Freund sterben würde, ihn aber trotzdem nicht zurückließ. So war das mit dem Rad. Ich trug es unter Schmerzen auf dem Rücken nach Hause. Und ich musste weit gehen. Mit dem Rad waren die Strecken in der Siedlung kurz, aber zu Fuß mit zwanzig Kilo auf dem Rücken? Es war eine Tortur, ich hatte diese unerträglichen Schmerzen im Gesicht, in den Rippen und in den Hoden. Ich konnte kaum laufen, aber ich schaffte es bis nach Hause.
Dass ich dann von meinem Vater auch noch Schläge bekam, als er mich und mein Rad in dem Zustand sah, überraschte mich nicht. Es war mir schon egal, wie hieß es so schön: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Mein Vater brüllte donnernd, dass ich ein kleiner Feigling wäre.
»Warum kannst du dich nicht wehren? Du bist doch kein Mädchen, oder doch? Und sag mir nicht, dass das wieder diese ausländischen Blagen waren?«
Was sollte ich darauf antworten? Dass sie zu dritt waren und mindestens vier, fünf Jahre älter als ich? Solche Argumente zählten bei meinem Vater nicht. Mein Vater war da anders. Er hätte es mit Dreien aufgenommen. Ein Baum von einem Mann. Er war stark. Mächtig. Er war jahrelang in der Armee gewesen, hatte dort geboxt, und die errungenen Medaillen hingen bei uns zu Hause im Flur. Damit jeder, der zu uns kam, sofort wusste, mit wem er es zu tun hatte.
Selbst der Weihnachtsmann, der einmal versehentlich am Heiligabend bei uns klingelte – er wollte die drei Kinder in der Wohnung über uns beschenken und hatte sich in der Etage geirrt –, musste sich seine Heldentaten und Geschichten über vorzeitige K.O.- Siege anhören, bevor er wieder gehen durfte, um seinen Job zu erledigen.
Mein Vater hätte diesen drei Jungs die Hosen ausgezogen und sie so sehr vertrimmt, dass sie dergleichen nie wieder gewagt hätten. Ich nicht. Ich war schwach, und mein Vater hasste mich dafür. Ich war nicht wie er, und das würde ich auch nie werden.
»Du bist wie ein Mädchen. Nein, du bist ein Mädchen. Hast du überhaupt Eier?« fragte er mich dann immer.
Behandelte man seinen einzigen Sohn auf diese Art und Weise? Ich hasste ihn dafür.
»Und du willst mein Sohn sein? Ich glaube, ich muss mich mal mit deiner Mutter unterhalten. Die weiß da vielleicht etwas, was ich nicht weiß!«
So war das. Rad weg. Prügel bekommen. Auge dicht. Denunziert vom Vater. Meine Kindheit eben. Nicht sehr schön, aber ich dachte daran, dass irgendwo auf dieser Welt andere Kinder lebten, denen es noch schlechter ging als mir. das half ein wenig. Ich kannte es nicht anders. Ich war so aufgewachsen.
Und jetzt saß ich mit den gleichen drei Typen – die mich verprügelt hatten, nur weil ich über ihr Territorium gefahren war – in dem alten Autowrack bei den schäbigen Garagen am Rand unserer Wohnsiedlung. Eine Zigarette nach der anderen rauchend, bis die Karre so zu geräuchert war, dass man die Hand nicht mehr vor Augen sah und man keine Luft mehr bekam.
Es war eine Mutprobe. Eine Aufnahmeprüfung. Ich war gerade von der Schule gekommen, als die drei dort am Auto standen. Mein Schulweg führte an den Reihen von Garagen entlang, dann durch den angrenzenden Wald, bis hinunter zu unserer Schule. Und als ich nun ankam, sahen sie mich und kamen auf mich zu.
Wegrennen war keine Option. Also ließ ich es und versuchte meine Angst vor ihnen zu überspielen, indem ich sie grüßte.
Das „Moin Jungs“ klang total bescheuert, und ich bereute es sofort.
Moin Jungs? Was sollte das denn? Diese Idioten haben dich vor kurzem so durch den Dreck gezogen, und du grüßt mit „Moin Jungs“!?
Es war egal, es war zu spät. Sie kamen direkt auf mich zu. Aber zu meiner Verwunderung waren sie nett zu mir. Sie grüßten mit einem „Moin Moin“ zurück, und dass sie dabei verstohlen lachten, fiel mir nicht auf. Sie stellten sich sogar vor und entschuldigten sich für die letzte Aktion, aber ich blieb dennoch skeptisch und aufmerksam. Dann fragten sie mich, ob ich bei ihnen „mitmachen“ wollte. Na klar wollte ich! Was für eine Frage. Dann wäre ich ja endlich in Sicherheit, müsste nicht ständig Angst vor ihnen haben, und alles wäre super. Und verprügeln würden sie mich auch nicht mehr. Dachte ich.
»Du musst allerdings erst beweisen, dass du wirklich dazugehören darfst und dich mit uns da drüben ins Auto setzen. Wenn du den Wagen nicht als erster verlässt, gehörst du dazu.«