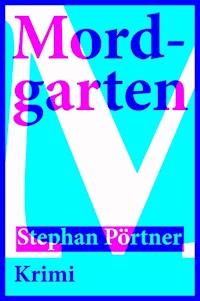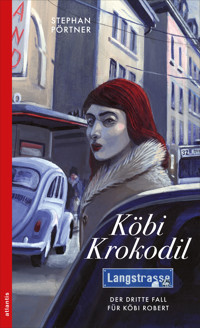9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Aisatore
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Köbi Krimis
- Sprache: Deutsch
Köbi Robert, der alles andere als dynamische Detektiv, gerät wieder einmal in einen Kriminalfall: Ausgerechnet sein alter Kumpel und temporärer Arbeitgeber, der herzensgute Bruno, soll ein Mörder sein. So gerät Köbi von der idyllischen Zürcher Langstrasse ins wilde Regensdorf und an den noblen Zürichberg. Die Spur des ermordeten Anlageberaters führt durch Bankfilialen, Angeberlokale, Fitnesscenter und Bauernhöfe. Köbi, der arbeitslose Held, hat es dabei nicht leicht die Übersicht zu behalten, auch wenn ihn die flotte Mónica, der verlumpte Wiener und ein schwarzer Anzug dabei unterstützen. So fliesst noch viel Wasser die Sihl und Bier die Kehlen hinunter, ehe Licht in die Sache kommt. "Kein Konto für Köbi" ist ein Kriminal- und ein urbaner Heimatroman. Eine Momentaufnahme jener Zürcher Thirty-somethings mit verblassender Vergangheit und unsicherer Zukunft. Ein unromantischer Blick auf das Zürcher Langstrassenquartier, seine düsteren und hellen Seiten und auf die sich teils überlappenden, teils ausschliessenden Lebensstile in der Stadt: Alkohliker, Anlageberater, Arbeitslose, Angeber und Anverwandte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Stephan Pörtner
Kein Konto für Köbi
Alle Rechte vorbehalten
erschienen im Krösus Verlag Zürich, 2000
3.Auflage
© 2014 Edition Aisatore
ISBN 978-3-906247-01-4
Covergestaltung: Christian Theiler
www.stpoertner.ch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Ich musste eine Weile suchen, ehe ich das Büro des Anwalts fand. Rothenbühler, den Namen hatte ich noch nie gehört.
Er hingegen kannte mich oder hatte zumindest meine Telefonnummer. Wahrscheinlich kannte er nur meine Nummer, sonst hätte er mich nicht frühmorgens um acht Uhr angerufen. Die Angelegenheit sei dringend und lasse sich nicht am Telefon besprechen.
«Kommen Sie bitte um halb zehn in mein Büro», hatte er gesagt und mir die Adresse gegeben.
«Gut, dann komme ich halt um halb zehn», hatte ich verschlafen gemurmelt und verzweifelt nach einem Stift gesucht, um den Straßennamen, der mir schon wieder zu entwischen drohte, festzuhalten. Ich schaffte es gerade noch.
Rothenbühlers Büro befand sich in meiner Nähe, beim Idaplatz, an einer jener Straßen, von denen man den Namen kennt, aber nie so genau weiß, wo sie sich befinden, weil man dort nichts zu suchen hat. Es war fünf nach halb, als ich vor der Bürotür im dritten Stock eines Altbaus stand.
«Bitte läuten und eintreten», stand auf einem kleinen Aluminiumschild über einem weißen Knopf. So läutete ich und trat in eine Art Vorzimmer, das nicht sehr groß, aber ziemlich hoch war. Vor dem Fenster stand eine verstaubte Grünpflanze, links und rechts davon waren zwei graue Aktenschränke. Eine junge Frau saß hinter einem Schreibtisch und telefonierte. Sie sah irgendwie ungesund aus. Vielleicht lag es auch an dem ausgesucht hässlichen Teppich oder an der Atmosphäre des Raumes. Alles sah alt und abgenutzt aus, als hätte es jemand hier stehen lassen, statt auf den Flohmarkt zu bringen.
«Einen Moment bitte», sagte die Frau in den Hörer und drückte einen Knopf an ihrem Telefon. Der Apparat sah durchaus modern aus.
«Herr Robert?»
Ohne auf mein Nicken zu warten, wies sie mit dem Kopf nach rechts zu einer Tür, die einen Spalt weit offen stand. Ich ging hinüber und klopfte an den Türrahmen.
«Ja?», rief es von drinnen und ich ging hinein. Fast wäre ich dabei mit einem Mann zusammengestoßen. Es war der Anwalt Rothenbühler, wie sich herausstellte.
«Hoppla», sagte er und bat mich, Platz zu nehmen. Er wirkte zerstreut und abwesend. Sein Alter war schwer zu schätzen, vielleicht war er gleich alt wie ich, Mitte dreißig, vielleicht aber auch zehn Jahre älter. Er hatte halblange, strähnige Haare, sein Gesicht war lang und schmal, die Haut schimmerte weißlich-gelb. Auf der spitzen, schmalen Nase trug er eine runde, breitrandige Brille. Die Gläser waren dick, richtige Flaschenböden. Er hatte einen grauen Wollpullover und braune Manchesterhosen an. Auf dem Tisch stand ein Aschenbecher, der schon ziemlich voll war.
Rothenbühler setzte sich an den Schreibtisch und griff nach seinen Zigaretten.
«Stört es Sie?» Ich schüttelte den Kopf, er steckte sich eine Gauloise blau ohne Filter an.
«Ich nehme an, Sie haben schon von der Sache mit Bruno gehört?»
«Welcher Bruno?»
«Bruno Krämer. Er wurde verhaftet.»
«Bruno? Warum denn das?»
«Mord!»
Ich sagte nichts mehr, sondern schaute diesen seltsam vogelhaften Mann an, der auf seinem Schreibtisch herumfuhrwerkte. Durch die Brillengläser waren die Augen nur verschwommen zu erkennen. Vielleicht war er doch eher Fisch als Vogel.
«Ja», sagte er ungerührt. «Vor zwei Tagen. Das Tötungsdelikt Baumann.»
Er sah mich an, soweit ich das erkennen konnte. Die Asche fiel von seiner Zigarette, er nahm einen Zug, hob mit der rechten Hand das Papier, auf dem die Asche lag und kippte sie in den Papierkorb. Eine Übung, die er routiniert, quasi blind ausführte. Ich sagte noch immer nichts. Da nicht anzunehmen war, dass er mich herbestellt hatte, um Schabernack mit mir zu treiben, war das, was er mit da erzählte, wohl die Wahrheit. Auch wenn es unmöglich war.
«Sie sind doch ein Freund von Bruno, nicht wahr?»
Ich nickte. Der Anwalt lehnte sich in seinem quietschenden Bürosessel zurück, dessen schwarzes Leder brüchig und abgeschabt war. Es hätte mich nicht gewundert, wenn das Ding zusammengekracht wäre.
«Ich auch, von früher.» Er wedelte mit der Hand vor seinem Gesicht. Ob er Rauch oder Erinnerungen vertreiben wollte, war nicht klar. «Von früher» hieß wahrscheinlich, dass sie schon länger nichts mehr miteinander zu tun hatten, sonst hätte er wohl «seit langem» gesagt.
«Baumann Werner, wohnhaft in Regensdorf, erschlagen am letzten Samstag, so gegen elf Uhr nachts.»
Sein verschwommener Blick ruhte auf mir, er wirkte jetzt wie ein Papagei, der etwas gesagt hat und mit schrägem Kopf auf Anerkennung wartet.
«Der Neue von Brunos Ex-Frau Rita.»
Er drückte seine halbgerauchte Zigarette aus, nahm eine neue aus der Packung und steckte sie an.
«Oh, excusez, wollen Sie auch eine?», fragte er unvermittelt, als wäre ihm etwas Wichtiges eingefallen, das Licht in die Sache bringen würde. Ich bejahte, obwohl ich eigentlich nicht rauchte, außer selten, aber nie am Morgen und schon gar keine Gauloises. Aber vielleicht brachte das ja wirklich Licht in die Sache.
«Bruno ist wie gesagt verhaftet worden, am Montagmorgen. Ich habe ihn gestern kurz gesehen. Es schaut schlecht für ihn aus. Er hat mir aufgetragen, Sie anzurufen und Sie zu bitten, der Sache nachzugehen, herauszufinden, wer es gewesen ist. Er, so sagt er, sei unschuldig.» Rothenbühler neigte sich über den Schreibtisch und gab mir mit einem Feuerzeug aus Blech Feuer.
Ich nahm einen tiefen Zug und mir wurde schwindlig.
«Aber eben, er hat ein Motiv und kein Alibi. Zu Hause will er gewesen sein, und ferngesehen will er haben. Irgendeine Quizsendung, wie er sagt, aber genau erinnert er sich nicht mehr. Nun ja, Promille hatte er auch am Montag noch genug.» Wir rauchten beide konzentriert. Ich hatte mit einem Mal das Bedürfnis, mich wieder hinzulegen. Wahrscheinlich die Wirkung des Nikotins.
«Monika hat eine Kopie meiner Unterlagen für Sie bereit, viel ist es nicht. Rufen Sie mich an, wenn es etwas Neues gibt. Ich werde dasselbe tun.» Er stand auf. Ich stand ebenfalls auf, und wir gingen gemeinsam aus dem Büro.
«Monika», wandte er sich an die junge Frau, die gelangweilt auf ihren Bildschirm schaute und mit einem Finger rhythmisch auf eine Taste ihres Keyboards schlug, «gib ihm das Dossier Krämer.»
Sie zog die unterste Schublade ihres Schreibtischs auf und griff, ohne richtig hinzuschauen, eine dünne Aktenmappe aus der Hängeregistratur. Rothenbühler nahm sie und gab sie an mich weiter. Er war wieder ganz Goldfisch.
«Schlimme Sache», sagte er seltsam unbeteiligt. «Es liegt jetzt an Ihnen, etwas daraus zu machen. Viel Glück, Herr Robert.» Er lächelte gequält, zögerte einen Moment, nickte schließlich und sagte noch einmal: «Viel Glück.» Offenbar war er auch kein Freund des Händeschüttelns.
«Danke», sagte ich. Ich sage immer danke, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, auch in den unpassendsten Situationen. Die Frau hinter dem Schreibtisch schaute weiterhin gelangweilt auf den Bildschirm, ohne jedoch die Tastatur zu malträtieren.
Ich raunte ihr ein «Widerluege» zu und verließ das Büro mit der Kartonmappe in der Hand.
Draußen auf der Straße fiel mir dann der Himmel auf den Kopf.
Ich hatte Bruno mehr als ein halbes Jahr nicht mehr gesehen, seit ich nicht mehr für ihn arbeitete. Seit ich überhaupt nicht mehr arbeitete. Nach einer unerfreulichen Geschichte, in die ich verwickelt gewesen war, hatte ich einige Monate bei meinem alten Freund Bruno Krämer ausgeholfen. Allerlei Bausachen. Wir waren dabei, ein Einfamilienhaus zu renovieren. Da geschah es: Seine Frau, die schöne Rita, verließ ihn, und seine Welt krachte zusammen.
Er erzählte nicht viel darüber, und ich fragte auch nicht viel, wie das eben so ist unter Männern. Dafür half ich ihm beim Austrinken seines Weinkellers. Wir saßen oft und lange bei ihm oder in der Quartierbeiz, tranken und redeten über alles Mögliche, aber nur selten über das, was wirklich los war. Wobei bei mir nicht viel los war, außer dass ich plötzlich umziehen musste.
Rita war auch umgezogen und die Kinder mit ihr. Bruno sah seine beiden goldigen Töchter nur noch jedes zweite Wochenende, was ihm fast das Herz brach. Irgendwann brach er sich auch noch den Fuß und musste die Arbeit einstellen. Da er die Firma war, wurde ich arbeitslos. Er stellte mir aber alle nötigen Zettel aus, damit ich stempeln gehen konnte. Wir mussten ein wenig daran drehen, damit ich zu meinen paar Kröten kam. Das Geld reichte für die Miete, die Krankenkasse und viele Sonderangebote, was wollte man mehr. Seither war die Zeit schnell vergangen, und ich hatte nichts mehr von Bruno gehört.
Ich setzte mich ins Café Memphis, um die Akte zu studieren.
«Krämer Bruno, Mord» stand darauf. Darin befand sich eine Kopie des Polizeiprotokolls.
Das Opfer war in Regensdorf, zweihundert Meter von seiner Wohnung entfernt, aufgefunden worden. Tatzeit war die Nacht vom fünften auf den sechsten September, ungefähr 23.20 Uhr. Erschlagen mit einem stumpfen Gegenstand. Zeugen gab es keine. Das war nicht gerade viel, eigentlich war es gar nichts. Es folgten noch die Personalien des Opfers, ein paar Angaben zu Bruno und die Zeit seiner Verhaftung. Ich klappte den Deckel der Mappe zu und stützte meinen Kopf in die Hände. Warum zum Teufel wollte Bruno, dass ich der Sache nachging? Vermutlich weil er es nicht getan hatte.
Er hatte erlebt, wie ich einmal den Mörder eines Freundes gefunden hatte, aber das war doch kein Grund, anzunehmen, dass ich grundsätzlich in der Lage war, Mörder zu finden. Damals war ich persönlich in die Sache verwickelt gewesen und hätte wohl keine Ruhe mehr gehabt, wenn ich den Fall nicht gelöst hätte.
Ich fluchte vor mich hin. Mir wäre das bestimmt nicht passiert, nicht zu wissen, welche Quizsendung am Abend des Mordes gelaufen war. So ein Blödsinn. «Wetten dass..?» ist doch ganz etwas anderes als «Die 100'000 Mark Show» oder «Traumhochzeit» oder gar «Benissimo». Es war «Benissimo» gewesen, ich hatte es in meinem kleinen rachitischen Küchenfernseher gesehen. Die grüne Kugel hatte gewonnen. Eine geschiedene Hausfrau aus Giswil hatte eine Million gewonnen und geweint vor Freude, das wusste man doch einfach. Ich fluchte erneut, aber es half nichts. Was blieb mir übrig, als mich zusammenzunehmen und zu tun, was einer, der etwas herausfinden will, halt so tut.
Ich ging über die Badenerstrasse zur Tages-Anzeiger-Zentrale und ließ mir die Ausgaben seit Montag geben. Eigentlich wollte ich sie bei einem Bier durchlesen, entschied mich dann aber anders und ging nach Hause. Mit einem Kaffee setzte ich mich an den Küchentisch. Ich erinnerte mich, in der NZZ etwas gelesen zu haben, eine einspaltige Notiz, die ich nicht weiter beachtet hatte.
Auch im Tages-Anzeiger stand nicht viel mehr unten rechts auf der ersten Seite Region-Zürich. Ein Toter, vermutlich ein Gewaltdelikt, die Polizei bittet allfällige Zeugen um Mithilfe und so weiter und so fort. Am Dienstag war bereits die Todesanzeige erschienen. «Aus dem Leben gerissen», «unfassbar» und solche Sachen. Unterschrieben von den Verwandten des Verstorbenen. Ritas Name stand nicht darunter. Die Beerdigung war heute, Donnerstag, um 14.30 Uhr. Ich fluchte schon wieder.
Erstens war das schon in zwei Stunden und zweitens genau dann, wenn ich stempeln gehen musste. Rasch blätterte ich auch die Mittwochsausgabe durch. Von der Verhaftung Brunos stand nichts drin, aber weiter hinten gab es noch mal zwei Todesanzeigen. Eine von Rita und eine von den Kollegen der Kantonalbank Regensdorf. Die von Rita war kurz und ergreifend, die der Bank kurz und trocken.
«Also dann», dachte ich und trank den Kaffee aus, «gehe ich eben auf die Beerdigung und lasse das Arbeitsamt Arbeitsamt sein.»
Wenn ich schon wieder nicht kam – ich hatte letzten Monat aus reiner Idiotie den Termin vergessen – musste ich mit Abzügen, eventuell gar mit einem Beratungsgespräch rechnen.
Doch was sein musste, musste sein. Bruno hatte viel für mich getan, jetzt konnte ich mich revanchieren. Ich ging in mein Schlafzimmer und wühlte im Schrank nach passender Kleidung. Da war ja mein schwarzer Leinenanzug, den ich einmal zum stolzen Preis von einundvierzig Franken gekauft hatte, beim Ausverkauf im Jelmoli, als die Lämpchen blinkten und alles nur noch die Hälfte des bereits heruntergesetzten Preises kostete. Seither hing er in meinem Schrank, denn ich war noch nirgendwohin gegangen oder eingeladen worden, wo er angebracht gewesen wäre. Ihn dorthin anzuziehen, wo ich normalerweise hinging, dazu war er mir zu schade. Ich war schon lange auf keiner Beerdigung mehr gewesen, und diese zählte nicht richtig, weil ich den Verstorbenen nicht gekannt hatte.
Ich fand meine schwarzen Halbschuhe, die allerdings enorm abgelatscht waren. Mit Schuhwichse brachte ich sie in annehmbaren Zustand. Das einzige saubere Hemd, eines von dreien, war knallgelb und deshalb irgendwie unpassend. Zudem verfügte ich nur über eine Krawatte, und auf der prangte Spiderman, also zog ich einen grauen Rollkragenpulli an. Als ich gehen wollte, begann es zu regnen. Ich schnappte mir den Feldschlösschen-Schirm, den mir die netten Frauen im Quartierladen geschenkt hatten, und raste davon. Ich kehrte aber gleich wieder um und suchte die Zeitung wegen der Adresse des Friedhofs. Gütiger Himmel, er wurde in Weiningen beerdigt. Ich fluchte, was sonst, und lief die Lagerstraße entlang zum Hintereingang des Bahnhofs. Es war bereits halb zwei Uhr vorbei, und es gab keinen Zug, der mich innert vernünftiger Frist nach Weiningen gebracht hätte. Es gab genau genommen überhaupt keine Züge nach Weiningen.
Ich kontrollierte mein Portemonnaie, es war nicht viel drin. Also den Perron entlang bis ins Shop-Ville gehetzt, 200 Franken aus dem Postomat gezogen und rauf an den Taxistand. Ich gab knappe Anweisungen und setzte mich auf den Rücksitz. Mir war unterdessen wieder eingefallen, dass die schwarzen Schuhe ein Loch in der Sohle hatten, und ich sie darum nie mehr trug. Höchste Zeit, sie ebenfalls zu beerdigen. Gemäß einer Frauenzeitschrift trennten sich Männer niemals von ihren Schuhen, sodass es zu den Pflichten der guten Ehefrau gehörte, die Dinger zu entsorgen, auch wenn der Gatte dann ein paar Tage grollte.
Der Fahrer hielt den Rand, wahrscheinlich, weil ich schwarz gekleidet war und einen Friedhof als Ziel angegeben hatte. Das Taxameter tickte unerbittlich, und ich musste fortlaufend mein ausgewogenes Monatsbudget korrigieren. Auf dem Speiseplan tauchte plötzlich viel Reis auf. Die Fahrt dauerte lange, weil an der Stampfenbachstraße gebaut wurde. Die Suche nach dem evangelischen Friedhof dauerte fast noch länger, weil wir erst den falschen, den katholischen, ansteuerten. Die Begräbnisstätte lag hinter der Kirche, war klein und übersichtlich. Die Trauergemeinde stand schon ums frisch ausgehobene Grab. Der Himmel war grau, es fing zu nieseln an, richtiges Beerdigungswetter. Mein linker Fuß war nass, und ich fror. Es waren ziemlich viele Leute da, ein kleines Meer von Schirmen. Ich näherte mich unauffällig, nickte unbestimmt und betroffen in die Runde, sodass alle dachten, die anderen würden mich kennen. Dort war wohl die Bänklerfraktion: Wollmäntel, dunkle Anzüge, teures Schuhwerk, Brillen mit Goldrand. Die braun gebrannten Männer mit den kantigen Kinnen kamen vielleicht vom Sportverein. Das graue, ältere Volk, bieder und unauffällig, war wahrscheinlich die Familie. Zivilpolizei war keine da, oder ich erkannte sie nicht. Den ersten Kranz schickt immer der Mörder, dachte ich. Bei der Mafia zumindest sei es so, hatte ich einmal gelesen. Es waren vier Kränze da, aber ich war nicht nahe genug, um die Bandaufschriften zu lesen. Außerdem wusste ich ja nicht, in welcher Reihenfolge sie angekommen waren.
Dann endlich sah ich Rita. Sie stand alleine und wie versteinert neben dem Grab. Ihre Kinder waren nicht da.
Der Pfarrer begann zu reden, eine kurze Ansprache, ein Gebet, der übliche Zinnober. Der Sarg wurde mit Hilfe eines Bändermechanismus’ langsam in die Grube gelassen, niemand weinte. Der Pfarrer bat die Gemeinde zur Abdankung in die Kirche. Ein Zug formierte sich, am Grab und an der reglosen Rita vorbei, während die Totengräber die Erde hineinwarfen.
Ich wartete, bis alle fort waren, und ging zu ihr hin.
«Rita …»
Sie schreckte auf, sah mich erstaunt an und warf sich an meine Brust. Sie weinte, sie schluchzte, sie brach zusammen. Ich hielt sie fest und wartete, bis es vorbeiging. Es ging aber nicht vorbei. Ich hatte meine Arme um sie gelegt und hielt auch noch den dummen Schirm, sodass mein rechter Arm beinahe dabei abbrach. Außerdem stand ich mit dem kaputten Schuh in einer Pfütze. Es war sehr ungemütlich, abgesehen davon, dass es mir schwer an die Nieren ging.
«Komm», sagte ich leise, «lass uns gehen.»
Sie reagierte nicht, wir standen weiter da, und ich versuchte, sie zu beruhigen. Sie tat mir unendlich leid, und ich war nahe dran, auch zu heulen, obwohl ich eigentlich keinen Grund dazu hatte.
Ich ging langsam los, schaffte es, sie aus dem Friedhof hinauszulotsen und wusste nicht weiter. Da stand ja noch das Taxi, mit dem ich gekommen war. So ein Hund, der witterte fette Beute. Was blieb mir anderes übrig, als einzusteigen und wieder zurückzufahren. Ich nannte meine Adresse, denn Rita war noch immer nicht ansprechbar.
«Ach Jakob», schluchzte sie hin und wieder, und ich wiegte sie in meinen Armen, schließlich weinte sie nur noch leise.
Wir kamen vor meinem Haus an, ich entlöhnte den Taxifahrer und war beträchtlich ärmer als vorher. Nun ja, es hätte auch der Zahnarzt sein können, dachte ich. Das wäre noch teurer und unangenehmer gewesen.
Ich fuhr mit Rita in meine Wohnung hinauf. Im Lift wurde mir bewusst, dass dort oben ein Gästen keineswegs zumutbarer Zustand herrschte. Aber jetzt war es zu spät, sich darüber Sorgen zu machen.
Ich half Rita, die Jacke auszuziehen. Sie trug ein langes, schwarzes Wollkleid und eine dünne Jacke. Um den Kopf hatte sie ein Tuch gewickelt, alles war durch und durch nass.
«Willst du nicht etwas Trockenes anziehen?», fragte ich, um etwas zu sagen und weil ich mir Sorgen machte, dass sie sich erkälten würde. Sie nickte, und ich ging ins Schlafzimmer, kramte ein Frotteetuch, ein paar Trainerhosen und einen Kapuzenpulli hervor. Mein schöner Anzug war auch nicht trocken geblieben, die Ärmel und die Hosenbeine waren vom Knie an abwärts durchgeweicht. Ich zog mich im Gang um. Vor allem drängte es mich, aus den vermaledeiten Schuhen zu kommen. Meine Waden waren schwarz, der gute Anzug färbte ab, die Tücke eines Ausverkaufsschnäppchens. In der Küche braute ich einen stärkenden Kräutertee. Im Frühling hatte ich mir eine große Kollektion zugelegt, als der Quartierladen die Tees zum halben Preis anbot. Hustentee, Wintertee, Wärmetee, die ganze Palette wohlschmeckender, aber sündhaft teurer Mischungen aus handgehätschelten, sonnenverwöhnten Pflänzchen. So stand es zumindest auf den Packungen.
In unseren klimatischen Zonen tut man gut daran, viel feinen Tee im Haus zu haben. Dann kann fast nichts mehr zustoßen, außer so Katastrophen, wie die, in die ich gerade geraten war.
Als ich den Tee eingoss, kam Rita in die Küche. Mein Gott, sah sie mitgenommen aus. Sie war eine zierliche, feingliedrige Frau, aber sehr vital, energisch fast. Unterdessen war sie wohl dreißig Jahre alt, sah jedoch jünger aus und hatte etwas Mädchenhaftes, Unberührtes. Jedenfalls war sie das hübscheste und archetypischste Hippiemädchen gewesen, das ich je gesehen hatte. Ihre langen, blonden Haare waren meist zu einem Zopf zusammengebunden gewesen. Unterdessen waren die Haare kürzer und rötlich getönt. Wahrscheinlich hatte sie die Frisur gewechselt, als sie ihr Leben geändert hatte. Ein immer wieder zu beobachtender Vorgang. Das mit dem alten Zopf abschneiden kam ja nicht von ungefähr.
Ihre Augen waren wasserblau und leuchteten. Früher verliebten sich alle sofort in sie, ich auch. Natürlich nicht so, dass sie es gemerkt hätte. Es war auch nicht wichtig, Jugend halt. Es war das Alter, in dem man sich in alles, was halbwegs weiblich und nett ist, verliebt und nie ankommt, immer verzweifelter wird, immer mehr trinkt und darum erst recht nie eine Chance hat. Bei mir war es jedenfalls so gewesen, vor langer Zeit.
Rita war gerade zwanzig Jahre alt, als sie Bruno heiratete. Irgendwann kam die erste Tochter. Ich hatte die junge Familie aus den Augen verloren und erst viel später wieder getroffen. Mit Rita war ich nicht eigentlich befreundet gewesen. Man kannte sich von früher, und sie war die Frau eines Freundes.
«Geht es wieder?», fragte ich blöd, und sie nickte, ihre Augen waren rot vom Weinen. Ich suchte zwei Tassen, holte Honig und Zitrone und den Medizinalwhisky, den ich im Putzschrank aufbewahrte, um ihn vor mir und meinen Besuchern zu schützen. So bereitete ich zwei stärkende Getränke und reichte Rita die schönere der beiden Tassen, meine Lieblingstasse. Nicht dass es ihr etwas nützte, aber trotzdem.
Sie saß mit hängendem Kopf vor ihrem Tee, blies ratlos hinein. Ich fasste sie an der Schulter, sie war wirklich nur noch ein Häufchen Elend. Wenn ich es mir recht überlegte, so hatte sie auch allen Grund dazu.
«Es ist alles so schrecklich», sagte Rita endlich und ich nickte. Dann sprudelte es aus ihr heraus. Dass die Familie von Werner ihr die Schuld gab an dem Unglück, wie sie es nannte, und sie selber nicht wüsste, ob es stimmte.
Aber sie hätten sie vorher schon abgelehnt, zu schlecht für ihren Sohn, eine Verheiratete mit zwei Gofen, die einfach den Mann sitzen lässt, das ging nicht. Werners Eltern waren Bauern, hatten einen Hof draußen in Weiningen. Sie waren offenbar sehr religiös.
«Dass Werner tot ist, ist schlimm genug. Aber dass Bruno es getan hat, das zerreißt mich. Und die Kinder …» Sie brach wieder in heftiges Schluchzen aus.
«Er behauptet, dass er es nicht war», sagte ich, aber sie weinte nur und weinte.
«Denkst du auch, dass ich an allem schuld bin?»
«Unsinn», sagte ich fest. «Schuld ist der, der Werner erschlagen hat. Ich weiß zwar nicht, wer es war, aber Bruno hat es auf jeden Fall nicht getan. Ich werde das beweisen.» Große Worte ohne jeglichen Hintergrund, aber sie wirkten, sie lächelte ein wenig.
«Ach Jakob», seufzte sie. «Kann ich heute bei dir bleiben, ich mag nicht nach Hause oder zu meinen Eltern. Die Kinder sind bei ihnen, es ist alles so …»
«Aber sicher», sagte ich schnell. «Ich hole uns was zu essen, und dann können wir über alles reden.»
Sie lächelte, hielt meine Hand und lehnte sich an meine Schulter.
«Ich muss meine Mutter anrufen», seufzte sie, und ich zeigte ihr das Telefon.
«Ich geh unterdessen einkaufen», rief ich, zog eine Windjacke an und schlüpfte in die Turnschuhe. Es war schon fünf vor halb sieben, also ging ich zum Chinesen. Mir war schon etwas schwindlig vom Whisky, aber der Spaziergang erfrischte mich wieder. Es gab natürlich Reis, nicht billig, sondern mit guten Zutaten versehen. Auf dem Rückweg überkam mich die Lust nach Wein, und ich versuchte es im Quartierladen. Tatsächlich war noch jemand da und ließ mich herein. Ich nahm zwei Flaschen vom Guten und durfte anschreiben. Meine Barschaft war zu Ende gegangen.
«Komm aber morgen mit dem Geld vorbei», mahnte mich die nette Frau, und ich versprach es. Anscheinend gab es in dem Laden noch einen cholerischen Chef, der zwar nie zu sehen war, jedoch zu Wutausbrüchen neigte, wenn er von leichtsinniger Kreditgewährung erfuhr.
Ich würde morgen schon wieder zum Postomat eilen und meine eiserne Reserve anzapfen müssen.
«Zum Teufel mit der Rechnerei. Hier geht es um das Leben meiner Freunde!», knurrte ich grimmig. Das tönte gut. Heldenhaft und edel, ganz der selbstlose Ritter. Ich verdrängte den Gedanken, dass ich nicht den Hauch einer Ahnung hatte, wie diese Hilfe aussehen könnte. Um ehrlich zu sein, war ich mir nicht mal sicher, ob Bruno es nicht doch getan hatte. Vielleicht war er ja besoffen gewesen und erinnerte sich nicht mehr. Vielleicht versuchte er, sich selber einzureden, dass er es nicht gewesen war. Es wäre verdammt wichtig gewesen, mit ihm zu sprechen, aber das lag wohl nicht drin. Deswegen musste ich von Rita möglichst viel erfahren.
Als ich in die Wohnung kam, wusch sie die Tassen ab. Ich merkte erst jetzt, dass auf dem Pulli, den ich ihr gegeben hatte, hinten zwei sich umarmende Skelette abgebildet waren. Zum Glück sah sie die nicht.
«Magst du chinesisches Essen?», fragte ich, und sie nickte. Ich gab mir alle Mühe, das Fertigmenü einigermaßen schön herzurichten.
«Wie ist die Polizei eigentlich auf Bruno gekommen?», fragte ich, als auch sie ihre Portion verdrückt hatte. Ich wollte nicht, dass ihr der Appetit vorher verging, sie hatte die Stärkung sicher nötig.
«Ich …» Sie stockte. «Was hätte ich denn sagen sollen?»
Ich wusste es nicht, schaute sie aber so unterstützend wie möglich an.
«Es war ein Schock, als die Polizei kam. Sie fragten mich, wer es gewesen sein könnte, und ich habe ohne zu denken Bruno genannt. Er hat sich aber auch wirklich saublöd benommen. Er hat Werner mitten in der Nacht angerufen, wochenlang, das ist sogar aktenkundig, weil Werner Anzeige erstattet hat, und Bruno als Anrufer identifiziert wurde. Einmal hat er ihm sogar aufgelauert, ganz in der Nähe wo es passiert ist, aber Bruno war betrunken, und Werner ist leicht mit ihm fertig geworden. Aber Bruno hat immer wieder angefangen. Er hat vor meiner Wohnung randaliert und unter anderem gedroht, Werner und mich umzubringen. Das ganze Haus ist zusammengelaufen, und später hat sich die Verwaltung bei mir beklagt. Nächstes Mal werde mir gekündigt. Meinst du, ich hätte das der Polizei nicht sagen sollen?»
Statt einer Antwort fragte ich sie, wo sie Werner denn kennengelernt hatte.
«Im Fitnesscenter in Regensdorf», antwortete sie. «Ich gebe da Aerobic-Kurse, und er war Member dort.»
«Du gibst Fitness-Kurse?» Ich war erstaunt, sie hatte nie davon erzählt. Aber ich hatte auch meist nur mit Bruno geredet, wenn ich bei ihnen zu Hause war.
«Ja, schon seit ein paar Jahren. Ich wollte nicht nur zu Hause herumhocken, das liegt mir nicht. Na ja, dort hat es angefangen, vor mehr als zwei Jahren. Irgendwann hat es gefunkt. Erst war es ein Flirt, dann eine Affäre und schließlich Liebe.» Sie schüttelte den Kopf.
«So lange ging das schon?»
«Ja, erst dachte ich, das ist nichts. Ein Seitensprung, das kann in zehn Jahren Ehe schon mal vorkommen. Er war so anders als Bruno, und irgendwann verliebte ich mich. Er hat mich für voll genommen, mich für das geliebt, was ich war. Bruno sah mich nur noch als Funktionserfüllerin, als Mutter seiner Kinder, als Teil seines Lebens, der einfach da war. Er ist irgendwie kalt geworden.»
Ich schwieg. Ich hatte sie immer für das absolut glückliche Ehepaar und Bruno für den fürsorglichen Ehemann gehalten, der seine Frau über alles liebt. Oh Abgründe des Familienlebens. Was nützt es, jemanden auf seine Art zu lieben, und der andere merkt es gar nicht oder leidet sogar darunter?
«Vor etwa einem Jahr hat es mir dann ausgehängt, und ich bin zu Hause ausgezogen. Nach Affoltern hinaus, in die Nähe von Werner.» Sie seufzte und nahm einen Schluck Wein.
«Er hat in Regensdorf Land gekauft und wollte dort ein Haus bauen. Im Frühling sollte es fertig sein, und wir wollten zusammenziehen. Er wollte von Anfang an, dass ich zu ihm ziehe. Aber ich wollte nicht, vor allem wegen der Kinder, die mussten sich ja erst an die neue Situation gewöhnen. Noch gehen sie in Oerlikon zur Schule, weil sie bei Bruno angemeldet sind, ich muss sie immer fahren, es ist alles schon so kompliziert …» Rita blickte ins Leere.
Ich nickte, obwohl ich nie verstanden hatte, wie man es auf sich nehmen konnte, Kinder durch das Leben zu führen. Für meinen Teil war ich mit meiner eigenen Person vollauf bedient, ja sogar leicht überfordert.
Wir redeten noch lange über das Leben, wie beschissen es zuweilen war, und über die Liebe, die so oft unfassbare und trügerische Gestalt annehmen konnte.
Sie versuchte, etwas über mein Liebesleben in Erfahrung zu bringen, aber ich blieb vage. So vage wie mein Liebesleben auch war.
Schließlich wurde sie müde und ging duschen. Ich ging, um das Bett frisch zu beziehen.