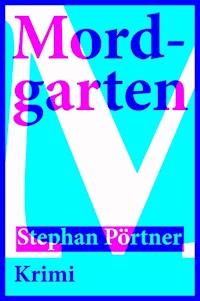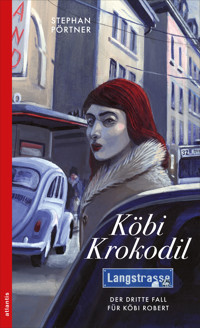9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Aisatore
- Kategorie: Krimi
- Serie: Köbi Krimi
- Sprache: Deutsch
In seiner Heimatstadt Zürich hält sich der sympathische Taugenichts Köbi Robert mit Gelegenheitsjobs über Wasser – bis er eines Tages seinen alten Schulfreund Lucien Huwyler wiedertrifft. Der reiche Architekt beauftragt Köbi, seine verschwundene Halbschwester Malaika zu finden. Mit einem fürstlichen Vorschuss ausgerstattet, macht sich der unerfahrene Köbi auf die Suche und gerät dabei in die geheimnisvollen und gefährlichen Machenschaften der Zürcher Unterwelt. ------ * * * * * "Pörtners Köbi ist nicht nur ein genauer, sondern auch ein unerbittlicher Beobachter und Kommentator. Mit Ironie, die manchmal bis zu Spott und regelrechten Bösartigkeiten reicht, verteilt er Hiebe auf bürgerliches Spießertum und ehrgeiziges Arbeitsethos. Beim Lesen stellt sich denn so mancher Wiedererkennungseffekt ein, was zu zahlreichen Lachern führt." --- Neue Zürcher Zeitung * * * * * "Stephan Pörtner legt mit Köbi der Held einen Krim vor, der witzige und ernüchternde Einblicke in den Zürcher Underground bietet. Un einen erfrischend dilettantischen Detektiv." --- Taglbatt der Stadt Zürich * * * * * "Mit diesem Krimi ist Pörtner eine unterhaltsame Darstelllung der Zürcher Subkultur gelungen. Auch für Nicht-Zürcher sind die abgedrehten Charaktere von Köbi der Held eine virtuelle Reise wert." --- Neue Mittellland Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Stephan Pörtner
Köbi der Held
Alle Rechte vorbehalten
erschienen im Krösus Verlag Zürich, 1998
© 2014, Edition Aisatore
© ISBN 978-3-906247-00-7
www.stpoertner.ch
Inhalt
Köbi der Held
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Das Paar Boxhandschuhe, das mir am besten gefiel, war natürlich das teuerste. Es kostete doppelt soviel, wie ich eigentlich budgetiert hatte. Ich streifte durch die Sportabteilung des Warenhauses Jelmoli. Mein Trainer hatte angedeutet, dass ich bald wieder gut genug sein würde, um Sparring zu boxen. Außerdem hatte ich ein Geschenk verdient, weil ich so brav trainierte und Fortschritte machte. Etwas weniger euphorisch prüfte ich bei den billigeren Handschuhen Verarbeitung und Tragkomfort und ließ die ästhetischen Gesichtspunkte außer acht. Ein schwarzes Paar, nicht schön, aber zweckmäßig, wahrscheinlich das Vorjahresmodell, fand Gnade vor meinem Portemonnaie. Ich legte es weit hinten ins Gestell, damit es mir niemand wegschnappen konnte.
Erst einmal wollte ich mich umschauen, was es denn sonst im Fitnessbereich gab, was diese Saison hochgejubelt, als brandneu verkauft und mit entsprechender Ausrüstung zum Geschäft gemacht wurde: Softhockey, Rollerblades und Hockey auf Rollerblades. Dazu kamen ein paar neue Varianten des Hallenturnens, die nur in knallbunter Kleidung, die penetrant alle sonst schamhaft versteckten Körperteile betonte, auszuüben waren. Für einen gut geformten Körper hatte man immerhin hart gearbeitet. Er symbolisierte Leistungswillen, Jugendlichkeit und modernen Lebensstil und war ein Statussymbol wie ein schnittiges Auto. Bei den Frauen diente er als eine Art Aussteuer. Straffe Schenkel, nicht Barchentleintücher machten heute die gute Partie aus. Wenn ich richtig gelesen hatte, rangierte das Fitnesscenter als Aufreißrevier noch vor der Disco, dort war es wahrscheinlich zu laut.
Ich meinerseits, krummbeinig und schmal, trainierte noch immer in der guten blauen Turnhose und einem zu großen, weißen Unterleibchen. Dieses Tenue war heutzutage gar nicht leicht aufzutreiben.
Bei den unzähligen Turnschuharten wühlte ich nach Aktionen, meine Laufschuhe waren schon uralt, und so ganz war ich gegen die Versprechen der Industrie nicht gefeit. Auch ich hoffte, neue Schuhe würden von alleine rennen. Aber in meiner Größe gab es verbilligt nur hohe Luftkissenschuhe, die ebenso aus der Mode wie unbrauchbar waren, oder Trekkingschuhe und Snowboardstiefel.
Ich ging zurück zu den Laufschuhen, von denen ich das eine oder andere frisch riechende Exemplar fachmännisch verbog, ohne zu wissen, was ich dadurch in Erfahrung bringen konnte. Da bemerkte ich, dass ich von der Seite her angesehen wurde. Wahrscheinlich war der Warenhausdetektiv auf mich aufmerksam geworden. Ich fingerte alles an, ohne etwas zu kaufen. Einen Moment lang hatte ich tatsächlich nach Möglichkeiten gesucht, die teuren Boxhandschuhe abzuzügeln, darum fühlte ich mich ertappt und sah zur Seite. Ein Mann in meinem Alter stand etwa fünf Meter entfernt, schaute mich an und lächelte. Es war kein Detektiv, es war Lucien Huwyler.
«Hey», sagte ich. «Lucien!»
«Also doch.» Mit einem leicht gequälten Grinsen, als hätte ich ihn beim Ladendiebstahl erwischt, kam er auf mich zu.
«Köbi, Köbi Robert.»
Lucien und ich hatten zusammen die Schulbank gedrückt, vor ungefähr hundert Jahren. Trotzdem war er auf den ersten Blick wiederzuerkennen, selbst von mir, der ein hundsmiserables Personengedächtnis hatte. Er wirkte immer noch wie ein Gymnasiast auf mich, aber vielleicht kam das daher, dass ich ihn nicht anders kannte.
«Das ist ja eine Ewigkeit her, dass ich dich gesehen habe.» Er trat auf mich zu und hielt mir die Hand hin.
Ich nahm seine Hand, obwohl ich das schon in der Schule eine blöde Einrichtung gefunden hatte und es auch heute noch so empfand. Wenn es nicht sein musste, fasste ich keine Menschen an, schon gar nicht mitten auf der Straße oder im Warenhaus.
Leute, die allen ständig die Hand gaben, waren meist Deppen. Und wer gibt schon Deppen die Hand? Ich tat es trotzdem und schaute den Mann an. Er hatte immer noch ein Jungengesicht, obwohl die Jahre nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen waren. Noch immer hatte er dieselbe Kurzhaarfrisur, und wie damals trug er saubere Jeans, Timberlands, ein kurzärmliges, gemustertes Hemd. Alles sehr sauber und unauffällig, von guter Qualität und sicher nicht billig. Es sah aus, als würden ihm die Kleider von jemandem ausgewählt, gewaschen und gebügelt. Früher war es die Mutter gewesen, heute würde es wohl die Ehefrau sein, wir waren immerhin in jenem Alter, in dem nur noch Versager und Schwule unverheiratet waren. Und sogar die schafften es zunehmend, dies zu ändern.
«Was machst du denn hier?», fragte er, während er mich musterte.
Da er mich von früher kannte, musste er tatsächlich erstaunt sein, mich in der Sportabteilung anzutreffen. Ich war im Turnen die größte Pfeife der ganzen Schule gewesen.
«Ach nichts, ich schaue mich um.»
Das mit dem Boxen wollte ich nicht erklären, die Leute meinten immer, wer boxe, sei stark und gefährlich. Ich war von beidem weit entfernt.
«Ich auch, ich wollte mir ein paar Tennisschuhe kaufen, so ein Zufall.» Mit dem Kopf deutete er zu dem Schuhgestell hinüber, in dem die weißen Modelle standen, die ich keines Blickes gewürdigt hatte. Mir fiel ein, dass er schon früher Tennis gespielt hatte, als es noch ziemlich exklusiv war. Ich hielt Tennis eindeutig für einen Deppensport, damals wie heute.
«Hast du Zeit, gehen wir einen Kaffee trinken?», fragte er.
«Aber gerne», antwortete ich. Wir liessen die Sportartikel Sportartikel sein und nahmen die Rolltreppe hinauf ins Restaurant.
«Schön, dich zu sehen», sagte ich und meinte es wirklich. Wir waren gute Freunde gewesen, so mit zwölf, dreizehn Jahren. In der Lebensphase, in der man ungefähr dreißigmal pro Tag zwischen Erwachsen-, Jugendlich- und Kindsein hin und her geworfen wird und sich entsprechend schwertut mit seiner Umwelt.
Die Idioten, die keine Ahnung hatten, das waren die anderen, in erster Linie die Eltern, die Lehrer und dergleichen uneinsichtige Lebenserschwerer. Lucien und ich, wir hatten uns prächtig verstanden.
«Ich wollte mich immer mal bei dir melden.»
Das hatte ich tatsächlich gewollt, mehr aber auch nicht. Unsere Wege hatten sich vor vielen Jahren getrennt. Zuerst so halbwegs, als er eine Klasse wiederholen musste, dann ganz, als ich die Schule verlassen und von den geregelten Bahnen Abschied genommen hatte. Wir verloren uns aus den Augen, aber Streit hatten wir nie gehabt.
«Das wollte ich auch schon lange.» Er lächelte bei diesem Gedanken, der schon so alt sein musste, dass es fast gelogen war. «Aber du weißt ja, wie das so geht.»
Natürlich wusste ich das, ich wusste ja praktisch alles, was es zu wissen gab auf dieser Welt. Außer wie man ein geregeltes Leben führte, Erfüllung fand und zu Geld kam. Aber vielleicht wollte ich das ja gar nicht wissen. Wir schoben uns durch die Leute und fanden einen Tisch.
«Mein Gott, Köbi, wie lange ist das her?» Lucien setzte sich auf die Bank, seine Grieder-Plastiktüte legte er vorsichtig neben sich. Noch mehr Hemden wahrscheinlich.
«Mehr als fünfzehn Jahre.»
«Eine lange Zeit», sagte er nachdenklich und schaute mich erwartungsvoll an. «Und was ist aus dir geworden, was machst du so im Leben?»
Die unvermeidliche Frage. In diesem Land ist das immer die dritte Frage. Wie heißt du? Wie geht es dir? Was machst du? Die letzte war die entscheidende Frage. Machen hieß dabei immer arbeiten. Mein Gott, in der Schule war ich einer der Besten gewesen, Lucien hatte oft bei mir abgeschrieben. Sollte ich ihm erzählen, dass ich bei einem Freund, der eine kleine Baubude besaß, den Handlanger machte? Dass ich nie länger als sechs Monate eine feste Anstellung hatte? Dass ich mich hier und dort herumgetrieben hatte, unter anderem ein halbes Jahr in unfreiwilliger Vollpension in Spanien? Dass ich bis heute keinen Beruf gelernt hatte und mir das Aufgehen im Beruf so fremd war wie Suaheli und Sanskrit zusammen?
Meinen derzeitigen Job hatte ich angenommen, weil Bruno ein guter Freund war und weil ich mir von der körperlichen Arbeit einen Zuwachs an Fitness und Lebensfreude versprochen hatte. Es war aber nur halbwegs so. Meist hatte ich Rückenschmerzen vom Pickeln, Schaufeln und Schleppen. Der Job auf dem Bau war nicht so toll, wenn ich das Geld nicht nötig gehabt hätte, wäre ich wohl schnell wieder weg gewesen. Ich war ein notorischer Faulpelz und nicht einmal unglücklich dabei.
Mein unrühmlicher Job als Hoteldetektiv kam mir in den Sinn, den ich im Winter ausgeübt hatte, und darum sagte ich:
«So dies und das, Nachforschungen, Auskünfte, Objekt- und Personenschutz und solche Sachen, kannst du dir ja vorstellen.»
Das war immer eine gute Anmerkung, wenn man etwas erzählte, was man nicht erklären konnte. Wer wollte so fantasielos sein, sich so klare Dinge nicht vorstellen zu können? Immerhin boomte die Sicherheitsbranche, sodass mein vermeintlicher Job ganz plausibel tönte.
«Das klingt aber spannend.» Lucien nickte nachdenklich, und ich benutzte die Gelegenheit, um ihn nach seiner Tätigkeit zu fragen.
«Ich bin Architekt», sagte er. «Ich habe mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Es läuft nicht schlecht, obwohl die Situation nicht einfach ist heutzutage.»
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass die Architekten die Ersten sein würden, die im Falle einer gelungenen Revolution an die Wand gestellt würden. Das hatte mir sehr gefallen. Unterdessen war ich natürlich toleranter geworden und hatte gelernt, dass nicht der Beruf den Menschen zum Arschloch machte. Die meisten kamen schon so auf die Welt.
Ich fragte nicht weiter, da ich mich nicht einmal verbal gerne mit Arbeit beschäftigte, und brachte das Gespräch auf andere Themen.
«Und sonst, wie steht es, bist du verheiratet?» In den meisten Fällen löste diese Frage Schwalle von Berichten aus, zu denen man nur noch nicken und «super» oder «oje» sagen musste, aber Lucien schüttelte nur den Kopf.
«Nein, bis jetzt nicht.» Er blies in seinen Kaffee und versteckte sich hinter der Tasse.
Das war verwunderlich. War er also schwul oder ein Versager? Ich hatte ihn immer im Verdacht der latenten, uneingestandenen Homosexualität gehabt. Ich war auch bei mir nicht ganz sicher gewesen, in dem Alter, in dem einen die jungen Frauen fliehen und die nicht ganz so jungen Männer liebevoll betreuen.
«Ich auch nicht», munterte ich ihn auf, da ihm sichtbar unbehaglich zumute war.
Meine langjährige Zwar-schon-dann-aber-doch-nicht-immer-wieder-trotzdem-Freundin hatte das Land vor Jahresfrist verlassen und schien prächtig ohne mich zurechtzukommen. Immerhin schrieben wir uns häufig Postkarten.
Schwul war ich nicht, aber wie stand es mit Versager? Diese Frage beschäftigte mich in letzter Zeit häufig, und sie ließ sich nur durch ausgedehnte Waldläufe vertreiben.
«Nachforschungen machst du also?», fragte mich Lucien so unvermittelt, dass ich, in Gedanken versunken, beinahe ungläubig «Wie kommst du denn darauf?», gefragt hätte, als mir gerade noch einfiel, dass ich das vorhin behauptet hatte.
«Ja genau», fasste ich mich noch knapp.
«Auch über Personen?»
«Klar, alles, auch Personen.» Ich lehnte mich sicher und wichtig in meinem Stuhl zurück.
«Hm, ich hätte da vielleicht etwas für dich.» Er rührte in seiner leeren Kaffeetasse.
«Ja?» Ich richtete mich auf und zerquetschte mit dem Ringfinger den kleinen Mann im Ohr, der stampfte und «Es reicht, hör auf», schrie.
«Worum handelt es sich denn?»
«Du sollst jemanden finden für mich. Ich meine, ich habe schon lange nichts mehr von ihr gehört, sie scheint nicht zu Hause zu sein, niemand geht ans Telefon, aber ich …», er schaute auf, winkte der Bedienung und bestellte noch zwei Kaffees. Mit einem Kopfnicken deutete ich Einverständnis an, obwohl ich mittags schon zwei Espressi getrunken hatte.
«Wer?», versuchte ich ihn aufs Thema zu bringen. «Wer ist nicht zu Hause?»
«Ah, natürlich, so etwas, nun, meine Schwester.» Verlegen schüttelte er den Kopf, er hatte definitiv etwas Verknorztes an sich. Es schien ihm nie recht wohl zu sein in seiner Haut.
«Deine Schwester?»
Ich erinnerte mich an eine große, ernsthafte Person mit langen, blonden Haaren. Der kühle, schöne Typ Mädchen, der schon früh einen vielversprechenden Freund hatte, den Schulsprecher, Sportstar oder etwas in der Richtung. Sie war etwa vier Jahre älter als wir und hatte uns seinerzeit keines oder nur eines strafend-nachsichtigen Blickes gewürdigt.
«Madelaine? Was ist mit ihr?» Die Huwylers hatten alle französische Vornamen. Die Mutter war Bernerin und hielt das für nobel. Hieß sie selbst nicht Eugenie oder so was Ähnliches?
«Nein, nicht Madelaine, Malaika. Meine Halbschwester.»
«Du hast eine Halbschwester?»
«Ja, aus der zweiten Ehe meines Vaters.»
Dunkel erinnerte ich mich, dass seine Eltern sich kurz vor unserer Bekanntschaft hatten scheiden lassen, so wie fast alle Eltern in dieser Zeit. Wir waren die Generation, in der die Scheidung vom Stigma zum Normalfall wurde. Lucien war dann bei seiner Mutter geblieben, die sich nicht wieder verheiratete.
«Das wusste ich nicht», sagte ich ehrlich interessiert.
Luciens Vater tauchte hin und wieder in der Gesellschaftspresse auf. Vor Jahren hatte ich ein paar Fotos gesehen. Hatte er nicht eine exotische Schönheit geheiratet? Es musste eine Weile her sein, aber an solchen Unfug erinnerte ich mich noch jahrzehntelang, während ich wichtige Dinge ständig vergaß.
«Malaika ist um einiges jünger als ich, gerade zwanzig, und nun …» Der Kaffee kam, Lucien bestellte sich ein Mineralwasser. Ich hielt mit.
«Nun eben, wir haben keinen allzu engen Kontakt. Ich meine, wir sind ja nicht zusammen aufgewachsen oder so, aber immerhin, wir telefonieren oft und sehen uns ungefähr einmal in der Woche. Seit drei, vier Wochen hab ich nichts mehr von ihr gehört. Ich habe auf ihren Telefonbeantworter geredet, ich bin vorbeigegangen, aber sie war nicht da.»
Er machte eine Pause, goss behutsam Rahm in seinen Kaffee und rührte darin, ohne mich anzusehen. Ich musterte abwechslungsweise ihn und das Parkbankmotiv auf meinem Kaffeerahmdeckel.
«Vielleicht ist sie in die Ferien gefahren, zu einem Freund oder einer Freundin, irgendsowas», versuchte ich den Anschein des abgeklärten und realistisch denkenden Profis zu erwecken.
«Das kann schon sein. Sie ist ein ziemlich ausgeflipptes Mädchen, weißt du, darum mache ich mir ja Sorgen, sie geht viel an Partys und solche Sachen.»
Die Kellnerin brachte das Wasser. Lucien schwieg, bis sie sich verzogen hatte. Ich sah ihn verständnisvoll an, obwohl ich nichts kapierte und nicht wusste, ob ich mit der ganzen Sache überhaupt etwas zu tun haben wollte. Mein Leben verlief in relativ geordneten Bahnen. Ich arbeitete, ich trainierte und ich stürzte nicht allzu oft ab.
«Ja, das wilde Leben gehört heutzutage dazu», meinte ich schließlich und rieb mir fachmännisch das Kinn.
«Naja, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus, aber man liest ja viel über diese Szene. Es gibt da anscheinend einen Haufen neuer Drogen und Kulte, das sind Neo-Hippies, die sich komplett ausklinken oder so ähnlich. Das kann ganz schön weit gehen. Malaika ist noch so jung und verletzlich. Vielleicht ist es total überflüssig, aber ich mache mir halt Sorgen. In ihrem Alter hat man es ja nicht leicht und tut oft unüberlegte Dinge, die man später bereut.»
Lucien schaute für einen Augenblick von seiner Tasse auf. Es sah aus, als könne er aus dem Kaffeesatz lesen, nur hatte dieser Kaffee keinen Satz.
Aber es stimmte wohl, das mit den unüberlegten Dingen. Ich erinnerte mich, wie ich zusammen mit Lucien zu kiffen begonnen hatte, im zarten Alter von dreizehn Jahren, aus Vaters alten Pfeifen, weil wir nicht drehen konnten. Dafür drehte es uns danach um so mehr. Er hat sich wohl nie weiter hinausgewagt, wogegen ich noch einiges ausprobierte. Nicht nur zu meinem Guten.
«Ich wäre froh, wenn sich jemand an diesen Orten umhören könnte, ob man sie gesehen hat oder weiß, wo sie sein könnte. Es ist durchaus möglich, dass sie nach Ibiza, Hamburg oder Rimini gedüst ist, aber meist ruft sie mich an, wenn der Festrausch Anfang Woche vorbei ist. Es muss keinesfalls sein, dass etwas nicht in Ordnung ist, aber es beschäftigt mich, ich hätte gerne Klarheit.»
Der nicht vorhandene Kaffeesatz übte weiterhin eine tiefe Faszination auf Lucien aus. «Also was ist? Machst du solche Sachen, übernimmst du den Fall?»
«Ich würde gerne, aber leider hab ich dazu im Moment zu viel zu tun», wollte ich sagen. «Okay, weil du’s bist, ich werde mich darum kümmern», hörte ich mich statt dessen sagen.
«Nein», stöhnte der Mann in meinem Ohr mit seinem letzten Schnauf, dann schwieg er.
«Und was kostet das?» Lucien richtete sich auf. Geld war ein Terrain, auf dem er sicher war. Sein Vater, ein bekannter Bauunternehmer, hatte am Zürichberg gewohnt, in einer prächtigen Villa, in der ich immer gerne zu Gast war. Anscheinend war auch Luciens Mama nicht ganz unbegütert nach Zürich gekommen, denn sie hatte nach der Scheidung das Haus übernommen.
Ja, was kostete das? Ich hatte keine Ahnung und sagte einfach: «Vierhundert am Tag plus Spesen.» Das tönte gut und war ihm wohl zu teuer, sodass ich meine Ruhe hatte.
Huwyler junior sah mich streng an, schien etwas einwenden zu wollen, nickte dann aber. «In Ordnung, du hast den Auftrag.»
Ich schluckte so unauffällig es ging. Zum Teufel, jetzt gab es kein Zurück mehr.
«Ich soll mich also auf den abgedrehten Parties umhören?» Ich ließ mir nicht anmerken, dass ich von der Situation völlig überrumpelt war. Ich kramte aus meinem Gedächtnis ein paar Fragen hervor, die diesbezüglich in Krimis gestellt wurden:
«Hast du ein Foto von ihr? Kennst du ihr Umfeld, weißt du, wo sie verkehrt? Hat sie besondere Vorlieben, bevorzugte Bars und Discos?»
Lucien schüttelte den Kopf. «Keine Ahnung, ich kenne weder ihre Freunde noch sonst was, ich hätte dort schon nachgefragt. Ein Foto habe ich natürlich, aber nicht bei mir.»
«Schick es mir, so schnell wie möglich.»
«Mach ich selbstverständlich. Übrigens an ein paar Orten, Kaufleuten und Kanzlei, war ich schon. Ich denke, das ist nicht so ihre Szene.»
Da war ich aber froh, denn nicht mal für vierhundert plus Spesen lockte es mich in diese Schuppen. Ins Kaufleuten würde man mich zwar lassen, wenn ich mich manierlich anzog, aber das musste ja nicht sein. Ins Kanzlei hingegen setzte ich keinen Fuß. Früher wurde dort kein Bier ausgeschenkt, weil das nur primitives Volk anziehen würde. Da ich zu jenen gehörte, die den Biertrinkern zu ihrem schlechten Ruf verholfen hatten, mied ich den Laden. Unterdessen gaben sich ehemalige Puritaner als Kampftrinker aus, aber mich täuschten sie nicht.
Lucien kramte eine Visitenkarte hervor, er hatte offenbar eine ganze Auswahl davon, denn er studierte verschiedene Exemplare, ehe er mir eines überreichte. Ich warf einen kurzen Blick darauf. Seine Privatadresse stach mir sofort ins Auge. Es war immer noch dieselbe Anschrift am Zürichberg.
«Du wohnst noch zu Hause?», fragte ich, während ich die Karte in meinen Geldbeutel steckte.
«Mit meiner Mutter, ja, ich wohne mit meiner Mutter zusammen.»
An seine Mutter konnte ich mich noch gut erinnern. Eine große, energische Frau. Sie war altmodisch und führte ein strenges Regime. Wir versteckten unsere Joints vor ihr und flunkerten ihr so manches vor, während wir die Nacht als unergründlichen Abenteuerspielplatz entdeckten. Lucien hatte immer einen Heidenrespekt vor ihr und widersprach nie offen.
«Ich schicke dir dann das Foto.»
Er schaute mich erwartungsvoll, fast ungeduldig an. Ich kam darauf, dass es an mir wäre, meine Visitenkarte zu zücken. Ich hatte aber keine.
Ich schrieb ihm meine Adresse und Telefonnummer auf die Rückseite irgendeines Hundsverlocheteflyers, den ich im Portemonnaie gehabt hatte. Irgendein Fest, das im April stattgefunden hatte, ohne mich.
Lucien Huwyler steckte den Zettel ein und winkte der Bedienung.
«Brauchst du einen Vorschuss?», fragte er, als diese wieder weg war, während er das Portemonnaie noch in der Hand hielt. Ich nickte vielleicht eine Spur zu eifrig. «Also komm.» Wir standen auf und verliessen das Restaurant. In einer ruhigen Ecke neben Rolltreppe, Telefonnische und Zigarettenautomat zählte er mir zwanzig Hunderter in die Hand.
«Ich denke, das genügt fürs Erste.» Kaum hatte Lucien Geld in der Hand, wirkte er selbstsicher. «Du schickst mir dann eine Abrechnung.» Das klang definitiv nicht wie eine Frage.
«Ja sicher», nickte ich und versuchte ganz ruhig und cool zu bleiben. Schließlich war ich hier der harte Kerl. Aber zwei Riesen waren exakt achtundfünfzig Franken und siebzig Rappen mehr, als ich im letzten Monat verdient hatte.
«Ich höre dann von dir.» Wir gaben uns wieder die Hand, Luciens Händedruck war fester geworden. Er wandte sich zur Rolltreppe und fuhr hinunter.
Der junge Verkäufer, ein geschmeidiger Schnösel, konnte es nicht unterlassen zu fragen, ob er sie als Geschenk einpacken sollte.
«So weit kommt’s noch», knurrte ich, schnappte die Plastiktüte und verließ das Warenhaus via Lift.
Draußen wartete mein treues Fahrrad auf mich. Ein graues Mondia Chasseral, unauffällig und alt, aber in meinen Augen einer der besten Straßengöppel, die je in diesem oder einem anderen Land gebaut worden waren. Ich belud ihn umsichtig und fuhr über den Schanzengraben und die Sihl meiner Behausung im alten Tramdepot zu. Auf dem Weg dachte ich an Lucien und die alten Zeiten. Wie lange das schon her war. Dreißigjährige waren für uns uralt gewesen. Jetzt hatten wir selber dieses Alter erreicht, was allerdings nicht bewies, dass wir uns damals geirrt hatten.
In meiner Wohnung wagte ich mich an den Abwasch und trank Unmengen Wasser, um meinen Magen zu beruhigen, den ich mit zuviel Kaffee in Aufruhr gebracht hatte.
Ich war kaum eine Stunde zu Hause, als es läutete und ein Velokurier vor der Tür stand, der die Fotos brachte.
Er hatte blond gefärbte, kurze Dreadlocks und eine Tätowierung an der Wade.
«Geile Loge, ist die besetzt?», wollte er wissen.
«Nein, ich bin Kontrolleur bei der VBZ», verscheuchte ich ihn. Tatsächlich war es eine alte Dienstwohnung, die ich seit drei Jahren zwischennutzte.
Meine grandiose Freundin hatte sie vor vielen Jahren der Stadt abgehandelt, erst als Atelier, dann als Wohnung. Ich passte darauf auf, bis sie irgendwann zurückkam. Das war natürlich ein Dilemma: Sollte ich Veras Rückkehr herbeisehnen oder hoffen, die Wohnung möglichst lange behalten zu können? Keine leichte Frage, denn es war eine schöne Wohnung, wenn auch recht lärmig, aber dafür gab es keine Nachbarn, und ich konnte selber so viel Krach machen, wie ich wollte.
Ich riss das Kuvert auf und pfiff durch die Zähne. Potztausend und Donnerwetter, was für Bilder. Das heißt, nicht die Fotos waren beeindruckend, sondern das wunderschöne, exotische Mädchen, das darauf abgebildet war. Ich schaute genauer hin, sie hatte etwas Vorwitziges an sich, aber auch etwas Vornehmes. Ich schwärmte auf der Stelle für sie, was allerdings nicht viel zu bedeuten hatte. Ich schwärmte gerne für Frauen, die ich nicht kannte. Auf dem einen Foto lachte sie, auf dem anderen sass sie auf einer Bank, es schien an einer langweiligen Gartenparty aufgenommen zu sein. «Herrje», dachte ich und schüttelte den Kopf, damit sich keine allzu große Verwirrung in ihm festsetzte.
Ich packte die Sportsachen und die neuen Handschuhe in meine Umhängetasche und fuhr mit dem Rad zum Training. So würde ich schön warm sein für eine lange Nacht.
Heute war immerhin Freitag, und ich hatte nichts vor. Für vierhundert plus Spesen an irgendwelche Partys zu gehen, war doch der bessere Job, als für zwanzig die Stunde zu rackern.
Bruno, mein Chef, war zwar ein guter Kerl, aber es lief auch nicht mehr so wie früher. Er hatte außerdem eine Familie zu ernähren. Ich musste ihn noch anrufen und ihm sagen, dass ich diesen Monat nicht mehr käme. Heute ist wirklich mein Glückstag. Dachte ich.
Die Trainingshalle befand sich in einem modernen, schwer vermietbaren Objekt, nicht allzu weit von meiner Behausung entfernt. Das war wichtig für mich, denn wenn der Weg zu lang war, hätte ich unterwegs vielleicht die Motivation verloren.
Als ich vor vielen Jahren den ersten Anlauf genommen hatte, war mein Club eine reine Boxschule gewesen. Unterdessen wurden die verschiedensten Kampfsportarten angeboten: Kickboxen, Taekwondo, Selbstverteidigung, sogar Fitness und so ein Zeug. Mir fiel es schon schwer genug, meine Beine auf dem Boden zu halten. Sie auch noch durch die Luft zu schwingen, schien mir verwegen, weshalb ich beim guten alten Boxen geblieben war. Im hinteren Teil der Etage gab es eine Reihe Kraftmaschinen, die ich hin und wieder ganz gerne benutzte, ohne dass es jedoch Spuren an meinem Körper hinterlassen hätte.
Die Klientel des Clubs war gemischt, es gab ein bisschen von allem, je nach Sportart: Yuppies, Normalos, Polizisten, Milieu, In- und Ausländer jeglicher Provenienz. Mit den Kampfsportlern hätte ich es nicht aufnehmen wollen.
Früher war ich fleißiger gewesen, aber es machte immer wieder Spaß zu schwitzen, Sandsäcke und Punchingbälle zu verdreschen, an den Maschinen zu leiden oder bis zum Umfallen zu springseilen. Mein Trainer hieß Werner, ein
älterer, wortkarger Mann. Er stellte meinen Trainingsablauf zusammen, und ich schätzte ihn, obwohl er gnadenlos war. Auch heute ließ er mich kein Sparring machen, sodass meine schönen neuen Boxhandschuhe in der Tasche blieben. Für den Sandsack waren sie mir zu schade, da nahm ich lieber die alten Sackhandschuhe.
Ich fühlte mich gut, machte Extrarunden mit dem Springseil und gab einem Sandsack Saures. Nach anderthalb Stunden hatte ich genug und ging duschen.
Auf dem Heimweg sang ich laut und falsch. Zu Hause hängte ich die verschwitzten Kleider auf, damit sie nicht wieder in der Tasche zu Stinkbomben mutierten.
In meiner Wohnung herrschte ein grauenhaftes Durcheinander. Jeder Blick gab Anlass zu Depressionen. Morgen, so sagte ich mir, morgen werde ich dann mal tüchtig sauber machen, jawohl. In mir stieg jene wohlige Energie auf, die sachgemäße körperliche Ertüchtigung mit sich bringt, das Gefühl, Bäume ausreißen zu können. Im Plattengestell stieß ich auf die Hanson Brothers, die alsbald durch die Wohnung dröhnten und meine Stimmung zusätzlich anheizten.
Der Hunger meldete sich. Ich ging in die Küche, kochte mir einen Topf Teigwaren, wegen der Kohlenhydrate und weil ich Lust darauf hatte. Dazu ließ ich den Fernseher scheppern und überflog die Zeitung. Zusammen mit der Musik ergab das einen erhebenden Lärm- und Informationsteppich. Nach dem Essen legte ich eine Leftfield-Maxi auf, um mich auf die Nacht einzustimmen, in der wohl kaum Punkrock auf dem Programm stehen würde.
Gegen zwölf Uhr hatte ich Kaffee getrunken, und in einem Anfall von Discovorfreude ließ ich die Pet Shop Boys laufen, ehe ich mich ins Xenix aufmachte.
Ich schlenderte die Badenerstraße hinunter und bog an der Silberkugel in die Langstraße ein. Vor dem Spielsalon lungerte ein Haufen zwielichtiger jugendlicher Gestalten herum, sodass ich vorsichtshalber die Straßenseite wechselte. Gerade weil ich trainierte, wusste ich, wie viele schnelle und kräftige Jungs es gab, die gerne mal auf der Straße prüfen wollten, wie gut sie waren. Pro forma nahmen sie dir dann noch das Portemonnaie ab. Bei uns im Club hatte es immer wieder ein paar von der Sorte. Einige kamen nach einem halben Jahr nicht mehr, andere fuhren plötzlich im Porsche vor. Wenn sie dich kannten, waren es feine und liebe Leute, wenn nicht, das Gegenteil.
An der Bushaltestelle standen viel mehr Leute, als in den Bus einsteigen würden. Einen von ihnen kannte ich von früher, damals war er noch gut zwanzig Kilo schwerer gewesen. Wir grüßten uns nicht.
Ich hoffte, Herbert im Xenix zu treffen. Herbert war der wandelnde Termin-, Party- und Konzertkalender. Die Taschen seiner Jacke bargen immer eine Unmenge von Flyern, zu denen er Kommentare und Empfehlungen abgab. Ich selber hatte seit dem vorletzten Winter den Fetenfaden so ziemlich verloren. Ich konnte mich kaum entsinnen, wann ich zum letzten Mal an irgendeiner Festivität gewesen war.
Ich war alt geworden, alt und ruhig. Ich hockte meistens daheim in meinem Chaos, las Bücher und Zeitschriften und hatte keineswegs das Gefühl, etwas zu verpassen. Vielleicht hatte jeder Mensch sein vorgegebenes Quantum Feten zu feiern, Parties durchzustehen, Räusche durchzuwachen. Mir war da mein gerüttelt Mass schon serviert worden. Heute aber war ich ausnahmsweise richtig unternehmungslustig.
Der Abend war warm und angenehm, Zürich lächelte. Nun, es lächelte nicht, es schaute zufrieden, wie eine gestrenge Lehrerin schaut, wenn sie sich über etwas freut, aber es nicht sagt, weil sie das nie tut, um ihre Autorität nicht infrage zu stellen.
Vor der Baracke standen eine Menge Leute herum, andere hockten an den Tischen.
Ich quetschte mich in die Bar, ergatterte ein Bier und stellte mich draußen auf. Ich kannte nicht viele Leute, bei einigen war ich mir nicht recht sicher, mit einigen tauschte ich ein zögerliches Kopfnicken aus. Halbbekanntschaften, Lokalprominenz, Zechkumpane, Partypöbel, Festmobiliar.
Hier und da wechselte ich ein paar Worte, meine Alters- und Geschlechtsgenossen beeilten sich alle zu erklären, dass sie eigentlich kaum mehr ausgingen. Die Gründe dafür waren ebenso vielfältig wie eintönig.
Die einen hatten einen Job, der sie auffraß, die anderen eine Kleinfamilie, den dritten war die Kleinfamilie zerbrochen, weil der Job sie auffraß. Andere hatten keine Ausreden mehr, sie hatten gar nichts, außer Durst vielleicht. Einige hatten schmerzhaft festgestellt, dass das Leben in der Kleinfamilie, das sie als vernunftbegabte, junge Menschen so ausgiebig belästert hatten, tatsächlich so langweilig und beschissen war wie einst vermutet. Sie waren von dem Wahn beseelt gewesen, bei ihnen sei das natürlich etwas ganz anderes. Einen Dreck war es, und jetzt waren sie wieder auf Pirsch.
Bei ein paar belanglosen Plaudereien hatte man sich nicht viel zu sagen, des einen Situation deprimierte den anderen. Außerdem war man nicht hergekommen, um mit alten Bekannten zu plaudern. Das Gegenteil war gefragt, junge Frauen, am besten noch nicht zu lange in der Stadt ansässig. Die würden einem vielleicht noch glauben, dass man eigentlich ein interessanter und außergewöhnlicher, ganz und gar unterschätzter Typ war. Diese Figuren konnten mir nicht weiterhelfen. Aber halt, wen sah ich denn da?