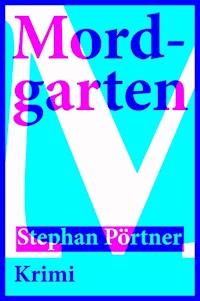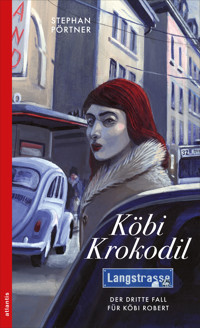
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Köbi Robert
- Sprache: Deutsch
Fünf Monate ist es her, dass Köbi Robert sich mithilfe des Arbeitsamts selbstständig gemacht hat. »J. K. Robert, Ermittlungen« steht auf dem dreckigen Messingschild neben seiner Haustür. Viel ermittelt hat er seitdem nicht (eigentlich nur vergeblich die Katze einer Nachbarin gesucht, sich aber nicht getraut, seine Dienste in Rechnung zu stellen), und von einem Büro kann auch keine Rede sein. Nicht nur wegen des gewaltigen Durcheinanders, sondern vor allem wegen des Terrariums mit dem Krokodil: Ein alter Freund hat es Köbi anvertraut und ist seither wie vom Erdboden verschluckt. Seinen zweiten potenziellen Kunden, der unangekündigt vor der Tür steht, lotst Köbi daher lieber ins Café nebenan, wo der freundliche Herr mit der Sprache herausrückt: Hellmut Strassner sucht eine Frau, die er von früher kennt, »eine alte Sentimentalität, nichts von großer Bedeutung«, wiegelt er ab. Ein erfahrener Ermittler wie Köbi wird da gleich stutzig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stephan Pörtner
Köbi Krokodil
Der dritte Fall für Köbi Robert
Kriminalroman
atlantis
1
»Wen suchen Sie?«, fragte ich den alten Mann, der vor meiner Haustür stand.
»Das Ermittlungsbüro, ich kann den Namen Robert bei den Klingeln nicht finden.«
Fast hätte ich ihm geholfen zu suchen, als mir einfiel, dass ich selbst das Ermittlungsbüro war.
J.K. Robert, Ermittlungen, so stand es auf einem unterdessen recht dreckigen Messingschild, das neben der Haustür hing. Viel ermittelt hatte ich allerdings nicht, seitdem das Schild da hing, und von einem richtigen Büro konnte auch nicht die Rede sein.
»Das bin ich«, gab ich mich zu erkennen und stellte den Migros-Sack ab, um mich dem Mann ordentlich vorzustellen.
»Jakob Robert. Sie müssen entschuldigen, ich komme gerade vom Einkaufen.«
»Hellmut Strassner, freut mich.«
Der alte Mann hielt mir die Hand hin, und nach kurzem Zögern schüttelte ich sie. Sein Händedruck war kräftig. Lächelnd musterte er mich, offenbar war er sich seiner Sache nicht ganz sicher. Ich sah wohl nicht allzu vertrauenswürdig aus, mit meiner alten Baseballjacke, den ausgebleichten Jeans und den abgelatschten, schwarzen Halbschuhen. Zum Einkaufen im Migros Limmatplatz brauchte man sich nicht schick zu machen. Um im Café El Greco nebenan Maulaffen feilzuhalten vielleicht schon, aber das hatte ich nicht vorgehabt.
»Ein Glück, dass Sie gekommen sind, ich hätte gerade aufgegeben«, meinte der alte Mann.
Ob es ein Glück war, wusste ich noch nicht, aber ich wusste, dass ich ihn unmöglich mit hinauf in meine Wohnung nehmen konnte. Dort herrschte ein gewaltiges Durcheinander, und das Zimmer, das als Büro dienen sollte, war in besonders beklagenswertem Zustand. Außerdem stand dort das Terrarium mit dem Krokodil.
Vor fünf Monaten hatte ich mich mithilfe des Arbeitsamtes selbstständig gemacht und war seither nicht gerade von Kundschaft überrannt worden. Ich hatte den lauen Geschäftsgang auf die ungünstigen Wintermonate geschoben. Im Oktober des letzten Jahres hatte ich mein kleines Büro eröffnet. Erst kam der hässliche November, dann kamen die Feiertage, später das Januarloch und jetzt, Ende Februar, regnete es ständig. Wer brauchte in solchen Zeiten hier in Zürich schon einen Ermittler?
Die Leute wurden in dieser Jahreszeit immer mürrischer, und es herrschte eine spürbare, unterschwellige Aggressivität und Gewaltbereitschaft. Es wurde geflucht, gerempelt, gewettert. Autos wurden als Kriegsspielzeug benutzt, junge Männer aus schlecht beleumundeten Regionen gaben sich alle Mühe, ihrem schlechtesten Ruf gerecht zu werden. Die Stadtregierung hatte sich auf den Zürichberg zurückgezogen und versuchte, bei Champagner und Theaterbesuchen das Elend ihrer Untertanen zu vergessen. Aber kein Mensch brauchte einen Ermittler.
An diesem Morgen allerdings ließ sich, völlig unpassend, der Frühling erahnen. Der erste Sonnenstrahl nach langer Finsternis war ein Zeichen für mein winterschlafendes Unternehmen. Seit der im engsten Freundeskreis, zu dritt, mit Dosenbier gefeierten Geschäftseröffnung war genau ein Auftrag hereingekommen. Zwei Tage lang hatte ich eine kleine Katze gesucht, aber es nicht übers Herz gebracht, der alten Dame, die im gleichen Haus wohnte, eine Rechnung zu stellen. Sie vermutete gebrochenen Herzens, die Türken hätten die Mieze gefressen.
»Man weiß es ja«, klagte sie, und ich wollte nicht widersprechen, sondern rasch wieder aus ihrer stickigen Wohnung raus. Seither lauerte sie mir hin und wieder im Treppenhaus auf, um mich mit wirren Geschichten über dunkle Machenschaften aufzuhalten.
»Gehen wir in ein Café, mein Büro wird gerade renoviert«, schlug ich vor, um meinen ersten Klienten nicht kampflos aufzugeben.
»Wie Sie meinen.« Der alte Mann sah mich stirnrunzelnd an.
Ich schloss nur rasch die Haustür auf und versteckte meine Einkäufe auf der Kellertreppe. Es passte wohl nicht zum Bild eines Schnüfflers, mit vollen Migros-Säcken herumzulaufen. Im Gegensatz zu all den Krimihelden hatte ich keine Sekretärin. Auch konnte ich mich nicht ausschließlich von Schnaps ernähren, nur um dem Schnüffler-Klischee zu entsprechen. Vielleicht hatte der alte Mann erwartet, mich im zerknitterten Regenmantel, unrasiert, eine Kippe im Mundwinkel und eine Pulle Schnaps auf dem Schreibtisch anzutreffen, eine zweifelhafte Blondine im Vorzimmer oder auf dem Schoß. Nicht, dass ich etwas dagegen gehabt hätte, aber die Realität sah einfach anders aus.
Der einzige Versuch, den ich unternommen hatte, dem Bild eines Schnüfflers zu entsprechen, war kläglich gescheitert. Nachdem ich einen Nestor-Burma-Krimi gelesen hatte, wollte ich auch Pfeife rauchen. Irgendetwas machte ich aber falsch, denn nach zwei Tagen heftigen Paffens und Puffens bekam ich eine regelrechte Tabakvergiftung, die mich für zwei Tage niederstreckte. Ich kotzte wie ein Profi und verzichtete seither darauf, Klischees zu entsprechen.
Ohne die kompromittierenden Tüten verließ ich das Haus und führte den alten Mann ins nahe gelegene Café Memphis, wo es um diese Zeit ruhig war und man auf die Langstraße hinausblicken konnte, die sich ganz zivilisiert gab um halb elf Uhr morgens. Ich bestellte einen Café crème, Strassner einen Kaffee Hag mit Milch. Wir warteten schweigend auf unsere Getränke. Wenn wir uns nicht gegenseitig zulächelten, schaute der alte Mann, er mochte etwa siebzig sein, dem Treiben um die Telefonzentrale auf der anderen Straßenseite zu.
Junge Männer und Frauen aus der Dominikanischen Republik in bunten Daunenjacken, blendend weißen Hosen und tief in die Stirn gezogenen Wollkappen standen auf der Treppe, gingen in den Laden hinein, kamen heraus, verschwanden und tauchten erneut auf. Unsere Getränke kamen.
»Ich suche eine Frau«, sagte Strassner, als die Bedienung verschwunden war.
Ich nahm einen Schluck Kaffee. Bedächtig nippte der alte Mann an seiner Tasse, seine Haltung war aufrecht, ohne steif zu wirken. Seine Hände waren gepflegt. Sie wirkten fast zu jung für einen Mann seines Alters. Man sah ihnen an, dass sie gearbeitet hatten, aber sie hatten eine gewisse Feinheit behalten. Am linken Ringfinger trug er einen goldenen Siegelring, einen von der edlen, aber nicht protzigen Art.
»Ich habe sie vor vielen Jahren gekannt«, sagte er, nachdem er die Tasse wieder abgesetzt hatte.
Ich stellte meine ebenfalls zurück, verfehlte den Unterteller und der Kaffee schwappte über, sodass danach die Tasse millimeterhoch in der hellbraunen Brühe stand. Ich schaute den Mann aufmunternd an.
»Ich weiß nicht einmal, ob sie überhaupt noch lebt«, sagte er nachdenklich und lächelte. »Es ist so eine alte Sentimentalität, nichts von großer Bedeutung.«
»Aha«, sagte ich und hob nachdenklich meine Tasse. Es tropfte mir auf die Hosen, die ich heute erst frisch aus dem Schrank genommen hatte, vor nicht einmal drei Stunden. Ohne mir meinen Ärger oder meine Verlegenheit anmerken zu lassen, stellte ich die Tasse neben den überschwemmten Unterteller auf den Tisch.
»Ich weiß leider gar nichts von ihr, keine Ahnung, wo sie wohnt.«
Ich sah den alten Mann an, der wieder gekonnt an seinem koffeinfreien Kaffee nippte.
»Vielleicht lebt sie hier in Zürich, vielleicht auf dem Land oder auch sonst irgendwo in der Schweiz. Möglich ist sogar, dass sie ausgewandert ist.« Er hob entschuldigend die Schultern. Ich lächelte ihm zu und drehte meine Tasse auf dem Tischtuch hin und her. Es bildete sich ein ausgefranster, brauner Kreis auf dem hellgelben Stoff. Ich trank den Kaffee aus, stellte die Tasse zurück und schob den Unterteller über den Fleck. Es wurde Zeit, mich dem Geschäft zu widmen, statt hier am Kaffeetrinken zu scheitern. Der alte Mann zog eine Blechschachtel Villiger No. 6 aus der Jackentasche und legte sie vor sich auf den Tisch.
»Stört es Sie?«, fragte er. Ich schüttelte den Kopf.
»Was wissen Sie denn von der Frau, die Sie suchen?«, fragte ich und hätte mir gerne eine Zigarette angesteckt, obwohl ich eigentlich nicht mehr rauchte.
Mein Klient zündete sich mit einem Streichholz eine kurze Kiel an. Irgendwie wehmütig schaute er hinüber zu den jungen Leuten auf der anderen Straßenseite. Der Wirt hinter dem Tresen schickte einen missmutigen Blick herüber, er fürchtete wohl, der Stumpen würde ihm das Lokal verpesten.
»Sie hieß Anna Oberholzer und hat Anfang der fünfziger Jahre bei der Firma Hubag in Kloten gearbeitet.« Der Alte drehte sein Zigarillo zwischen den Fingern. »Sie dürfte etwa fünfundsechzig sein. Wenn ich mich nicht täusche, ist sie 1935 geboren.«
»Haben Sie schon etwas unternommen, um sie zu finden?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, es war mehr ein spontaner Einfall. Ich bin durch die Gegend spaziert, habe mich an alte Zeiten erinnert und dann ihr Schild gesehen. Warum nicht einen Versuch starten, dachte ich mir, und deswegen bin ich hier.«
Ich runzelte die Stirn, lächelte aber sofort wieder. Wenn das so weiterging, würde ich mir noch einen Grinskrampf holen. Lächeln war nicht meine Paradedisziplin. Es konnte mir ja auch egal sein, dass mein erster Kunde mir nicht ganz die Wahrheit sagte. Mein Schild war nicht gerade von Weitem her sichtbar, und es war nicht gerade die Gegend, wo man einfach so spazieren ging, so zwischen Dealern, Junkies und Prostituierten. Der alte Mann sah allerdings nicht wie ein verirrter, ängstlicher Senior aus. Er war nicht sehr groß, aber sicher mal ein kompaktes Mannsbild gewesen. Seine Schultern waren immer noch recht breit. Gut möglich, dass er temporär auf Freiersfüßen war. Es war manchmal geradezu beängstigend zu sehen, bis in welch hohes Alter der Sexualtrieb die Männer auf die Straße scheuchte.
»Was kostet es mich, wenn Sie nach ihr suchen?«
»Das kommt darauf an, wie lange ich suchen muss. Der Ansatz ist zweihundert Franken pro Tag, plus Spesen. So zwischen tausend und zweitausend würde ich mal sagen. Es sei denn, die Sache wird kompliziert.«
Strassner winkte der Bedienung und bezahlte. Zum Glück nahm sie die Tassen noch nicht mit, da er noch nicht fertig ausgetrunken hatte. So blieb es mir erspart, wegen dem versauten Tischtuch gerügt zu werden. Der Alte nahm drei frische, steife Zweihunderter-Noten aus seiner Brieftasche und legte sie auf den Tisch.
»Reicht das als Anzahlung?«
Nach kurzem Zögern steckte ich das Geld ein. »In Ordnung, Sie hören von mir.«
»Haben Sie eine Karte?«
Ich hatte keine. »Ich kriege gerade einen ISDN-Anschluss, alle meine Nummern ändern sich«, log ich, »der Umbau, wissen Sie.« Verzweifelt suchte ich in meiner Jacke nach einem Stift. Der alte Mann kam mir zuvor, nahm aus seinem Jackett einen silbernen Kugelschreiber und ein kleines, ledergebundenes Ringbuch, in das er meine Adresse und Telefonnummer eintrug.
»Rufen Sie mich an, wenn Sie etwas herausgefunden haben.« Er reichte mir eine Seite aus dem Ringbuch, auf die er seine Mobiltelefonnummer geschrieben hatte. »Ich habe zurzeit keinen Festanschluss«, sagte er mit einer entschuldigenden Handbewegung. Ich fragte nicht weshalb, sondern faltete den Zettel und steckte ihn in mein Portemonnaie, zu den eleganten, steifen Banknoten. Der alte Mann drückte seine noch nicht fertig gerauchte Villiger aus. Wir erhoben uns und verließen das Lokal.
»Auf Wiedersehen, Herr Strassner, ich melde mich, sobald ich etwas weiß«, verabschiedete ich mich vor dem Café und ging Richtung Unterführung. Strassner ging in die entgegengesetzte Richtung, zum Helvetiaplatz hinauf. Ich schaute ihm nach. Zügig schritt er einher, in seinen grauen Hosen und seiner braunen Lederjacke. Es sah aus, als wisse er, wohin er wollte, und ich fragte mich wieder, was ihn in diese Gegend trieb.
Ich holte meine Einkaufstüte, die man mir freundlicherweise nicht gestohlen hatte, und fuhr mit dem Lift in den fünften Stock, wo sich meine Wohnung und mein vorgetäuschtes Büro befanden. In der Küche räumte ich meine Einkäufe ein. Danach betrat ich die Abstellkammer, die eigentlich das Büro war oder umgekehrt. Die Arbeit rief.
Mein erster richtiger Auftrag, eigentlich hätte ich mich freuen sollen. Voller Optimismus hatte ich im ersten Monat meiner Selbstständigkeit einen alten Computer und ein lahmes Modem aufgetrieben, um mit der großen Welt verbunden zu sein. Der edle Spender war froh gewesen, den Krempel loszuwerden, und hatte mich angesehen, als plane ich, mit einer Buschtrommel aufs Mobiltelefonnetz zu gehen. Aber für meine Zwecke reichte die alte Kiste vollauf. Ich hatte damals den Schreibtisch aufgeräumt, den Computer und eine alte Telefon-Fax-Kombination aus dem Heilsarmee-Brockenhaus darauf gestellt. Das Fax ging zwar nicht mehr, aber dafür hatte die Maschine einen eingebauten Beantworter. Mehr konnte man für zwanzig Franken wirklich nicht verlangen. Die Ära der Faxtechnologie war somit an mir vorübergezogen wie ein kühler Septemberwind. Ich war nie dazu gekommen, sie zu nutzen.
E-Mail hingegen hatte ich. In meiner reichlichen Freizeit hatte ich die grundlegenden Funktionen des Internets erlernt. Unter den Programmen, die auf dem Computer waren, befand sich auch ein archaisches Web-Design-Programm, und so hatte ich mir sogar eine Homepage eingerichtet, was die Beraterin vom Arbeitsamt schwer beeindruckt hatte. Seither fristete die Homepage allerdings das Dasein eines noch nicht entdeckten Sterns in einer fernen Galaxie. Im Januar, als ich noch immer keinen Auftrag und noch immer eine Menge Zeit hatte, war ich auf die grandiose Idee gekommen, in der linken Wochenzeitung zu inserieren, weil es die Sparte Ermittlungen bei den Kleinanzeigen noch nicht gab. Warum sollte die Leserschaft der WOZ keinen Bedarf an Ermittlungen haben? Auch sie hatten Lebensabschnittspartner, die der Untreue verdächtigt wurden, oder Haustiere, die abhandenkommen konnten.
Leider aber löste die Leserschaft ihre Probleme selber. Die einzige Reaktion, die ich aufgrund des Inserats erhalten hatte, kam von einer revolutionären Splittergruppe, die, wenn ich den Jargon, von dem diese Leute annahmen, dass er vom werktätigen Volk gesprochen und verstanden würde, richtig übersetzte, keine Freude an meiner Tätigkeit hatte. Die sich und die Welt durchaus ernst nehmenden Revolutionäre bezeichneten mich als Privatbullen des imperialistischen Unterdrückungsdispositivs und Feind des proletarischen Widerstandes gegen Kapital und Faschismus. Sie drohten mir mit Vernichtung und Untergang. Doch es war mir versagt geblieben, dem Imperium zu dienen. Es bedurfte meiner Hilfe nicht, die Massen zu unterdrücken.
Mein Projekt war nicht wirklich aussichtsreich. Innert drei Monaten musste ich auf eigenen Füßen stehen, sonst konnte ich mir eine Arbeit suchen oder beim Sozialamt anklopfen. Letzteres hatte ich entschieden nicht vor, Vorletzteres war aber auch keine begeisternde Alternative. Also sammelte ich mein positives Denken, das mir in dem Kurs, der mich als Arbeitslosen auf meine selbstständige Tätigkeit vorbereitet hatte, bis zum Abwinken eingetrichtert worden war. Nach Ansicht des Kursleiters, der so war, wie ich mir einen Staubsaugervertreter vorstellte, obwohl mir noch nie einer begegnet war, konnte es jeder Mensch, so hässlich, alt, unbegabt oder unfähig er auch sein mochte, leicht zu Ansehen, Erfolg und Reichtum bringen, wenn er nur positiv dachte. Ich hatte den begeisterten Mann nie gefragt, warum er dann Arbeitslosen Kurse gab, anstatt in angenehmeren Gefilden seinen Reichtum zu genießen. Nun aber erinnerte ich mich mit Wohlwollen des fröhlichen Mannes und bündelte meinen Optimismus.
Der erste Kunde war immer der wichtigste, davon, wie ich diesen Auftrag erledigte, würde meine zukünftige Existenz abhängen, sagte ich mir und machte mich frisch ans Werk.
Als Erstes räumte ich meinen Arbeitsplatz auf. Über den Winter hatte ich allerlei Unrat angeschleppt und im Büro zwischengelagert. Ich sortierte aus, verpackte das Unnütze in Kehrichtsäcke und gab dem Nützlichen einen Platz im Haushalt. Dazu hörte ich ermunternde Musik, die anderen verleidet war und die ich deshalb wohlfeil erstanden hatte. Zu fröhlichen Tanzrhythmen wurde gerappt, dann wieder jazzte und funkte es. Das Ganze hieß laut CD-Cover Big Beat und war wohl nur eine kurze Zeit populär gewesen.
Das Krokodil lag in seinem Terrarium und grinste. Es war seit Anfang Jahr bei mir. Ein alter Freund, den ich viele Jahre nicht gesehen hatte, war eines Tages vor der Tür gestanden und hatte mich um einen Gefallen gebeten. Seine neue Freundin hatte ihm ein Ultimatum gestellt. Er musste sich entscheiden: sie oder das Krokodil. Da er die Freundin nicht verlieren wollte, fragte er mich, ob ich auf das Tier aufpassen könnte. Ich stimmte zu, und wir schleppten ein zweihundert mal achtzig mal sechzig großes Terrarium in den fünften Stock hinauf. Das Tier war knapp einen Meter lang und zeigte sich von allem unbeeindruckt. Viktor gab mir Instruktionen, wie ich es zu hegen und zu füttern hätte, dazu ein wenig Geld. Er versprach, sich wieder zu melden.
Seither lebte das Krokodil bei mir, und ich hatte es gern bekommen. Hin und wieder erzählte ich ihm eine Geschichte. Es hörte zu und grinste. Krokodile grinsen zwar immer, aber das war mir egal. Von Viktor hatte ich seither nichts mehr gehört.
Bald konnte das Büro wieder als solches genutzt werden, und ich griff nach einem für Ermittler unentbehrlichen Hilfsmittel, dem Telefonbuch. Ich verfügte über die beiden Zürcher Ausgaben, Stadt und Land, die ungefähr gleich dick waren. Aus Verbundenheit zum Wohnort versuchte ich es zuerst im Band Zürich-Stadt. Den Kanton konnte man sowieso einfacher via Internet absuchen. Es gab in der Stadt eine ganze Reihe Oberholzers. An erster Stelle stand tatsächlich eine Anna Oberholzer. Ich lächelte.
So positiv dachte ich aber trotz allem nicht, dass ich den Fall schon für erledigt angesehen hätte. Es wäre doch ein bisschen zu einfach gewesen. Andererseits übersah man ja oft das Naheliegendste, und deshalb wollte ich einen Versuch wagen. Ich wählte die Nummer. Es meldete sich eine Frauenstimme, die klang, als würde ihre Besitzerin ungefähr im passenden Alter sein.
»Hier ist Anna Oberholzer, grüezi?«
»Frau Oberholzer? Hören Sie, hier spricht Jakob Robert, ich rufe im Auftrag eines Klienten an.«
Ich versuchte, vertrauenerweckend und sympathisch zu klingen.
»Wer ist am Apparat?« Frau Oberholzers Stimme blieb deutlich misstrauisch.
»Haben Sie in den frühen fünfziger Jahren bei der Firma Hubag in Kloten gearbeitet?«, kam ich sofort zur Sache. Es blieb still in der Leitung. »Frau Oberholzer?«, fragte ich und hörte ein scharfes Atmen, dann ein Klicken. Sie hatte aufgehängt.
Ich wollte es noch einmal versuchen, überlegte es mir aber anders. Wahrscheinlich hatte sie mein nicht eben subtiles Vorgehen erschreckt. Alte Damen wurden sicher ständig am Telefon von Aasgeiern jeglicher Couleur belästigt, die versuchten, an ihr Erspartes oder ihre Stimme zu kommen. Legionen von Heizdeckenverkäufern und Seelenfängern lauerten ihnen auf.
Nur weil Anna Oberholzer abgehängt hatte, konnte ich noch nicht davon ausgehen, dass sie die von Hellmut Strassner Gesuchte war. Ich konnte nicht annehmen, dass sie nie geheiratet hatte und nach Zürich gezogen war, nur um mir die Suche zu erleichtern. Außerdem wusste ich gar nicht, ob ich es so leicht haben wollte. Dies war die Gelegenheit, mich endlich einmal richtig als Ermittler zu betätigen, Geburtsurkunden und Familienregister zu wälzen. Ich müsste Strassner um weitere Informationen bitten. Geburtsort, Heimatort, irgend so etwas.
Das viele positive Denken war mir offenbar schlecht bekommen, ich sehnte mich geradezu nach Arbeit. Trotzdem wollte ich es mir nicht schwieriger machen als nötig, und deshalb schrieb ich mir die Adresse der Anna Oberholzer auf. Sie wohnte in Oberstrass.
Eine gute Gelegenheit, das Rennvelo, das im Hausflur vor sich hin döste, wieder einmal auszureiten. Draußen war es zwar kalt, aber trocken. Da ich mich in den letzten Wochen nie groß aus meinem Reduit gewagt hatte, war das treue Gefährt unbenutzt geblieben. An und für sich fuhr ich gerne im Winter Velo, weil dann all die Platzda-Rabauken, die überzeugt waren, so cool zu sein, dass es für die Mitmenschen eine Ehre war, von ihnen über den Haufen gefahren zu werden, ihre Räder im Keller ließen. Nur noch die professionellen Knalltüten, die Velokuriere, waren unterwegs.
Mein Velo quietschte, und ich keuchte, während wir über die Kornhausbrücke fuhren, wir waren beide ein wenig eingerostet. Beim Schindlergut musste ich sogar absteigen und stoßen. Dabei überlegte ich, warum die Deutschen Fahrrad zum Velo sagten. Was sollte ein Rad anderes tun als fahren? Laufen vielleicht, wie ein Laufrad. Es ist leider nicht bekannt, wer das Velo erfunden hat, obwohl in jeder Stadt eine vierzig Meter hohe Statue dieses Menschen stehen sollte, am besten mitten auf der Straße.
Frau Oberholzer wohnte in einem Mehrfamilienhaus oberhalb der Tramstation Irchel, gegenüber dem Universitätspark. Unauffällig studierte ich die sechs Namensschilder.
A. Oberholzer stand auf dem Namensschild rechts in der Mitte. Ich legte den Daumen auf die Klingel, wagte es dann aber doch nicht zu läuten, tat, als hätte ich mich getäuscht, und überlegte meinen nächsten Schritt. In dieser ruhigen Seitenstraße war es viel zu auffällig, herumzustehen und auf die Frau zu warten. Kam dazu, dass ich keine Ahnung hatte, wie sie aussah. Zwei der sechs Schilder waren mit Doppelnamen beschriftet, Familien wahrscheinlich oder wenigstens jüngere Paare. Für diese Annahme sprachen auch das Fahrrad mit der Kindersitzhalterung, die Kindervelos und der Plastikeimer im Vorgarten. Ich beschloss, dass ich für heute genug erfahren hatte. Wenn Strassner die Frau seit über vierzig Jahren nicht gesehen hatte, würde es auf ein paar zusätzliche Tage auch nicht mehr ankommen.
Zu Hause setzte ich mich an den Computer und bastelte ein paar Visitenkarten. Später bereitete ich mir aus meinen Einkäufen ein einfaches, aber schmackhaftes Mahl und schaute mir zum Zwecke der Weiterbildung den Dienstagabendkrimi an. Der Derrick-Nachfolger sollte eine modernere Form der galligen Moralität seines Vorgängers darstellen, was ihm aber nicht gelang. Dabei kam nur heraus, dass der Kommissar zum etwa dritten Mal in fünf Folgen dem Täter oder der Täterin versprach, sich um sie zu kümmern. So ein Käse, dachte ich, und aß inspiriert ein Käsebrot. Dann schaute ich nach dem Krokodil, das keinen Käse aß. Ich erzählte ihm eine Gutenachtgeschichte:
Wrizelschmid und Wrazelschmid stritten sich um ein Ei, das aber schon längst verfault war, sodass das Gezänk nicht nur hässlich, sondern auch komplett sinnlos war. Ein Schäferhund, der das Pech hatte, an ihrer Hütte vorbeizuschleichen, wurde von einem Wurfkäse getroffen und verlor die Übersicht. Drei kleine Mädchen, die im Wald Bier tranken, benutzten ihn als Schankkellner und Schlimmeres. Am Schluss lag er auf alle Fälle völlig verstört am Ufer des Wimmerweihers, der ihn verschlang. Die beiden Streithähne waren unterdessen müde geworden, und so nutzten die Mädchen, denen der Krach auf den Wecker ging, die Gelegenheit, deren Hütte anzuzünden. So kam die Sache dann doch noch zu einem guten Ende.
Das Krokodil grinste, obwohl es einen Käse in der Geschichte gab.
2
Am nächsten Morgen stand ich zeitig auf, rasierte mich und zog mir lange Velohosen, ein oranges Veloleibchen, Veloschuhe, Handschuhe und eine Mütze an, alles Teile der Ausrüstung, die ich nach und nach erstanden hatte, um mit dem Rennvelo über Land zu fahren. Viel benutzt wurden die Sachen nicht, obwohl ich keineswegs an Arbeitsüberlastung litt.
Ich montierte die Lenkertasche, in der sich allerlei Werkzeug befand, und fuhr wieder nach Oberstrass. Die Sonne schien schüchtern durch faserige Hochnebelschwaden. Es war kalt, ich fröstelte trotz meiner zweckmäßigen Kleidung. Diesmal fuhr ich den Bogen via Schaffhauserplatz. Die ganze Tarnung war sinnlos, wenn ich in voller Montur das Velo den Hang hinauf schob.
Es war schon fast halb elf, als ich in die Straße einbog, in der Frau Oberholzer wohnte. Ich fuhr gegenüber aufs Trottoir, stieg ab und drehte mein Rad auf Sattel und Lenker. Langsam und umsichtig montierte ich das Hinterrad ab und ließ die Luft raus. So umständlich es ging, hantierte ich an dem Rad, nahm den Pneu ab und den Schlauch heraus, pumpte, hörte ihn ab, pumpte, hörte, ließ Luft raus, pumpte wieder. Ich nutzte die Gelegenheit, die Kette zu fetten, den Wechsler einzusprühen und ein paar allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten vorzunehmen, auf dass das Velo wieder strahle und nicht mehr quietsche. Die Straße blieb ruhig, aber es war zu vermuten, dass man mir durch mehrere Fenster zuschaute. In so ruhigen Gegenden wurde man immer von irgendjemandem gesehen. Hinter Vorhängen und Küchenfenstern saßen die Rentner, Heimarbeiter und Hausfrauen und harrten des Unheils, das sich da via Außenwelt anschlich. Sportbekleidung ist eine gute Tarnung. Sportler werden als harmlose Zeitgenossen angesehen. In Sportlerkleidung darf man durch stille Straßen rennen, in Läden herumstolpern, das Trottoir blockieren oder im Landgasthof an den leeren Stammtisch sitzen. Vielleicht wird man belächelt oder für die vermeintliche Leistung bewundert, aber grundsätzlich wird man in Ruhe gelassen, man muss seine Anwesenheit jedenfalls nie rechtfertigen.
Eine Frau mit zwei kleinen Kindern kam die Straße herunter, ging aber weiter vorn in eines der Häuser. Ich war froh, nicht von den Kindern umzingelt worden zu sein.
»Was macht der Mann da?«, hätten sie gefragt, das Mami hätte dumpf gelächelt, die Unwissende gemimt, um sich nicht direkt an mich wenden zu müssen, und den Nachwuchs aufgefordert, sich selber bei »dem Mann« zu informieren. Das hätten die Kleinen dann doch nicht gewagt, sodass ich, um als umgänglich und kinderfreundlich zu gelten, irgendwas hätte antworten müssen. Darauf hätten sie mir einen Haufen dummer Fragen gestellt oder unverständiges Zeug geschwafelt, indes die Mutter dem Februartag einen Ast abgelächelt und nicht daran gedacht hätte, ihren Nachwuchs von mir wegzudirigieren. Im schlimmsten Fall hätten sie wohl mein Werkzeug behändigt und nicht mehr rausgerückt oder was so kleine Teufel sonst an Niedlichkeiten aushecken, wenn man sie nur lässt. Ich hatte noch einmal Glück gehabt.
Die Straße belebte sich ein wenig, wie ich es vermutet hatte. Zwischen halb elf und halb zwölf kommt man vom Einkaufen, geht einkaufen, muss zur Post oder zur Bank. Nach einer Dreiviertelstunde konnte ich nicht mehr länger an meinem Rad flicken, das gar nicht kaputt war, und setzte mein Fahrzeug wieder zusammen. Meine Hände waren schwarz.
»Hatten Sie einen Unfall?«, erschreckte mich eine alte Dame, die ich nicht hatte kommen sehen.
»Nein, nur einen Platten«, lächelte ich. Alte Damen waren doch die angenehmere Gesellschaft als kleine Kinder. Sie stellen die richtigen Fragen und fassen kein Werkzeug an. »Ja, das gibt es, das hat sich nicht geändert.« Sie schüttelte den Kopf. »Früher hatte es ja noch nicht überall Autos, aber die Velos waren schwer.«
Die alte Dame schaute verträumt die Straße hinunter, und dann begann sie zu erzählen, von Ausflügen nach Baden, an den Greifensee – da musste man stoßen – und von ungeteerten Straßen und warmen Sommern. Ich hörte zu und bestätigte hin und wieder, dass ich da oder dort auch schon mal war.
»Grüezi Frau Oberholzer«, unterbrach sich die alte Dame und hob grüßend die Hand. Aus dem Haus gegenüber kam eine andere ältere Dame, elegant, groß und schlank. Gar kein altes Mütterlein, wie ich sie mir irgendwie vorgestellt hatte. Sie grüßte ebenfalls und lächelte. Ich sah, wie sie unten an der Straße um die Ecke bog, und schaffte es, mich von der alten Dame loszueisen und Frau Oberholzer zu folgen.
Sie verschwand in der Bäckerei an der Schaffhauserstraße, und als sie längere Zeit nicht mehr herauskam, wagte ich einen Blick hinein. Sie saß im dazugehörigen Café oder Tea-Room, wie über dem Fenster in einem veralteten Schriftzug stand. Lange Zeit hatte an allen Cafés Tea-Room gestanden, obwohl niemand so sagte. Weil ich keine Lust hatte, noch einmal einen Tag hier oben zu verbringen, womöglich bei Regen, betrat ich forsch den Tea-Room und ging an den Tisch, an dem Frau Oberholzer saß.
»Frau Oberholzer?«
Sie schaute auf. Etwas belustigt musterte sie mich, und ich konnte es ihr nicht verübeln, mit diesen lächerlichen engen Velohosen und dem mottenzerfressenen orangen Wollleibchen war ich wahrlich ein lustiger Anblick.
»Ja?« Sie legte die Zeitung, in der sie gelesen hatte, auf den Tisch. Ich kam mir im Weg vor, wie ich so mitten in dieser kleinen, ruhigen Gaststube stand.
»Darf ich mich setzen? Ich muss Sie etwas fragen.«
Sie wies mit der Hand auf den Stuhl ihr gegenüber. Ich setzte mich, und eine magere Serviertochter, die mich schon vom Buffet aus verängstigt gemustert hatte, fragte mich nach meinen Wünschen. Ich bestellte ein Mineralwasser, das war einfach zu handhaben. Die Serviertochter brachte ein hohes Glas mit abgestandenem, eiskaltem Wasser. Als ich es ergriff, bemerkte ich beschämt meine dreckigen Finger. Ich nahm einen Schluck, der mir beinahe den Hals einfror, und räusperte mich.
»Frau Oberholzer, mein Name ist Jakob Robert, ich bin Ermittler.«
Frau Oberholzer sah mich kühl an. Ich wusste nicht, wie sie sich einen Ermittler vorstellte, aber wahrscheinlich entsprach ich ihrem Bild überhaupt nicht. Vielleicht sah ich aber auch genau so aus, wie sie sich einen Vertreter unserer Zunft vorstellte, und erweckte damit ihren Unmut.
»Ein Klient hat mich beauftragt, eine Anna Oberholzer zu finden, die etwa in Ihrem Alter ist und anfangs der fünfziger Jahre bei der Firma Hubag in Kloten gearbeitet hat.«
Sie schaute mich weiter unbewegt an. »Haben Sie mich gestern Morgen angerufen?« Ihre Stimme klang streng. Ich nickte. »Es ist sonst nicht meine Art, einfach aufzuhängen«, sagte sie nach einer Pause. Offenbar war es ihr nicht recht, unhöflich gewesen zu sein. Welch feiner Zug.
»Wer sucht denn die Anna Oberholzer?«
Ich zögerte einen Moment und überlegte, ob es hier irgendwelche Standesgesetze gab, die ich übertreten würde, wenn ich den Namen meines Auftraggebers preisgab. Aber erstens waren Ermittler kein Stand, nicht einmal ein Beruf, und soweit ich wusste, durfte man sich nur nicht in allfällige Klienten verlieben. »Mein Klient heißt Hellmut Strassner.«
»Hellmut Strassner?« Anna Oberholzer war sichtlich erstaunt und damit war auch klar, dass sie die Gesuchte war.
»Sie kennen ihn?«, hakte ich nach, um die Gefühlsregung zu nutzen. Sie sah ins Leere, anscheinend waren ihre Gedanken sehr weit weg.
»Er lebt also noch.« Sie nickte fast unmerklich, dann fasste sie sich wieder. »Sagen Sie ihm, ich sei gestorben.«
Ich hob erstaunt die Hände. Sie deutete das als Ablehnung. »Hören Sie, Sie haben kein Recht, hier in mein Leben einzubrechen, ich will nur meine Ruhe.«
Ihre Stimme war fest, ihre dunklen Augen funkelten. Sie saß kerzengerade auf ihrem Stuhl. Ich kam mir mies vor, sie hatte ja recht. Was wusste ich denn von Hellmut Strassner?
»Was zahlt er Ihnen?«
»Sechshundert«, antwortete ich überrumpelt.
»Ich zahle Ihnen das Doppelte, wenn Sie ihn von mir fernhalten. Wir können gleich zur Bank.« Sie trank ihren Kaffee und sah mich entschlossen an. Ich leerte mir einen großen Schluck des schalen Wassers in den Hals und schüttelte den Kopf.
»Das kann ich nicht machen. Ich werde ihm sagen, dass ich Sie gefunden habe und dass Sie nichts mit ihm zu tun haben wollen. Allerdings kann ich ihm nicht verbieten, ins Telefonbuch zu schauen. Ich werde ihn auf keinen Fall dazu ermuntern und ihm auch nicht sagen, ob Sie immer noch denselben Namen haben oder wo ich Sie gefunden habe.«
Frau Oberholzer seufzte, die Sache schien sie doch aufzuregen.
»Machen Sie sich keine Sorgen, ich will Ihnen bestimmt keinen Ärger machen, Frau Oberholzer.« Ich winkte der Bedienung und zahlte mein Mineralwasser. »Tut mir leid, wenn ich Sie gestört habe, hier«, ich überreichte ihr eine der sechs Visitenkarten, die ich in der Zwischenzeit mittels Computer, Drucker, Halbkarton und Schere produziert hatte. »Falls irgendetwas ist.«