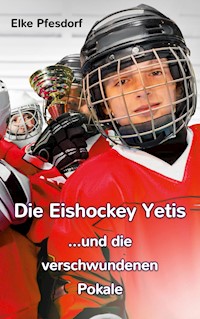Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Der Bergische Krimi
- Sprache: Deutsch
Bea Lautenschläger ist aus Prinzip neugierig. Wenig, was in Nümbrecht und Umgebung vor sich geht, bleibt ihr verborgen. Und was sie nicht weiß, will sie herausfinden. Das schaurige Ende einer Schaufensterpuppe, Leichenteile in Plastiktüten, Henkersschlaufen und ungewöhnliche Todesfälle bringen Bea und das beschauliche Landleben allerdings gehörig durcheinander. Da sollte wenigstens der traditionelle Weihnachtsmarkt unangetastet bleiben!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elke Pfesdorf mag das Leben auf dem Land zwischen Schneckenjagd, Saunelken und Gummistiefeln. Sie ist Ideensammlerin, Buchstabenfan, Kinder- und Jugendbuchautorin. »Kein schöner Land« ist ihr erster Krimi für Erwachsene.
Ähnlichkeiten mit wahren Begebenheiten, lebenden Personen und Tieren sind natürlich an allen Haaren herbeigezogen… Einige Schauplätze der Geschichte, zum Beispiel die Strumpfhosenfabrik, wurden mit künstlerischer Freiheit angepasst.
© 2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: mauritius images/imageBROKER/H.-D.Falkenstein Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Dr.Marion Heister eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-134-5 Der Bergische Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Kein schöner Land in dieser Zeit
Kein schöner Land in dieser Zeit,
als hier das unsre weit und breit,
wo wir uns finden
wohl unter Linden
zur Abendzeit.
Da haben wir so manche Stund’
gesessen wohl in froher Rund’
und taten singen;
die Lieder klingen
im Eichengrund.
Daß wir uns hier in diesem Tal
noch treffen so viel hundertmal,
Gott mag es schenken,
Gott mag es lenken,
er hat die Gnad’.
Nun, Brüder, eine gute Nacht,
der Herr im hohen Himmel wacht!
In seiner Güten
uns zu behüten
ist er bedacht.
Ihr Brüder wißt, was uns vereint,
eine andre Sonne hell uns scheint;
in ihr wir leben,
zu ihr wir streben
als die Gemeind’.
Erste Einblicke
Die Hand ragt aus der Plastiktüte. Eine abgetrennte Hand an einem kurzen Stumpf. Wie beim Lotoseffekt perlen rote Tropfen vorwurfsvoll ab. Die Frau mit dem Hund schreit und hört nicht wieder auf.
Sieben Minuten später geht ein Notruf ein. Die Polizei rückt an, ein Krankenwagen, mittlerweile stehen zehn Personen am Rand des steilen Weges. Sie starren auf den blauen Kunststoffbeutel, der langsam an einem Ast hin- und herpendelt. Auf Augenhöhe. Die grünen Blätter verdecken die Finger, was zunächst gnädig wirkt.
»Weiter unten hängt noch etwas. Ich glaube, da drin steckt ein Fuß!«, haucht eine Joggerin.
Sie ist so weiß im Gesicht wie ihr Kapuzenpullover. Mit den Armen umschlingt sie ihren Oberkörper, um ein bisschen Wärme herbeizuzaubern. Der aufdringliche Nieselregen macht ihre Bemühungen zunichte. Das Ortsschild Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, steht ein paar Meter weiter oben und hat Moos angesetzt.
Die Dorfpolizisten stehen ein wenig unschlüssig am Tatort. Sie müssen nachdenken. Leichenteile gehören nicht zur täglichen Routine. Schließlich fordern sie die Spezialisten aus der Kreisstadt Gummersbach an. Gregor Germann schiebt die Mütze aus der Stirn. Er notiert sich die Telefonnummern und Adressen der Zeugen. Das Papier seines Notizbuches wird nass und wellig. Sein Kollege sperrt den Bereich mit Flatterband ab und versucht, nicht in das hohe, feuchte Gras zu treten. Gelbe Saunelken blühen vereinzelt. Eine fette Schnecke schleimt langsam über den brüchigen Asphalt des Weges.
Und dann warten alle auf die Spurensicherung und die Kripo. Die stellen rasch fest, dass die Hand aus nicht organischem Material besteht. Die Dorfpolizisten blicken beschämt in Richtung Wald. Leere Tetrapaks, Flaschen, Folien und Dosen hat man dem Leichenteil anscheinend mit auf den Weg ins Totenreich gegeben. Dennoch sind sich die Spezialisten einig, dass hier womöglich ein psychopathischer Serienkiller eine Warnung hinterlassen hat.
Im Kabuff
Immer die gleichen Bilder. Der sich überschlagende Wagen, berstende Scheiben, nasse lange Grashalme ragen in den zerquetschten Innenraum des Fahrzeugs. Ich werde wach, weil ich geschrien habe. Der Schmerz wühlt in meinen Beinen, kriecht den Rücken hinauf und bleibt in der Wirbelsäule stecken. Mühsam wälze ich mich auf die Seite, die Decke liegt zerwühlt auf dem Boden.
In fünf Minuten klingelt mein Handy, um mich auf den kommenden schwarzen Tag vorzubereiten. Denn heute, auf den Tag genau, liegt der grässliche Unfall dreißig Jahre zurück. Ich war fünf, und mein Vater saß am Steuer. Die Landstraße war schmal, der Untergrund nass und rutschig. Ein dicker Baumstamm stoppte das herumschleudernde Fahrzeug. Meine Eltern überlebten leicht verletzt, doch meine zarten Knochen nahmen die rüde Überbeanspruchung übel.
Lange blieb ich in der Klinik, und mein Leben sollte nie mehr so unbeschwert sein wie vorher. Mein Vater machte sich Vorwürfe, und meine Mutter sprach sie laut und anklagend aus. Meine Eltern rieben sich gegenseitig auf, sie verbrauchten ihre Zeit, um sich zu zerfleischen. Und sie vergaßen mich, weil sie meinen jämmerlichen Anblick nicht ertragen konnten. Mein ständiger Begleiter war stattdessen der Schmerz. Viele Operationen folgten, wirklich helfen konnten mir die Ärzte nicht.
Ich muss seitdem diese hässlichen, fetten orthopädischen Schuhe tragen, um überhaupt vernünftige Schritte machen zu können. Mein Rücken wirkt bei meinen Bewegungen unbeweglich und steif, so, als würde ich auf einer schmalen Linie balancieren. Irgendwie trifft das auf mein ganzes Leben zu, der Grat, auf dem ich mich befinde, ist schmal geworden. Man muss schwindelfrei und extrem zielorientiert sein. Und genau das bin ich.
Wer mitgerechnet hat, weiß, dass ich fünfunddreißig Jahre alt bin. Ich arbeite im Rathaus am Empfang. Jeder, der die Behörde im Waschbeton-Schiefer-Look in Nümbrecht betritt, muss an mir und dem kleinen Kabuff vorbei. Ich kümmere mich um die Post und weise den Besuchern den richtigen Weg für ihre Anträge und wichtigen Anliegen.
Nicht dass in unserer kleinen Gemeinde viel los wäre und ich vor Beschäftigung nicht wüsste, wo mir der Kopf steht. Ganz im Gegenteil, ich habe viel Zeit und jede Menge Gelegenheiten, meine spitze Nase in alle Dinge zu stecken, die interessant sind. Dazu gehören Krimis in der Schreibtischschublade, fremde Telefongespräche und Unterhaltungen, die im Rathaus geführt werden. Wenig entgeht meiner Aufmerksamkeit, und die fehlenden Puzzleteile erfrage ich oder leite sie logisch ab.
Wäre ich körperlich nicht versehrt, wäre ich am liebsten Polizistin geworden. Jetzt sehe ich die Dorfsheriffs im Rathaus. Dort im Untergeschoss hat die kleine Wache ihren Sitz. Die beiden Polizisten streunen durch das Dorf, kümmern sich um die Sicherung des Schulwegs, und dienstags bekommen sie ein Polizeifahrzeug aus der größeren Dienststelle. Wenn ich Gregor Germann und Christoph Löffelsterz ärgern will, nenne ich sie die Kellerbullen. Aber das kommt selten vor. Meistens unterstütze ich die beiden nebenamtlich ein wenig beim Papierkrieg, natürlich heimlich und für mich sehr informativ. Auch für unsere Gemeindezeitung fühle ich mich zuständig und erfahre eine Menge vor allen anderen.
Ich setze mich langsam im Bett auf, versuche, die Träume abzuschütteln und in den Morgen zu starten.
Wenig später startet der Motor meines Automatikfahrzeugs tadellos. Ich rolle aus der maroden Scheune und lasse das zweiflügelige Tor offen stehen. Hier im Oberbergischen Land sind alle Menschen grundehrlich, niemand würde etwas zerstören oder mitgehen lassen. Das denke ich. Und wenn es die anderen ebenfalls denken, funktioniert das Prinzip. Ich lasse den Scheibenwischer laufen, ohne diese nützlichen Helfer geht im Bergischen Land gar nichts. Die Regenhäufigkeit im Wetterbericht könnte man treffend mit hundertfünfundvierzig Prozent angeben, jedenfalls gefühlt.
Mit viel Mühe und extremen Kosten habe ich mein Elternhaus in Oedinghausen renovieren lassen. Die dunklen Balken des Fachwerkhauses glänzen, besonders bei Nässe. Die Wetterseite ist mit schwarzem Schiefer verblendet, und die grünen Holzfensterläden lassen das Gebäude freundlich und einladend aussehen. Das zarte Grün des Frühlings wechselt gerade zum vollen, satten Ton des Sommers. In Blumenkübeln wachsen kugelige Buchsbäume. Nur die alte Scheune hat bisher ihren charmant morschen Stil bewahrt und wartet auf eine Sanierung im nächsten Frühling, der vielleicht ein neues Dach bringt und frisches Wandmaterial.
Ein Huhn schlendert heran und legt den Kopf schief. Das Federvieh findet meinen Garten spannender als sein Leben auf dem Bauernhof nebenan, und das kann ich ihm nicht verübeln. »Gock!«, gluckst das Tier.
Ich glaube, es hat sich in den runden Kugelporsche verliebt, der mit ungeöffnetem Cabrioverdeck langsam über das Kopfsteinpflaster rollt. Dieses zusätzliche Sommer-Detail hätte ich mir wirklich sparen können; wenn ich mal offen fahren kann, mache ich ein Kreuz im Kalender. Vielleicht finde ich heute Nachmittag als Liebesgabe ein Ei in der Scheune und ein wehmütiges Huhn auf dem Wagenheber.
Vor dem Rathaus muss es zwei Behindertenparkplätze geben. Sehr praktisch. Ich stelle das Auto ab und schaue in den grauen Himmel. Der Nieselregen wird von einer kräftigen Windböe nach unten gedrückt. Langsam schlendere ich zu meinem Arbeitsplatz. Bei diesem Schritttempo bemerkt man kaum, dass ich ein Bein nachziehe. Humpel-Bea.
Einige Briefumschläge liegen bereits im Ausgangskorb. Was mich wirklich überrascht, ist der Anblick meines Schreibtischstuhls. Dort sitzt der Dorfsheriff Gregor Germann und hämmert nervös mit meinen Kugelschreibern auf der Platte herum.
»Bea, du musst mir helfen. Mein Magen spuckt schon Säure vor Schock.« Gregor unterbricht den Trommelwirbel, und ich wühle in den Packungen mit Kräutertee. Von seiner gewohnten vorbildlichen Gelassenheit scheint keine Prise mehr übrig zu sein.
»Die Superbullen aus der schlauen Bezirksstadt wollen einen Bericht. Und ich kann den nicht schnell genug und wahrscheinlich nicht ordentlich tippen. Dieses Formular macht mich verrückt! Hast du Zeit?«
»Du bist früh dran!«, stelle ich fest und hänge den Teebeutel in eine Tasse.
Das Wasser blubbert im Kocher. Nach und nach erfahre ich von den Plastikbeuteln mit den vermeintlichen Leichenteilen im Müllmantel.
»Sie reißen sich die Sache sowieso unter den Nagel. Warum machen sie dann nicht sofort alles selbst?«, mault sein Kollege Christoph Löffelsterz, der sich auch noch in das Kabuff quetscht.
Ich muss ein wenig hysterisch kichern. »Zerstückelte Arme und Füße aus Plastik? Ist das Kunst oder kann das weg? Die glauben wirklich, ein psychopathischer Killer könne dahinterstecken? Warum sind sie überhaupt gerufen worden?«
Gregor druckst herum. »Wir haben uns nicht getraut, näher an den Tatort zu gehen, damit alles für die Spurensicherung unverfälscht erhalten bleibt. Die Hand sah wirklich echt aus, wie gerade abgeschnitten. Wer kann denn ahnen, dass es sich um Plastik handelt?«
Christoph wirft einige rasch ausgedruckte Fotos in gestreifter Qualität auf den Tisch, um sich zu rechtfertigen. Ich versuche, die Blutstropfen zu ignorieren.
»Ihr steht also ohnehin als Dorftrottel da und sollt nun eure trugschlüssigen Beobachtungen schriftlich eingestehen«, fasse ich zusammen.
»Ich war schon immer ein Fan deiner schonungslosen, nicht komplett einfühlsamen Zusammenfassungen der Sachlage«, motzt Gregor beleidigt.
»Ausheulen kannst du dich beim Psychologischen Dienst«, setze ich eins drauf.
Gregor bekommt seine Teetasse in die Hand gedrückt, und ich starte den Rechner.
Gemeinsam formulieren wir einige Sätze, und ich rate dazu, Tatortfotos aus entsprechend großer Entfernung einzufügen. Die Körperteile in Tüten sehen wirklich nicht sonderlich appetitlich aus, gestehe ich ein wenig widerstrebend ein. Allmählich hellen sich die Gesichter der Polizisten auf. Der Bericht macht Fortschritte. Die ersten Besucher betreten das Rathaus, begrüßen mich und stellen Fragen. Ich gebe Auskunft und rücke meine Brille gerade. Die Polizisten halten sich diskret im Hintergrund. Ich ziehe die Daten auf einen Stick. Gregor braucht das Dokument nur unten in der Polizeistation zu öffnen und in das Formular zu kopieren. Einige Details klären wir noch, und dann zischen die beiden ab. Quasi mit Tatütata in ihren Bullenkeller.
Und ich atme durch. Die ersten beiden Stunden meines Horrortages sind damit rasch vorübergegangen. Ein paar Telefonate, meine Kollegin Annabell kommt zwitschernd auf einen schnellen Kaffee vorbei, und dann ist es Zeit, mein Kabuff zu verlassen und mich um die Post zu kümmern.
Langsam gehe ich durch das putzige Städtchen Nümbrecht. Die Häuser sind alt, die Straßen schmal und die Alleebäume mickrig. Die Gärtner des Bauhofs bepflanzen gerade die Rabatten um den Brunnen neu und nicken mir höflich zu. Man kennt sich. Mit der Schwester des einarmigen John war ich in einer Klasse. John heißt eigentlich Johannes, was ihm zu fromm und langweilig war. Weil der einarmige Bandit sein Lieblingsgerät in der Spielhalle war, hat er seinen Spitznamen bis heute weg.
John hebt den Wasserschlauch in meine Richtung, ich winke dankend ab. Der bergische Landregen von oben reicht mir. John grinst und stiert mir mit einem unglaublich intensiven Blick, den ich im Rücken spüre, hinterher. Mein schiefer Gang ist mir peinlich und unangenehm. Das sind Momente, die ich hasse. Angestarrt und bemitleidet zu werden ist das Letzte. Angespannt überquere ich die verkehrsberuhigte Straße, deren improvisierte Vorfahrtsregeln kein Mensch kapiert. Besonders auswärtige Fahrer blicken ratlos durch die Windschutzscheibe und schleichen dann ziellos um den Brunnen.
Beim Bäcker sitzen einige Herren und Damen im Frühstücksraum. An der Eisdiele lärmt eine Schulklasse, und die Fensterscheiben der Fahrschule werden von professionellen Kräften gereinigt. Ich grüße die Leute. Meine Knöchel tun weh, irgendetwas drückt am Schuh. Oder bilde ich mir das ein, weil ich heute vor dreißig Jahren zum Tragen dieser fetten Teile verurteilt wurde?
Jeder hinkende Schritt kostet mich Überwindung, ich schwanke zwischen Wut, Unverständnis und stummen Klagen, warum ausgerechnet ich diesen Unfall haben musste. Es nützt nichts. Das Jammern habe ich mir abgewöhnt. Stattdessen betrachte ich meine Umwelt mit meinem unbestechlichen, aufmerksamen Blick. Es lenkt mich vom eigenen Unvermögen ab, und es macht Spaß. Die Leute hier nehmen mich nicht sonderlich ernst, schließlich bin ich die verhuschte Eule aus dem Rathaus, die ziemlich viel Pech im Leben hatte. Diese Fehleinschätzung erleichtert meine Beobachtungen. Manchmal kommt es mir vor, als gehörten die Bewohner dieses Städtchens zu einer Sammlung von aufgespickten Exponaten, ähnlich den Schmetterlingen in Schaukästen. Sie präsentieren mir ihr schönes Aussehen. Aber ich blicke tiefer in ihr Inneres, bin der Detektiv mit der Lupe und habe diebische Freude daran, Geheimnisse zu entdecken oder sie ihnen zu entlocken.
Ein mir sehr bekannter brauner Hut überquert die Straße. Mein Nachbar Günther Germann, der seinen Bauernhof nur in seltenen Ausnahmefällen verlässt, hebt grüßend die Hand. Ich winke zurück, doch ich bin nicht gemeint, und mein »Hallo« bleibt halb gesagt im Hals stecken. Ein älterer Herr biegt um die Ecke und bleibt kurz bei meinem Oedinghausener Nachbarn stehen: »Und?«
Der nickt: »Muss. Selbst?«
»Ja«, antwortet sein Gegenüber und setzt sich wieder in Bewegung. Hoch lebe die intensive Kommunikation, denke ich belustigt. Warum lange Reden schwingen, wenn mit wenigen Worten die Quintessenz des Lebens auf den Punkt gebracht werden kann?
Wortkarg, eigensinnig und traditionell, das scheinen die tragenden Säulen des oberbergischen Miteinanders zu sein. Deshalb überrascht mich der Blick in das jahrelang unverändert gehaltene Schaufenster des Nagelstudios »Besser Balzano«. Es sieht anders aus. Die silbernen Wuschel-Stanniol-Girlanden und die blonde Schaufensterpuppe sind verschwunden. Aktuell wird Weihnachtsstimmung im beginnenden Sommer verbreitet. Wo bleiben die Lebkuchen? Ein großer plüschiger Nikolaus mit roter Filzmütze blickt von seinem Kamin in Richtung eines scharf geschliffenen Beils. Auf einem Plakat daneben steht: »Rettet den Weihnachtsmarkt mitten im Dorf! Der dritte Advent muss bleiben!«
Ich beginne zu grinsen. Wir haben zwar ein marodes Rathaus voller Bausünden, aber der Bürgermeister ist neu und ein Auswärtiger. Wobei »neu« in unseren Breiten selbst nach vier Jahren noch seine Berechtigung hat. Roman Giesbrecht hat frische Ideen, die er allerdings mit der Axt im Walde durchsetzt. Er beabsichtigt, den schwächelnden Weihnachtsmarkt, der traditionell(und wenn ich traditionell sage, meine ich seit mindestens dreihundert Jahren, und das muss genauso bleiben) am dritten Advent stattfindet, zu verlegen. Rund um die Kirche und entlang der Hauptstraße stehen schnuckelige Buden, die weihnachtliche Produkte, Glühwein und andere Sentimentalitäten anbieten. Last-minute-Weihnachtsgeschenke und natürlich der Weihnachtsbaum-Verkauf mit dem begehrten Liefer- und Abholservice, also ein Christbaum-Komplett-Paket. Man kann sogar eine Art Wichtel oder Wichteline zum Schmücken buchen. Und im neuen Jahr häckseln die Arbeiter des Bauhofs die Weihnachtsbäume zu Rindenmulch, den Alexander Jürgens, Nischen-Geschäftsmann und Jäger in einer Person, verkauft. Angeblich für einen guten Zweck, aber den hat bisher niemand aufgetan.
Bürgermeister Giesbrecht will den Markt an den Knottenweiher, zum spillerigen Helmut, der seinen Hirtenstab unbeweglich in die Luft hält, und damit näher zum Rathaus verlegen, fernab von Kirche und Läden. Noch dazu soll die Sause am ersten Adventswochenende starten. Die an der Hauptstraße ansässigen Händler sehen ihre Gewinne am verkaufsoffenen Wochenende dahinschmelzen. Die Betreiber des Wellnesstempels »Jungbrunnen am Teich« sind einverstanden. Sie öffnen die Pforten, bieten Verpflegung und ein Verwöhnprogramm.
Man munkelt, dass sie eine kleine Touristikmesse für Ferien im Schnee und Wintersport aufziehen wollen, der Kommerz lässt grüßen. Wahrscheinlich ist ein nettes Sümmchen geflossen, oder man hat dem Bürgermeister anderweitige Zugeständnisse und Versprechungen gemacht. Auch die hiesige umsatzstarke Firma für Wurstwaren scheint nicht abgeneigt, auf den Zug der Veränderung aufzuspringen. Das weiß ich aus verlässlicher Quelle.
Die Proteste und die Entrüstung der Bevölkerung schlagen hohe Wellen. Es wird wohl einen organisierten Widerstand geben. Die Pfarrer wettern wider die Entsinnlichung von Weihnachten und beharren darauf, die Kirche im Kern des Marktes zu lassen. Die Händler wollen den Markt vor ihren eigenen Ladentüren, das Weihnachtsbaum-Geschäft würde vier Wochen vor dem Fest zum Erliegen kommen, und die Nachbargemeinden sind garantiert verärgert.
Das kümmert den Bürgermeister nicht. Ich weiß, dass er bereits einen Plakatentwurf hat. Gestaltet von einer Druckerei weit weg, und bald werden bestimmt die großformatigen Flyer und runden Aufkleber aufgelegt und ans Rathaus geliefert werden.
Lange Finger(nägel)
»Gerda« habe ich die Dame mit den aufgeklebten Fingernägeln in Gedanken getauft. Gerda konnte den Autoverkehr auf der verrückten Kreuzung begutachten, die Auslage des Blumengeschäfts und den Betrieb beim Friseur. Gerda wohnte im Schaufenster und ist blond. Mit dem Nikolaus hat sie keinerlei Ähnlichkeit. Er hat sie verjagt und verdrängt. Das Beil liegt drohend neben Ausstechförmchen und Glitzersteinen. Ich öffne die gläserne Tür, und es bimmelt wie früher.
»Hallo, Bea. Neue Fingernägel sind bei dir eher nicht gefragt.« Manuela Balzano mustert mich abschätzig. Sie streicht ihre schwarzen Locken zurück und präsentiert das stark geschminkte Gesicht. Hastig balle ich meine Hände zu Fäusten und verberge die Fingerspitzen mit den glanzlosen Nägeln, die zwar Risse und Reste von Gartenerde, aber keinen aufgeklebten Schnickschnack aufweisen. »Willst du bei unserer Unterschriftenaktion gegen diese Weihnachtsmarkt-Kiste mitmachen?« Die Chefin, mit angespitzten und mit Strasssteinen versehenen Plastikplatten, die fünf Zentimeter über die Kuppen hinausragen, wedelt mit einem Papier vor meiner spitzen Nase herum.
»Ich habe schon«, lüge ich. »Beim Bäcker«, füge ich hinzu und hoffe, dass mein Schuss ins Blaue ein Treffer war.
Die Liste wandert bedauernd auf die Theke zurück. Kein Widerspruch, gut. Ich starte meinen Angriff.
»Nettes Schaufenster! Aber der Nikolaus hat keine dekorierten Fingernägel.«
»Hahaha!« Manuela Balzano lässt ein affektiertes Lachen los. Ich bemerke, dass sie die Beine yogamäßig verknotet. Braucht sie Entspannung? Der Baum…
»Habt ihr die blonde Schaufensterpuppe mit der Leggings im Leopardenmuster ausgemustert?« Ich gebe keine Erklärung ab. Ich habe gelernt, dass das nicht nötig ist. Die meisten hören nicht wirklich zu, ich komme lieber direkt zum Thema.
»Die liegt in der Abstellkammer für später.« Manuelas Fingernägel blinken in Richtung der freigelegten Dachbalken, und ich kann in ein Kabuff spähen. »Jetzt müssen wir erst den Weihnachtsmarkt retten, bevor uns diese neumodischen, verschrobenen Ideen des Bürgermeisters Kopf und Kragen kosten.«
Eine hektische Bewegung lässt mich aufmerksam werden. Charlotte, die Aushilfe, blickt mit zusammengebissenen Lippen auf den Boden. Ihre fransigen, langen blonden Haare verbergen die Augen. Da scheint irgendetwas nicht im grünen Bereich zu sein. Eine elegante Dame lässt die Ladenglocke ertönen und wird säuselnd begrüßt. Eine Unterschrift landet auf der weihnachtlichen Protestliste, und Tilly von Palmolive lässt grüßen. Die Fingerspitzen der Kundin landen in einem Handbad, das garantiert kein Spülmittel enthält. Die Chefin hat mich vergessen, und mir gelingt ein Abstecher in Richtung Abstellkammer. Die schmale Tür steht offen. Pappschachteln, Schüsseln in allen Größen, Handtücher, Putzmittel in einem wüsten Durcheinander, aber keine Gerda. Nicht einmal die Tierfell-Leggings. Ich gönne mir einen weiteren Blick. Manuela Balzano schnattert etwas von Paraffinbad und Sauna für die Hände. Gerda ist verschollen. Dafür steht Charlotte plötzlich neben mir und zischt mir hektisch etwas ins Ohr.
»Zeichen setzen!«, glaube ich zu verstehen. Charlotte weiß etwas über Gerda, und in einem günstigeren Moment, wenn die Chefin nicht dabei ist, werde ich nachhaken. Ich speichere sie auf meiner To-do-Liste und suche mit Verspätung die Schließfächer in der Post auf.
Dort sind die Plastikbeutel mit dem makabren Inhalt Hauptgesprächsthema. Eine Dame will sogar einen zahnlosen Schädel gesehen haben.
»Das ist der Katzenfänger! Er will ablenken. Heute Nacht holt er unsere Haustiere!«, vermutet eine andere schrille Stimme.
Trotz der allgemeinen Aufregung streifen mich die üblichen mitleidigen Blicke. »Wie die Eule wieder angezogen ist. So findet die nie wieder einen Mann.«
Trotzig könnte ich ihnen antworten: »Und wisst ihr was, ich will auch keinen mehr. Ich bin sehr zufrieden. Wenn die anderen Schachteln, die nur außen schön sind und von innen hohl oder voll Unrat, für ihre Lebensgefährten das Bügeleisen oder den Wischmopp schwingen, sitze ich gemütlich auf dem Sofa. Leere Bierkisten gibt es in meinem Haus nicht und liegen gelassene Unterhosen ebenso wenig. Niemand schnarcht mir ins Ohr oder legt mitten in der Nacht lüstern die Hand auf meine Brust. Ich habe durchaus Erfahrungen als Ehefrau, wenn auch keine sonderlich guten.« Langsam komme ich wieder in der Wirklichkeit und in der realen Poststelle an. Statt das Mitleid frech zu ignorieren, habe ich die Kuverts sinnlos neu sortiert und dabei weiter den allgemeinen Mutmaßungen gelauscht.
Vor dem Tresen hat ein älterer Herr vor Aufregung glatt vergessen, wie viel Geld er von seinem Sparbuch holen wollte. Ratlos zuckt er mit den Achseln.
»Vielleicht fünfhundert Euro wie üblich?«, brüllt die Angestellte über die Paketwaage hinweg. Die grüne hügelige Welt ist klein, man kennt sich. Der Mann greift an sein Hörgerät. Die lautstarke Kommunikation geht weiter.
»Es sind noch fast zehntausend Euro auf dem Konto, Herr Böhne. Sie können ruhig ein paar hundert abheben. Oder brauchen Sie mehr, weil Sie etwas Größeres für Ihr künstlerisches Hobby gekauft haben?«
»Getauft? Was hat die Kirche mit meinem Geld zu tun?«, brummt der Mann ärgerlich. Er hämmert mit seinen krummen, knotigen Fingern auf den bunten Tasten herum. Die Angestellte stöhnt verzweifelt.
»Moment!«, bestimmt sie und reißt das graue Kästchen an sich.
Dabei fällt eine Kladde, auf der die Unterschriften gegen die Verschiebung des Weihnachtsmarkts sind, zu Boden. Ich gebe die Briefe am zweiten Schalter ab und nehme weiße, braune, wichtige und bedeutungslose, große und kleine Umschläge aus dem Postfach an mich.
Wer macht da eigentlich so massiv mobil? Wer steckt genau dahinter? Wie konnten sie es schaffen, ihre Aktion zu planen und schlachtplanmäßig zu starten, ohne meine Aufmerksamkeit erregt zu haben? Ich glaube, ich schwächele. Um meine Schlappe wettzumachen, muss ich einen Vordruck in die Hand bekommen und genauer betrachten. Ich schlendere langsam zur Theke, hebe betont langsam die Kladde auf und versuche, die Einzelheiten aufzunehmen. Das sieht sehr professionell aus, und ich zähle zehn Signaturen. Eine gewisse Form muss gewahrt bleiben, es gibt Vorschriften über diese Eingaben, sonst sind sie ungültig.
Wer hat Ahnung von diesen Dingen? Ein Jurist, und ich vermute, dass Jörg Arend, der Rechtsanwalt und notorische Gegenspieler des Bürgermeisters, seine überschäumende Kompetenz eingebracht hat. Jörg Arend verkehrt nicht in niederen Kreisen, daher reden wir nie miteinander. Und in seiner Kanzlei arbeitet niemand, der mit Informationen herausrücken würde, lauter integre Gestalten oder genauso hochnäsig wie der Chef.
Mein Chef tobt. Ich höre seine cholerische Stimme durch die dünnen Wände des Rathauses, als ich die Umschläge bearbeite.
Der Bürgermeister wettert und schreit, wahrscheinlich fliegt seine Spucke meterweit durch sein Büro. Für einen so mickrigen Kerl versprüht er eine Menge klebrigen Speichel und Ärger. Der Politiker will hoch hinaus. Ich habe einige Telefonate und Treffen mitbekommen, denn erstens: Die Telefonanlage ist überfordert und morbide. Die Gespräche laufen über meinen Apparat, und ich kann sie mühelos auch nach der Weitervermittlung belauschen. Zweitens: Die gut informierte Sabine Müller, ihres Zeichens Sekretärin des Bürgermeisters, ist meine Freundin. Der Terminkalender des ersten Mannes im Dorf ist nie verschlossen und seine Meinung bedingt öffentlich. Ich muss lächeln und versuche, das Schimpfen des Bürgermeisters im Stockwerk über mir auszublenden, als ein Anruf hereinkommt.
»Nein, für die Bürgersprechstunde bei Herrn Giesbrecht müssen Sie sich nicht anmelden, Frau Schmidt. Der Bürgermeister ist dienstags von fünfzehn bis achtzehn Uhr für alle zu sprechen«, flöte ich in den Hörer. Dienstags fahren unsere Polizisten durch die Gegend, weil sie das Auto haben. Den Bürgermeister hinterlassen sie ungeschützt. Ob System dahintersteckt? »Sie können einfach zu uns ins Rathaus kommen, Frau Schmidt. Bisher waren die Wartezeiten kürzer als beim Arzt.«
»Es geht um den Weihnachtsmarkt!«, keift es am anderen Ende der Leitung. Mein Ohr beginnt zu schwingen und zu zittern.
»Ja, da stehen gewaltige Änderungen an.« Bevor Frau Schmidt mich mit weiteren Details eindeckt, hänge ich eilig ein scheinbar zuvorkommendes »Bis bald, Frau Schmidt« an und beschließe, meine Mittagspause um fünf Minuten vorzuverlegen.
Ich verlasse mein Kabuff, das mit einem modernen, einladenden Empfangsbereich wirklich nichts zu tun hat, und gehe Richtung Pizzeria. Eine Pasta mit Salat und ein starker Espresso beim Italiener an der Ecke müssen sein, bevor das Nachmittagsprogramm weitergeht.
Nach einer Dosis Koffein und Kohlehydrate steigt mein Tatendrang. Der einarmige John, die Gießkanne, Schaufeln und Arbeiter des Bauhofs sind verschwunden. Im Beet rund um den Brunnen blühen Stiefmütterchen in Gelb und Lila. Im Gegensatz dazu wirken die Dorfpolizisten in Dunkelblau eher schlicht. Sie stehen wie festgenagelt vor der Tür des provokativ weihnachtlich aufgemotzten Ladens von Manuela Balzano. Letztere redet hysterisch, kein guter Tag für die Kellerbullen.
»Unsere Gegner schrecken vor nichts zurück. Jetzt haben sie den Nikolaus-Weihnachtsmann und das neue Beil mitgehen lassen. Es fehlen bestimmt noch mehr Sachen!«, quengelt die Ladenchefin.
Ich humpele näher heran, die Ohren auf Empfang und die Augen im leeren Schaufenster. Keine Scherben, registriere ich.
»Ich bin nur ganz kurz weg gewesen. Als ich vom Einkaufen wiederkam, war mein Geschäft verwüstet«, klagt die Betreiberin des Nagelstudios. Ich sehe einen umgeworfenen Stuhl und erfahre, dass die Aushilfe Charlotte, mit der ich unbedingt wegen Gerda sprechen möchte, bereits gegangen ist. »Die Unterschriftenliste ist fort. Die Schurken haben es auf unseren Widerstand abgesehen!«, tönt Manuela und strafft ihren Rücken. Sie erinnert mich ein bisschen an Robin Hood, und ich halte Ausschau nach Pfeil und Bogen. Stattdessen sehe ich die Fingernagel-Waffen, eine schwarz gefärbte Mähne und zentnerschweren Modeschmuck.
Gregor Germann ergreift die Initiative: »Aber du hattest die Tür verriegelt, oder, Manu?«
Clever, der Polizist. Er lässt Robin-Hood-Manuela zunächst Dampf ablassen, nutzt die Zeit zur Beobachtung und stellt dann seine klugen Fragen. Manuela Balzano, Beschützerin der Waisen und Witwen, sinkt ein wenig in sich zusammen.
»Ich glaube schon. Aber manchmal vergesse ich es. Schlüssel und ich stehen auf Kriegsfuß.« Der Redefluss stoppt. »Als ich wiederkam, stand die Tür offen, und diese Kerbe ist frisch!«, erklärt sie eifrig, begierig, ihre Gedächtnislücke auszumerzen und von ihrem Versagen abzulenken.
Die Polizisten treten näher, und ich schließe mich ihnen dreist an. Niemand hindert mich oder nimmt Notiz von mir. Eine schmale, ungefähr zwanzig Zentimeter lange Scharte im Türblatt verschandelt das Aussehen des gepflegten Fachwerkhäuschens. Mit Sicherheitsstandards und Alarmanlangen sind die Gebäude selten versehen.
Ich überlasse die Beamten und Manuela Hood-Balzano ohne Liste, aber engagiert im Kampf gegen das organisierte Weihnachtsmarkt-Verbrechen ihrem Schicksal.
Vor dem Rathaus steht der kleine schwarze Flitzer des lokalen Radiosenders. Ein bärtiger Reporter stolpert gerade aus der Tür und wirkt ein wenig ratlos.
»Kann ich Ihnen helfen?«, frage ich zuvorkommend.
»Ich suche die Polizisten«, sagt der Mann. Sein Sakko ist sportlich zerknittert, das T-Shirt darunter blütenweiß, und die Jeans sitzt knackig.
»Die ermitteln gerade in Sachen Einbruch«, berichte ich und gebe eine Lagebeschreibung von Manuela Balzanos Schmirgel-Bude. »Wollen Sie etwas über die Plastiktüten senden?«, setze ich nach. Quid pro quo, ich habe eine Auskunft gegeben, jetzt will ich ebenfalls etwas wissen.
Der Reporter nickt. Verschwörerisch flüstert er in mein Ohr, das im Inneren garantiert vor kondensierter Spucke trieft: »Ich habe einen guten Draht zur Bezirksstadt. Dort laufen die Computer heiß. Sie suchen im Register nach Auffälligkeiten, Straftätern und Informanten.« Die Stimme klingt auch leise gut. Sie kommt mir sehr bekannt vor.
»Spannend! Sprechen Sie Ihren Beitrag selbst? Wann kann ich ihn hören?«, schleime ich und poliere das Ego des Bartträgers auf. Er holt eine Visitenkarte aus der Jacke, zwei weitere segeln nach unten. Er kritzelt die Sendezeit auf die Rückseite und präsentiert mir das Papierstück. »Carl-Ingo Breisler; Ihr Lokalradio im Bergischen auf103,5«, lese ich. Vielleicht kann ich den guten Draht zum Hörfunk oder zur Polizei-Chefbehörde nutzen.
»Darf man mit dem Wagen dorthin fahren oder ist die Zufahrt gesperrt?«, will der sportliche Reporter wissen. Seine Augen sind zu blau für diese Welt.
»Die Hauptstraße ist steinig, voller Schlaglöcher und mit kaputtem Kopfsteinpflaster, aber befahrbar«, gebe ich Auskunft und verspreche, mir seinen Bericht anzuhören. Auf seine Visitenkarten habe ich dezent meinen großen orthopädischen Schuh gestellt. Der Bärtige schwingt sich in den Kleinwagen. Die Scheibenwischer quietschen los, obwohl der Regen etwas nachgelassen hat. Ich lasse ihm einen Vorsprung und nehme die rechteckigen bunt gemusterten Karten an mich, bevor ich in meinem Kabuff verschwinde.
»…und die Schaufensterpuppe fehlt ebenfalls«, berichtet Christoph Löffelsterz kurz vor Feierabend, als er einen amtlichen Kaffee in meinem Kabuff trinkt.
Ich werde Charlotte nicht aus dem Blauen heraus ohne echte Beweise verpfeifen. Ich schweige mich über mein ungenaues Nichtwissen und die Beobachtung zu Gerdas Verbleib aus. Ein bisschen auf eigene Faust ermitteln kann nicht schaden und bringt Zerstreuung und Pep in den Alltag. Eine Katze, einen dreibeinigen Dackel und das Fahrrad des Elektrikers meines Vertrauens habe ich bereits aufgespürt.
»Vielleicht haben die Leute vom Bauhof etwas gesehen. Die haben im Beet am Brunnen Maulwurf gespielt«, schlage ich zum Ausgleich für mein portioniertes Schweigen vor.
»Hm, die haben alle früher Schluss gemacht. Der einarmige John hat Geburtstag. Ganz ehrlich, nüchtern hörten die sich nicht mehr an.« Christoph nippt an seiner Tasse und verzieht unwillig das Gesicht. »Und noch einmal die Wahrheit, nichts als die Wahrheit: Dieses Gebräu schmeckt widerlich. Ist die Maschine frisch entkalkt oder was?«
»Oh!«, sage ich vieldeutig. Soll er mich ruhig für einfältig und vergesslich halten. Das erleichtert mein Doppelleben. »Leichenteile am frühen Morgen, Einbruch am Mittag, was passiert heute noch?«, frage ich lahm.
»Tod durch vergifteten Kaffee!«, sagt Christoph angewidert.
»Vielleicht gibt es eine Verbindung?«, ignoriere ich seinen wenig scharfsinnigen Beitrag und ernte einen vernichtenden Blick, bevor der Polizist mitsamt Tasse und ungenießbarem Inhalt das Feld räumt.
Der Bürgermeister kommt gerade wutschnaubend die Treppe herunter. Ein Mann im Lodenanzug zerrt ungebührlich an Roman Giesbrecht herum und verfolgt ihn, ohne sich abhängen zu lassen. Ein seltsames Gespann, einer stämmig und groß, der andere klein und aufgeplustert. Ich erkenne Alexander Jürgens; durchaus korrupt und nicht so integer, wie der konservative Aufzug es weismachen will. Ich höre zunächst nur Wortfetzen, die »Weihnachtsmarkt« bedeuten könnten. Das ungleiche Paar kommt näher.
»Roman, so geht das nicht. Wir hatten eine Absprache. Das Hirschgeweih bleibt hängen!«
»Es muss weg!«, brüllt Giesbrecht und verteilt Spucketröpfchen im Rathaus.
Der Jäger antwortet mit hochrotem Gesicht: »Du kannst die Wünsche deiner Freunde, der Bürger, deines Nachbarn nicht mit Füßen treten.«
Das kann der Bürgermeister offensichtlich schon. Er trampelt verärgert weiter, die Augen entschlossen zusammengekniffen und die Ohren augenscheinlich auf Durchzug. Ohne zu grüßen, verlässt der Chef das Rathaus.
Gegrilltes Seil
Zu Hause öffne ich die Schiebetür zur Veranda. Mein plüschiger Begleiter Yeti hat nur auf diesen Moment gewartet und flitzt wie ein geölter Blitz hinein. Er streicht um meine Beine, die plötzlich zu zittern beginnen.
»Nein!«
Mit weit aufgerissenen Augen starre ich in den Garten. An dem alten, halb kahlen Apfelbaum bleibt der Blick kleben, löst sich keinen Millimeter. Ein Tau schaukelt an einem mächtigen Ast. Die Schlaufe weit genug für einen Hals, die Knoten kunstvoll verflochten, als hätte ein Henker persönlich Hand angelegt. Mir wird übel, dem Kater sind meine ungezielten Bewegungen unangenehm. Er macht einen unfreundlichen Buckel und faucht. Ein Seil für den Galgen aufgehängt, bedrohlich, unheilvoll. Ich knalle die Tür scheppernd zu, bedecke mein Gesicht mit den Händen. Ich will nichts von diesem grauenhaften Arrangement in meinem Garten sehen. Doch ich weiß, dass die geknotete Leine da ist. Wer?, frage ich mich. Warum ausgerechnet heute? Am Tag des Unfalls, am Jubiläum des Schmerzes?
Die Vergangenheit holt mich ein. Oder befindet sie sich bereits auf der Überholspur?
Jemand war auf meinem Grundstück. Jemand, der weiß, wo ich wohne, jemand, der eines meiner finstersten Geheimnisse zu kennen scheint und mit mir verknüpft. Der die dunklen Schatten zu deuten weiß, die ich gut verborgen hatte. Und von denen ich hoffte, dass kein Licht der Welt sie jemals zum Zucken bringen würde.
»Ruf die Polizei!«, wispert mir eine Überlegung, die zur Gattung Vernunft gehören will, zu.
»Niemals!«, wiegelt das Geflecht aus Lüge und Schuld entschieden ab. »Die Vergangenheit muss ruhen.«
Meine Gedanken führen ein bedrohliches Eigenleben. Keiner ist sinnvoll, nicht eine Idee bringe ich zu einem erfolgreichen, glücklichen Ende. Wahrscheinlich ist das für Mörderinnen niemals vorgesehen.
Zwei Stunden und einen Cappuccino mit geschäumter Milch später habe ich mich so weit in der Gewalt, dass der Amoklauf im Hirn gewaltsam niedergerungen werden kann. Von der Logik oder so. Das Böse lauert in unserem Dorf! Ich wende mein hart angelesenes Krimiwissen an: Das Haus, den Briefkasten, den Garten sollte ich nach Spuren oder anderen Botschaften absuchen.
Ich muss die Hinterlassenschaften vernichten, bevor meine Mitbürger etwas sehen, finden und blöde Fragen stellen. Ich brauche eine unauffällige Möglichkeit, um mein Grundstück zu überwachen. Ich muss weitere böse Überraschungen verhindern oder ihnen wenigstens auf die Spur kommen. Da kommt der Elektriker meines Vertrauens in Frage.
Ein Teil von mir bleibt zitternd auf dem Sofa und kämpft mit einer gewissen Übelkeit. Der andere hat sich Stiefel angezogen und betritt in Begleitung eines scharfen, gezackten Messers und eines großen Feuerzeugs den Garten. Keiner darf es sehen. Niemand soll sich erinnern. Ich schleiche zur alten Scheune. Das Huhn fühlt sich von meinem Besuch empfindlich getroffen und beäugt mit schief gelegtem Kopf den stillgelegten Schwenkgrill, den ich mühsam hinter dem alten Traktor hervorziehe. Im Bergischen hat fast jeder der Alteingesessenen so ein Dieselross. Henry, mein verstorbener Ehemann, hat das Ding restauriert, doch nun verstaubt es, genauso wie die Röststelle an Kette und Ständer.
Henry konnte nicht kochen, aber kein Grillsteak war vor seiner heißen Leidenschaft sicher. Verstohlen blicke ich mich um, versuche krampfhaft, nicht zu auffällig zu wirken. Meinem Gefühl nach gelingt mir das nicht einmal ansatzweise. Fahrige Bewegungen, das Messer liegt wie ein Klotz in meiner feuchten Hand. Ich umklammere den Griff fester. Mein Körper gehorcht den Vorgaben des Gehirns äußerst widerwillig. Die Augen mustern misstrauisch den Garten.
Von der Terrasse zerre ich einen Stuhl über die Wiese. Unter dem Apfelbaum bohren sich die vier Füße ins weiche, nasse Gras, bis die Sitzgelegenheit nicht mehr kippelt. Mühsam klettere ich hinauf, erfasse das Tau und beginne zu säbeln. Obwohl die Klinge scharf ist, macht das Seil Probleme. Die Fasern widersetzen sich. Der Ast, an dem die Schlaufe verzurrt wurde, ächzt leise. Ein Tropfenregen ergießt sich über mich, als die Blätter ungnädig geschüttelt werden und zu wackeln beginnen. Das Wasser läuft meinen Nacken hinunter. Ich bekomme eine Gänsehaut.
Beobachtet mich jemand? Kommt der Urheber dieses Szenarios zum Tatort zurück, um sich an meinem verschreckten Anblick zu weiden? Wird er mich angreifen? Oder ist ein fieser Spanner, der Angst und Schrecken verbreitet, in unserer beschaulichen Gemeinde unterwegs? Ein Psychopath?
Die Bilder der abgetrennten Hand schießen mir raketengleich in den Sinn. Meine Spucke hat im Mund eine nervöse Lache gebildet. Sie schmeckt sauer. Mein Arm wird lahm, der Griff des Küchenmessers verrutscht. Wie sollte ich einem Arzt den Grund für eine Fleischwunde nennen können? Ich ermahne mich zu größerer Vorsicht. Bisher hat anscheinend niemand mein Tun bemerkt. Das Tau wird an der Bearbeitungsstelle deutlich dünner. Erste Bündel drehen sich auseinander. Durch, endlich. Hastig packe ich die Enden des Seils, zerre die Reste vom Baum und hinter mir her.
Der Flammenwerfer klickt, Qualm steigt auf, verräterischer Gestank, ominöser Rauch. Das feuchte Zeug brennt nur zögerlich an. Es dauert nicht lange, und mein Nachbar Günther Germann schaut erst über die Hecke und eilt anschließend auf mein Grundstück. Ob seine Frau Ilse ihn geschickt hat, weil sie selbst gerade wegen Lockenwicklern oder behandelten Warzen unpässlich ist?
»Alles klar?«, fragt Bauer Günther besorgt. Er drückt seinen Hut tief in die Stirn. Einige Strähnen seines dünnen Haars sind verrutscht. »Bei dir brennt es!«
Ich kann meinen Blick kaum vom Schwenkgrill lösen. Hier kokelt kein Holz, das ist klar. Ich bücke mich, finde ein paar alte Blätter vom letzten Herbst und werfe sie in die Flammen, decke das verräterische Glutgut zu.
Es stinkt und faucht. Günther Germann hustet. Er steht nun dicht neben mir.
»Ich wollte ausprobieren, ob der Grill noch einsetzbar ist«, starte ich einen lahmen Erklärungsversuch.
»Ach, der hält ewig…«
Im Gegensatz zu deinem Mann!, denke ich den Satz zu einem unrühmlichen Ende. Aber Günther redet glücklicherweise mit anderen Worten weiter. »Da hat dein Mann Henry, Gott hab ihn selig, Qualität angeschafft.«
Wahrscheinlich von meinem Geld, denke ich und verberge den Griff des Messers in einer hastig umgeschlagenen Falte des alten Parkas. Günther hat einen Silberblick, trägt eine Brille schief auf der Nase und ist die Gutmütigkeit in Person. Er ist sehr interessiert an seiner Umwelt und hilfsbereit.
»Hast du Brunhilde gesehen?«, fragt er.
Ich gebe nach einer kurzen Überlegung Auskunft.
»Stört sie dich?«, will der Bauer wissen. »Dann fange ich sie sofort aus der Scheune.«
»Nein, nein, sie kann ruhig beim Kugelporsche und beim Traktor bleiben. Aber hast du vielleicht eine Gans, die du mir leihen könntest?«, beeile ich mich zu sagen.
Günther lächelt. Ich weiß nicht, ob er mich anschaut. Seine Blickrichtung ist abenteuerlich.
»Als Grillgut statt der Blätter und des anderen, garantiert ungenießbaren Krempels? Vielleicht gegen die Schnecken? Oder brauchst du ein Wach-Tier? Hier passieren gerade gruselige Dinge. Erst der Polizeieinsatz am Wald und später der Einbruch bei Manuela.«
Günther wirkt so, als könne er die Vorgänge nicht fassen. Als Vater eines Dorfsheriffs ist er bestens informiert und zählt eins und eins zusammen. Seine Frau Ilse kitzelt bei einem guten Mittagessen oder einem Stück hausgemachten Kuchen so manches aus ihrem Gregor heraus. Natürlich streng vertraulich.
Allmählich kann ich klarer denken. Die Panik hat sich im aufsteigenden Rauch verflüchtigt und nur die hartnäckige Vision übrig gelassen. Günther hat keine Gänse, der Hofhund hört schlecht und humpelt schlimmer als ich. Dafür bringt mir der Bauer eine kurze Bedenkzeit später einen Karton Eier und einen Liter frische Milch.
»Soll ich Gregor Bescheid sagen? Er würde gewiss häufiger bei dir vorbeigehen und aufpassen«, bietet Günther an. Er will mich mit seinem Sohn Gregor verkuppeln. Ilse möchte endlich Enkelkinder, und die würden sogar nebenan wohnen, praktisch.
Eierwurf
Meine Ermittlungen haben nichts ergeben. Rastlos tigere ich im Wohnzimmer auf und ab. Was soll ich unternehmen? Wie geht diese Kiste aus? War das Seil nur ein blöder Zufall, oder kommt etwas nach? Wer steckt bloß dahinter? In Gedanken zähle ich die Personen auf, die damals am Tatort, hier im Fachwerkhaus, waren. Der Pfarrer Kraus, mein Hausarzt Dr.Knecht, später der Bestatter. Noch jemand? Ungebetene Zeugen? Die Klingel, die müde und leise scheppert, lässt mich zusammenzucken. Besuch? Um diese Uhrzeit?
»Bea, ich bin’s!«, ruft Gregor Germann. Seine flache Hand klopft gegen das kleine Strungsfenster. Wahrscheinlich wurde er von seinen Eltern zur seltsam debilen Nachbarin geschickt. Er ist in Zivil, die Uniform darf lüften. Und er ist einfach eine Schnitte!
Muskulöser Körperbau, ohne protzig zu wirken, ein sportliches, an den Ärmeln aufgekrempeltes hellblau kariertes Hemd, weißes T-Shirt, lässige Jeans. Und das Gesicht geht auch in Ordnung. Kantig genug für einen Mann, forschende hellblaue Augen, die viel Platz unter der hohen Stirn haben. Niemand ist perfekt.
Gregor geht wortlos in die Küche. Er setzt sich auf einen der hohen Hocker an der Theke. Dabei hat er wie nebenbei den Bilderrahmen mit den Fotos nach unten abgelegt. Das macht er jedes Mal. Es ist mein Triptychon, ein aufklappbarer Rahmen mit drei Fotos. In der Mitte sieht man Henry und mich als glückliches Brautpaar. Ich sitze auf den Stufen der Kirche, der lange Rock verbirgt die hässlichen Schuhe. Henry lehnt mit dem Rücken an der romanischen Säule und sieht unglaublich gut aus. So als gehöre ihm mindestens die ganze Welt. Rechts in meinem persönlichen Triptychon erkennt man einen nachdenklichen Henry. Die Züge nicht mehr hundertprozentig optimistisch, sondern mit Wackelkontakt. Er schaut über die Baumwipfel ins Bergische Land und steht an den geöffneten Turmfenstern vom gelben Schloss Homburg. Links ist sein Grab. Ich habe keine Ahnung, warum ich ausgerechnet diese Fotos aufgestellt habe, als eine Art Selbstkasteiung? Oder damit andere glauben, ich würde untröstlich trauern? Trauung und Trauer?
Gregor reißt mich aus meinen Gedanken.
»Bekomme ich auch ein Glas?«, fragt er geradewegs.