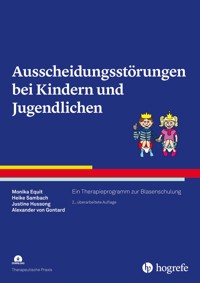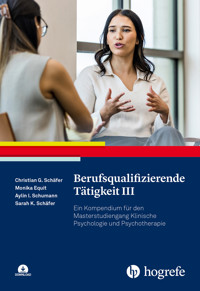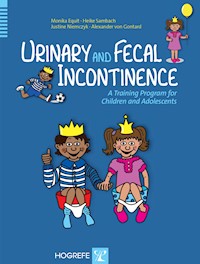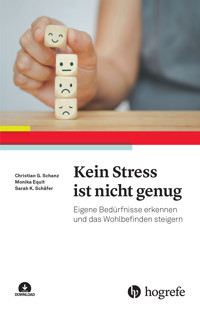
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Stress ist einer der größten Risikofaktoren für die Entstehung psychischer Erkrankungen. Stress zu reduzieren, kann uns helfen, uns besser zu fühlen. Echtes Wohlbefinden entsteht aber nur, wenn es uns gelingt, unsere psychischen Grundbedürfnisse (wie etwa das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit oder nach Selbstverwirklichung) zu erkennen und zu erfüllen. Dabei kommt es jedoch auf die richtige Balance an, denn langfristige Bedürfnisbefriedigung geht immer auch mit Herausforderungen und Belastungen einher. Ziel des vorliegenden Ratgebers ist es, Leser*innen bei dem Spagat zwischen Bedürfnisbefriedigung und Stressbewältigung sowie dem Aufbau und Erhalt der psychischen Gesundheit zu unterstützen. Der Ratgeber nutzt dabei Erkenntnisse und Methoden der Resilienz- und Psychotherapieforschung und zeigt anhand alltagsnaher Beispiele, was wir selbst tun können, um unser psychisches Wohlbefinden zu fördern und unsere Widerstandskräfte zu stärken. Es geht also nicht nur darum, Stress zu reduzieren, sondern auch darum, bedürfnisbefriedigende (Lebens-)Ziele zu verfolgen, Emotionen besser zu regulieren, Resilienz aufzubauen und möglicherweise bereits bestehende psychische Erkrankungen richtig zu behandeln. Auch die Hintergründe der Entstehung von psychischer Gesundheit und Krankheit werden beleuchtet. Zahlreiche Materialien unterstützen den Transfer der Buchinhalte in den Alltag und können nach erfolgter Registrierung von der Hogrefe Website heruntergeladen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Christian G. Schanz
Monika Equit
Sarah K. Schäfer
Kein Stress ist nicht genug
Eigene Bedürfnisse erkennen und das Wohlbefinden steigern
Dr. phil. Christian G. Schanz, Psychologischer Psychotherapeut (VT), geb. 1990. 2012–2017 Studium der Psychologie an der Universität des Saarlandes. Seit 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitseinheit Klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität des Saarlandes.
Prof. (apl.) Dr. Monika Equit, Psychologische Psychotherapeutin (VT, Erweiterte Fachkunde Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie), geb. 1978. 1998–2002 Studium der Psychologie an der Universität des Saarlandes. 2007 Promotion, Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg. Seit 2014 Leitung der Psychotherapeutischen Universitätsambulanz an der Universität des Saarlandes und Venia Legendi für das Fach Psychologie. Seit 2015 Supervisorin (VT) und Co-Leitung des Weiterbildungsinstitutes für Psychotherapie Saarbrücken an der Universität des Saarlandes (WIPS GmbH).
Jun.-Prof. Dr. Sarah K. Schäfer, Psychologische Psychotherapeutin (VT, Erweiterte Fachkunde Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie), geb. 1991. 2011–2016 Studium der Psychologie an der Universität des Saarlandes. Seit 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) in Mainz. Seit 2023 Juniorprofessorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an der Technischen Universität Braunschweig.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock.com / Ratana21
Illustrationen: Christian G. Schanz
Satz: Sabine Rosenfeldt, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2024
© 2024 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3246-5; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3246-6)
ISBN 978-3-8017-3246-2
https://doi.org/10.1026/03246-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
1 Was macht Gesundheit aus?
1.1 Grundbedürfnisse
1.2 Stress
1.3 Eine Frage des Investments
1.4 Vulnerabilität – Hindernisse auf dem Weg zum Wohlbefinden
1.5 Resilienzfaktoren
1.6 Psychische Erkrankungen
1.7 Aufbau des Buches und Onlinematerialien
2 Wie man wurde, wer man ist
2.1 Die Grundausstattung
2.2 Die ersten Monate
2.3 Die Bindungsphase
2.4 Die Trotzphase
2.5 Das Vorschulalter
2.6 Das Grundschulalter
2.7 Adoleszenz
2.8 Entwicklung der Grundbedürfnisse
3 Grundbedürfnisse befriedigen
3.1 Grundbedürfnisse in verschiedenen Lebensbereichen
3.1.1 Familie
3.1.2 Berufsleben
3.1.3 Freizeit
3.2 Grundbedürfnisspezifische Konfliktfelder
3.2.1 Lustgewinn, Unlustvermeidung und Prokrastination
3.2.2 Bindung und Misstrauen
3.2.3 Autonomie, Freiheit und Handlungsspielraum
3.2.4 Kompetenz und Selbstwert
3.2.5 Identität, Selbstverwirklichung und Rollenkonflikte
4 Regulation von Emotionen und Stress
4.1 Funktionalität von Emotionen
4.2 Der Zeitpunkt der Regulation
4.3 Umgang mit dysfunktionalen Regulationsstrategien
4.3.1 Sorgenketten und Grübelschleifen
4.3.2 Vermeidungs- und Rückversicherungsverhalten
4.3.3 Selbstbestrafung
4.4 Funktionale Emotionsregulation
4.4.1 Neubewerten
4.4.2 Lösungsorientiertes Handeln
4.4.3 Akzeptieren
4.4.4 Körperliche Stressregulation
4.5 Flexibilität der Regulation
4.6 Emotionen vertiefen
5 Vulnerabilität reduzieren, Resilienz fördern
5.1 Dysfunktionale Glaubenssätze
5.2 Mentalisierungsfähigkeit
5.3 Sinn und Bedeutsamkeit
5.4 Internales Kontrollerleben
5.5 Soziale Unterstützung
6 Psychische Erkrankungen behandeln
6.1 Wann sind psychische Probleme behandlungsbedürftig?
6.2 Psychotherapie und Psychopharmakotherapie
6.3 Leitlinienempfehlungen
Literatur
Anhang
Hinweise zu den Onlinematerialien
Übersicht über die Onlinematerialien
|7|1 Was macht Gesundheit aus?
Beispiel
Meike leidet unter einer Zwangsstörung. Wenn sie ihr Zuhause, ihren Arbeitsplatz oder ihr geparktes Auto verlässt, muss sie wiederholt kontrollieren, ob alle Türen und Fenster korrekt geschlossen sind. Tut sie das nicht, gerät sie unter Anspannung und hat große Sorge, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Das Kontrollverhalten kostet viel Zeit und schränkt Meike in ihrem Alltag ein. Dennoch schafft sie es, ihren Haushalt zu managen, sich um ihre elfjährige Tochter zu kümmern und Freundschaften zu pflegen. Besonders wohl fühlt sie sich, wenn sie die Wochenenden gemeinsam mit ihrer Tochter, ihrer Schwester und ihren Eltern verbringt und sie gemeinsam einen Ausflug machen oder grillen. Im Berufsleben kann sie sich kompetent und erfolgreich fühlen, stört sich jedoch manchmal an der hohen Arbeitsbelastung und dem dominanten Auftreten ihrer Vorgesetzten. Körperlich fühlt sie sich meistens wohl. Sie hat keine körperlichen Erkrankungen, ist mit ihrem Gewicht recht zufrieden und kann regelmäßig Sport treiben. Nur ab und zu leidet sie unter Spannungskopfschmerzen.
Unter Gesundheit versteht man einen Zustand des psychischen, körperlichen und sozialen Wohlbefindens (WHO, 1948). Gesund zu sein, bedeutet daher mehr als nur nicht krank zu sein. Es bedeutet, an allen Facetten des Lebens teilhaben zu können – mit oder ohne Erkrankung (WHO, 2001). Vielen Menschen geht es wie Meike, sie sind weder vollständig gesund noch vollständig in ihrem Wohlbefinden eingeschränkt. Obwohl Meike unter einer psychischen Erkrankung leidet, die sich negativ auf ihr Wohlbefinden auswirkt, kann sie in vielen Lebensbereichen ihre Ressourcen gut nutzen, soziale Kontakte pflegen und ihre Ziele verfolgen. Wie bei allen Menschen wächst Meikes Wohlbefinden, wenn ihre Bedürfnisse befriedigt werden. Eine hohe Stressbelastung hingegen wirkt sich negativ auf ihr Wohlbefinden aus. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 1 illustriert.
|8|1.1 Grundbedürfnisse
Es gibt psychische und körperliche Bedürfnisse, die (fast) alle Menschen teilen. Diese Bedürfnisse nennt man Grundbedürfnisse. Grundbedürfnisse treiben menschliches Verhalten an. Sie motivieren uns, uns angenehmen Zielen anzunähern (z. B. Zeit mit Freunden zu verbringen) und unangenehme Erfahrungen zu vermeiden (z. B. berufliche Überforderung). Der nachfolgende Kasten gibt einen Überblick über psychische Grundbedürfnisse.
Abbildung 1: Während eine hohe Stressbelastung das Wohlbefinden und dadurch die Gesundheit senkt, wirkt sich Bedürfnisbefriedigung förderlich auf das Wohlbefinden aus.
Psychische Grundbedürfnisse
(Grawe, 2003; Ryan & Deci, 2017; Maslow, 1943)
Lustgewinn und Unlustvermeidung:
Menschen versuchen, unangenehme Erfahrungen zu vermeiden. Das sind zum Beispiel Schmerzen, Überanstrengung und Einsamkeit. Gleichzeitig streben sie nach angenehmen Erfahrungen, beispielsweise nach Anerkennung, Sex, Spiel und Vergnügen.
Bindung und Zugehörigkeit:
Die meisten Menschen organisieren sich in Familien, Freundeskreisen, Vereinen, Städten oder auch Staaten. Gründe hierfür sind das |9|Bedürfnis nach Zugehörigkeit und der Wunsch nach stabilen und unterstützenden Beziehungen.
Autonomie und Freiheit:
Auch wenn wir nach Zugehörigkeit streben, bleiben wir eigenständige Individuen mit eigenen Überzeugungen und Zielen. Daher wünschen sich Menschen neben Bindung und Zugehörigkeit auch Freiraum und Eigenständigkeit.
Wirksamkeit und Kompetenzerleben:
Ob am Arbeitsplatz, bei der Kindererziehung, Freizeitaktivitäten oder beim gemütlichen Zusammensein am Abend, (fast) jeder Mensch braucht das Gefühl, einen Einfluss auf seine Umgebung zu haben und auf diese zielgerichtet einwirken zu können.
Identität und Selbstverwirklichung:
Menschen streben danach, sich selbst zu entdecken und sich selbst zu verwirklichen. Es ist vielen Menschen ein großes Bedürfnis, sich authentisch zu fühlen und zu wissen, wer sie sind und wofür sie stehen. Dieses Wissen ist der Kompass für das Setzen langfristiger Lebensziele.
Teilweise stehen diese Bedürfnisse in einem Spannungsverhältnis zueinander. Manchmal – aber nicht immer – besteht beispielweise ein Konflikt zwischen der Befriedigung des Bedürfnisses nach Bindung und dem Bedürfnis nach Autonomie. Das heißt, um alle Bedürfnisse (langfristig) unter einen Hut bekommen zu können, muss man manchmal mit sich selbst (und anderen) Kompromisse schließen.
Beispiel
Miriam hat eine kleine Tochter, die sehr zur Befriedigung ihres Bindungsbedürfnisses beiträgt. Die beiden spielen miteinander, tauschen sich über ihren Tag aus, kuscheln und machen Späße. Gleichzeitig ist Miriam nicht mehr so autonom wie vor ihrer Mutterschaft. Sie kann ihre Tagesgestaltung nicht mehr unabhängig planen, fährt seltener in Urlaub, ist zuhause nur noch selten allein. Ihre Autonomie wurde durch ihre Rolle als Mutter etwas kleiner. Um ihrem Freiheitsbedürfnis dennoch gerecht zu werden, nimmt sie immer mal wieder die Unterstützung ihrer Schwester oder ihrer eigenen Mutter in Anspruch, die Miriams Tochter für einen Abend, einen Tag oder auch ein Wo|10|chenende zu sich nehmen. Diese Zeit nutzt Miriam für Freizeitaktivitäten, für die sie sonst keine Zeit hat, wie Klettern, Freund:innen treffen oder auch um einfach mal zuhause auszuspannen. Danach ist ihr „Autonomie-Akku“ wieder mehr aufgeladen und sie freut sich auf die Zeit mit ihrer Tochter.
Welche Bedürfnisse unsere Bedürfnishierarchie anführen und welche weniger Raum einnehmen, hängt stark von der Persönlichkeit (z. B. Offenheit für neue Erfahrungen), biographischen Entwicklungen (z. B. Rollenmodelle in der Pubertät) und dem sozialen Kontext ab (z. B. individualistische oder kollektivistische Gesellschaft). Von diesen Faktoren hängt auch ab, mit welchen Strategien wir im Alltag versuchen, unsere individuellen Bedürfnisse zu befriedigen. So können beispielsweise das Gründen einer Familie, die Vertiefung von Freundschaften, das Engagement in einem Traditionsverein oder ein Teamausflug mit Kolleg:innen dazu dienen, das Bindungsbedürfnis zu befriedigen. Je besser die Ressourcen und Eigenschaften, die eine Person mitbringt, zu ihrer Umwelt passen, desto leichter fällt es ihr, ihre Bedürfnisse zu befriedigen.
1.2 Stress
Unter Stress versteht man die psychische und körperliche Reaktion auf Bedrohungen (Lazarus & Folkman, 1984). Das Stresserleben in einer als bedrohlich bewerteten Situation ist umso höher, je geringer wir die Chancen einschätzen, die Bedrohung ausreichend gut bewältigen zu können (siehe Abb. 2). Was für uns bedrohlich ist, ist maßgeblich von unseren Vorerfahrungen mit ähnlichen Situationen und unseren Glaubenssätzen abhängig. Wie gut wir glauben, eine bedrohliche Situation bewältigen zu können, hängt maßgeblich von unseren (wahrgenommenen) Ressourcen ab.
Da das Stresserleben von der Bewertung der Situation (erste Bewertung) und den wahrgenommenen Ressourcen abhängig ist (zweite Bewertung), ist Stresserleben etwas sehr Subjektives. Das heißt, während Person A eine Situation als sehr stressig erlebt, löst die gleiche Situation bei Person B vielleicht nur geringen oder sogar überhaupt keinen Stress aus. Das bedeutet auch, dass Stress nicht nur durch handfeste Veränderungen im |11|Außen, sondern auch durch die Einnahme neuer Perspektiven und persönliche Entwicklungen reduziert werden kann.
Abbildung 2: Damit Stress auftritt, müssen zwei Dinge zusammenkommen. Erstens: Die Situation wird als bedrohlich empfunden. Zweitens: Man ist sich nicht sicher, ob die vorhandenen Ressourcen zur Bewältigung der Situation ausreichen werden (modifiziert nach Lazarus und Folkmann, 1984).
Beispiel
Als Jannis nach seinem Studium ins Arbeitsleben einstieg, war er sehr aufgeregt und nervös. Er fühlte sich subjektiv „von allem“ gestresst: den Besprechungen, den Berichten, den Gesprächen mit Vorgesetzten. Insbesondere die Probezeit empfand er als sehr bedrohlich. Als Jannis wiederholt positives Feedback bekam und die Erfahrung machte, „gut“ in seinem Beruf zu sein, fühlte er sich zunehmend kompetenter und wurde sich seiner Ressourcen bewusst. In der Folge nahm auch sein Stresserleben ab und vieles, was er zuvor als bedrohlich erlebt hatte, nahm er nun als Routine (d. h. neutral) oder als Chance (d. h. positiv) wahr.
|12|Stress führt zu körperlichen und psychischen Veränderungen, die uns dabei helfen sollen, Bedrohungen zu bewältigen (Selye, 1956). Auf körperlicher Ebene nimmt bei Stresserleben zum Beispiel die Muskelspannung zu, unser Herz schlägt schneller und die Bronchien weiten sich (d. h., der Körper bereitet sich auf einen höheren Aktivitätsbedarf vor). Psychisch kommt es zu emotionalen Veränderungen (z. B. Angsterleben), zu Veränderungen der Wahrnehmung (z. B. Tunnelblick), und es werden Verhaltensstrategien aktiviert, die uns helfen sollen, der Bedrohung zu begegnen (z. B. Kampf, Flucht oder Erstarren). Inwiefern diese Reaktionen hilfreich sind, hängt stark von der jeweiligen Situation, aber auch von der Intensität des Stresserlebens ab.
Beispiel für zu wenig Stresserleben
Muhammad war immer ein guter Schüler, der nicht viel lernen musste, um seine Ziele zu erreichen. Als er mit dem Studium begann, dachte er zunächst, das würde wahrscheinlich so weitergehen. Das führte dazu, dass er während des Semesters entspannt war und wenig Stress empfand, hatte jedoch auch den Nachteil, dass er sich nicht früh genug zur Vorbereitung auf die Prüfungen motivieren konnte (d. h., die Aktivierung von hilfreichen Verhaltensstrategien blieb aus) und oft nur gelangweilt vor seinem Skript saß (d. h., das körperliche Anspannungsniveau erlaubt keine ausreichende Fokussierung). Im ersten Semester schrieb er deshalb einige unbefriedigende Noten und fiel durch eine Klausur. Von da an blickte er deutlich angespannter auf zukünftige Prüfungsphasen und begann früher und engagierter mit der Prüfungsvorbereitung.
Beispiel für zu viel Stresserleben
Als Nadine ihr erstes Bewerbungsgespräch hatte, war sie sehr nervös. Sie redete schnell, schwitzte und rutschte auf ihrem Stuhl umher (Auswirkungen der körperlichen Stressreaktion). Gleichzeitig hatte Nadine das Gefühl, von ihren Gesprächspartner:innen abgelehnt zu werden und „unfaire“ Fragen gestellt zu bekommen (erhöhte Wahrnehmung von Gefahrenreizen). Obwohl die Rückmeldungen nach dem Bewerbungsgespräch in Ordnung waren, schämte sie sich im Anschluss. Aus heutiger Sicht glaubt sie, dass sie besser „performt“ hätte, wenn sie es geschafft hätte, Stresserleben und Aufregung etwas zu reduzieren.
|13|Ist Stress zu niedrig, fällt es uns schwer, uns zu größeren Verhaltensanstrengungen zu motivieren. Das körperliche und psychische Anspannungsniveau ist dann zu niedrig ausgeprägt, um „Gefahrenreizen“ (z. B. eine anstehende Klausur) schnell und wirkungsvoll zu begegnen (z. B. durch das Verfolgen eines Lernplans). Kommt es hingegen zu einer zu starken Stressreaktion, wird diese körperlich oft als unangenehm empfunden, und es fällt uns schwerer, klare Gedanken zu fassen (Stichwort: Blackout). Vor allem in anspruchsvollen Leistungssituationen ist ein mittleres Stressniveau häufig gut geeignet, um Herausforderungen effektiv zu begegnen (Diamond, Campbell, Park, Halonen & Zoladz, 2007). Der umgekehrt U-förmige Zusammenhang zwischen Leistungsfähigkeit und Stresserleben ist in Abbildung 3 dargestellt.
Abbildung 3: Zwischen Stresserleben und Leistungsfähigkeit besteht in Leistungssituationen mit hohen Anforderungen ein umgekehrt U-förmiger Zusammenhang (Diamond et al., 2007).
Die Stärke einer Stressreaktion lässt sich mit verschiedenen Strategien beeinflussen. Typische Regulationsstrategien sind die Umbewertung einer (bedrohlichen) Situation, das Entwickeln einer Lösungsstrategie oder das Akzeptieren eines (negativen) Umstands. Regulationsstrategien werden von früher Kindheit an gelernt und insbesondere in der Pubertät um weitere Strategien ergänzt. Dabei können sowohl hilfreiche (z. B. Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten) als auch hinderliche Strategien entstehen (z. B. Drogenkonsum).
|14|1.3 Eine Frage des Investments
Obwohl Stress unangenehm ist, kann man ihn nicht ganz vermeiden, sondern muss ihn manchmal für die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse in Kauf nehmen. In vielen Fällen wird Bedürfnisbefriedigung regelrecht durch Stress „erkauft“, z. B. wenn man Überstunden macht, um einer Beförderung näher zu kommen. Das Streben nach Bedürfnisbefriedigung und das Erleben von Stress sind oftmals untrennbar miteinander verbunden. Beide sind ein natürlicher und unvermeidbarer Bestandteil des Lebens. Das Wohlbefinden in einem Lebensbereich ist hoch, wenn Stresserleben und Bedürfnisbefriedigung in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Eine Reduktion des Wohlbefindens ist hingegen in folgenden Fällen wahrscheinlich:
Stress wird zu stark vermieden. Wenn wir „zu stark“ versuchen, Stress zu vermeiden, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir unsere Bedürfnisse befriedigen können. Das liegt daran, dass sich durch das Vermeidungsverhalten unser Handlungsspielraum einengt. Dadurch wird es schwieriger, Beziehungen aufzubauen, uns kompetent zu fühlen oder unseren Selbstwert zu stabilisieren, d. h., Bedürfnisse zu befriedigen.
Beispiel
Martin ist Single und wünscht sich eine Beziehung. Er will es jedoch „um jeden Preis“ vermeiden, einen Korb zu bekommen, weshalb er noch nie jemanden um ein Date gebeten hat. Dass er keinen Korb bekommen möchte, ist nachvollziehbar, denn das würde vermutlich mit Schamerleben einhergehen und ihn belasten. Wenn er das Risiko, einen Korb zu bekommen, jedoch auch zukünftig immer wieder scheut, sinkt umgekehrt die Wahrscheinlichkeit, dass er es nachhaltig schaffen wird, sein Bedürfnis nach einer romantischen Beziehung zu befriedigen.
Die Kosten der Bedürfnisbefriedigung sind zu hoch. Manchmal sind die Kosten für die Befriedigung eines Bedürfnisses „zu hoch“. Gemeint sind Fälle, in denen wir immer weiter in die Erreichung eines Zieles |15|investieren, ohne der Erfüllung des dahinterstehenden Bedürfnisses in relevantem Ausmaß näherzukommen. In solchen Fällen muss ein Ziel manchmal verworfen werden, ehe die Befriedigung eines Bedürfnisses auf anderem Wege möglich werden kann.
Beispiel
Linn ist Sängerin in einer Band, spielt Gitarre und schreibt Texte. Sie hat viel Zeit und Energie in ihre Lieder investiert. Ihre Band spielte als Vorband bei zwei mittelgroßen Acts und sie nahmen auf eigene Kosten drei Alben auf, die sie auf den üblichen Streaming-Plattformen zur Verfügung stellten. Für schwarze Zahlen, geschweige denn für einen Durchbruch hat es trotz aller Mühe jedoch nicht gereicht. Der Versuch, eine Musikkarriere aufzubauen, hat sie ihre Ausbildung, ihren heimatnahen Wohnort und vermutlich auch ihre letzte Beziehung gekostet. Sie würde gerne im gleichen Tempo und mit dem gleichen Einsatz weitermachen, merkt aber, dass das nicht mehr funktioniert. Wenn sie nicht die Freude an ihrer Musik verlieren und die mittlerweile vorhandenen Schulden zurückzahlen möchte, muss sie ihren Traumberuf vermutlich wieder zum Hobby machen und sich einen neuen Ausbildungsplatz suchen.
Ein Bedürfnis liegt brach. Manchmal wird weder Stress vermieden noch zu viel Stress erlebt und dennoch sinkt das Wohlbefinden. Ein möglicher Grund dafür ist, dass Betroffene zwar einige Bedürfnisse befriedigen, es aber eines oder mehrere Bedürfnisse gibt, die „brach liegen“. Das kann viele Gründe haben, z. B. kommt es vor, dass Menschen Bedürfnisse verdrängen, die sie für falsch oder nicht erfüllbar halten. In anderen Fällen fehlt den Betroffenen das notwendige Handwerkzeug, um an der Befriedigung eines Bedürfnisses zu arbeiten. In wieder anderen Fällen lassen die Lebensumstände die Befriedigung des Bedürfnisses (scheinbar) nicht zu.
Beispiel
Marlene studiert Physik, was zwar mit Stress einhergeht, ihr aber auch lange Zeit viel Freude bereitet hat, weil das Studium Teil ihrer Identität war und ihr Bedürfnis nach Kompetenzerleben befriedigte. Sie hat Freunde, Hobbys und kommt finanziell zurecht. Dennoch merkt sie |16|manchmal, dass etwas an ihr nagt. Nur hin und wieder kann sie sich eingestehen, dass in ihr ein unbefriedigtes Bedürfnis nach einer Familie ist. Einer „richtigen“ Familie anstelle des unsteten Miteinanders, das ihre Eltern früher „Familie“ genannt haben.
Um das eigene Wohlbefinden zu steigern oder aufrechtzuerhalten, ist es daher wichtig, Stress nicht (immer) zu vermeiden, nicht unverhältnismäßig viel in eine mögliche Bedürfnisbefriedigung zu investieren, seine Bedürfnisse gut zu kennen und ihnen offen zu begegnen. Darüber hinaus braucht man sowohl Ressourcen, die man zur Zielerreichung nutzen kann, als auch Regulationsstrategien, die den Umgang mit Stress erleichtern. Manchmal wird der Weg zum Wohlbefinden jedoch auch durch Hindernisse versperrt.
1.4 Vulnerabilität – Hindernisse auf dem Weg zum Wohlbefinden
Manchmal legt einem das Leben Steine in den Weg. In anderen Fällen hat man die Steine bereits als Gepäck dabei. Zum Beispiel in Form von genetischer Veranlagung oder weil man in der Kindheit über sie gestolpert ist und sie versehentlich eingepackt hat. In der Psychologie spricht man in solchen Fällen von Vulnerabilität, d. h. Verletzlichkeit (Wittchen & Hoyer, 2011). Vulnerabilitäten erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Stresserleben, erschweren die Stressregulation und machen es wahrscheinlicher, dass Bedürfnisse unbefriedigt bleiben. Je nach Kontext und Stressereignis können unterschiedliche Eigenschaften zu Vulnerabilitäten werden. Wichtige Vulnerabilitäten sind unter anderem die folgenden:
Emotionale Hyper- oder Hypo-Reaktivität. Emotionen sind etwas sehr Wichtiges. Sie sichern unser Überleben und bereichern unseren Alltag (Brandstätter, Schüler, Puca & Lozo, 2013). Sie motivieren uns, Bestleistungen zu erbringen (Stolz), Zeit in unsere Beziehungen zu investieren (Freude), Gefahren zu vermeiden (Angst) und zu vielem mehr. Schwierigkeiten können jedoch entstehen, wenn die Intensität unserer Emotionen nicht zur gegenwärtigen Situation passt. Das heißt, wenn wir auf eine Situation mit zu wenig oder zu viel Emotion reagieren (Förster, Kurtz, Konrad & Kanske, 2022).
|17|Zu viel: Wenn bereits kleine Missgeschicke tiefe Scham auslösen, alltägliche Konflikte zu rasender Wut führen oder wir bei kurzer Trennung von unseren Liebsten echte Verlustangst spüren.
Zu wenig: Wenn beruflicher Erfolg nicht zu Stolz führt, man bei einer neuen Partnerschaft keine Schmetterlinge im Bauch spürt und der Ausblick auf den Wochenendausflug keine Vorfreude weckt.
Während eine emotionale Hyper-Reaktivität (zu viel emotionale Reaktion) zur Entstehung von Stress beiträgt und häufig mit einer hohen Impulsivität einhergeht, dämpft eine emotionale Hypo-Reaktivität (zu wenig emotionale Reaktion) die angenehme Wirkung von Bedürfnisbefriedigung und kann zu Antriebslosigkeit beitragen.
Beispiel
Niko fühlt sich manchmal wie ein freiliegender Nerv. Als würde zwischen ihm und der Welt eine Schutzschicht fehlen, die Umgebungsreize abpuffert. Das kann auch großartig sein, denn er kann sich sehr intensiv verlieben und Freude sehr stark empfinden. Aber so hoch er oftmals fliegt, so tief fällt er auch. Manchmal würde er sich einfach mehr emotionale Stabilität wünschen. Oder zumindest einen Blitzableiter, der ihm einen Teil der Spannung nimmt.
Hinderliche Glaubenssätze. Wir nehmen die Welt nicht objektiv, sondern subjektiv wahr (Beck & Haigh, 2014). Wir sehen sie durch unsere eigene Brille. Diese Brille nennen Psycholog:innen Glaubenssätze. Glaubenssätze enthalten unsere grundsätzlichen Annahmen über die Welt, die anderen und uns selbst. Die Brille, durch die wir die Welt sehen, kann positiv getönt sein (d. h., wir sehen die Welt als einen schönen Ort, erwarten, von anderen gut behandelt zu werden, und finden uns selbst gut, wie wir sind), negativ getönt sein (d. h., wir sehen die Welt als furchtbaren Ort, erwarten, von anderen ausgenutzt zu werden, und können uns selbst nicht leiden) oder irgendetwas dazwischen. Glaubenssätze sind etwas Normales und oft nützlich, denn sie führen dazu, dass wir neuen Situationen nicht unvorbereitet gegenüberstehen. Wir nutzen sie als eine Art Faustregel, die uns eine erste Orientierung gibt, welche Reaktion in einer bestimmten Situation angemessen und hilfreich sein könnte. Glaubenssätze können jedoch auch zu Problemen führen. Zum Beispiel, wenn sie auf Situationen angewen|18|det werden, in denen sie unpassend sind (z. B. wenn man die gleichen Glaubenssätze auf das Berufs- und Familienleben anwendet) oder wenn sie zu extrem und/oder sehr allgemein sind (z. B. „Alle Menschen sind böse.“). Ist das der Fall, führen Grundannahmen zu einer verzerrten Informationsverarbeitung, die die Entstehung von Stress begünstigt und Bedürfnisbefriedigung unwahrscheinlicher werden lässt.
Beispiel
Lisas Eltern trennten sich, als sie 9 Jahre alt war. Zuvor hat sie das Auf und Ab ihrer Beziehung miterlebt und erfahren, dass ihr Vater ihre Mutter mehrmals betrogen hat. Vermutlich hat Lisa auch deshalb den Glaubenssatz entwickelt, dass Beziehungen „instabil und nicht verlässlich“ sind. In Beziehungen ist sie daher sehr misstrauisch und es fällt ihr sehr schwer, Nähe zuzulassen. Das führt immer wieder zu Missverständnissen, bei denen ihre Partner sie als distanziert und abweisend wahrnehmen. Obwohl es vor dem Hintergrund ihrer Biografie vollkommen nachvollziehbar ist, warum Lisas Glaubenssatz für sie stimmig ist, führt er in Lisas Erwachsenenleben zu erheblichen Problemen.
Schwierigkeiten zu mentalisieren. Im Verlauf ihres Lebens können Menschen die Fähigkeit entwickeln, sich in andere hineinzuversetzen und dadurch nachzuempfinden, was andere Menschen fühlen und denken (Taubner, Fonagy, & Bateman, 2019). Das ist eine sehr hilfreiche Eigenschaft, die es uns ermöglicht, Mitgefühl zu empfinden, die Motive anderer Menschen zu verstehen und eine emotionale Verbundenheit zu anderen aufzubauen. Zu Schwierigkeiten kommt es, wenn wir zwar davon überzeugt sind, zu wissen, was andere denken und fühlen, unsere Überzeugung jedoch nicht mit den Empfindungen der anderen Person übereinstimmt. In solchen Fällen steigt die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen, haltlosen Vorwürfen und einer Schieflage in der Kommunikation. Manchmal fällt es Personen nicht nur schwer, sich in andere hineinzuversetzen, sondern auch eigene Emotionen wahrzunehmen und eigene |19|Motive für Handlungen zu verstehen. Ist dies der Fall, besteht ein hohes Risiko, an den eigenen Bedürfnissen vorbei zu leben oder ein wechselhaftes und für andere nicht nachvollziehbares Verhalten zu zeigen.
Beispiel
Alexander eckt oft an. Das macht er nicht mit Absicht, aber es passiert. Er tritt häufig in Fettnäpfchen, provoziert ungewollt Kränkungen oder gerät aufgrund von Missverständnissen in Streitigkeiten. In Alexanders Herkunftsfamilie wurde selten über die Gefühle und Gedanken der Familienmitglieder gesprochen. Beinahe nie haben ihm seine Eltern erklärt, warum sie dieses oder jenes machen. Das hat dazu beigetragen, dass es Alexander schwerfällt, die Gefühlslage anderer Menschen richtig einzuschätzen, und dazu, dass er die Motive anderer Personen oftmals fehlinterpretiert. Da er das gerne ändern würde, hat er begonnen, andere aktiv nach ihren Gefühlen und Gedanken, d. h. ihrem inneren Erleben, zu fragen und auch vermehrt über sein eigenes Fühlen und Denken zu sprechen.
Diesen und vielen weiteren Vulnerabilitäten, die die Häufigkeit und Intensität von Stresserleben erhöhen, stehen Resilienzfaktoren (d. h. Schutzfaktoren) gegenüber, die die negativen Auswirkungen von Stress abpuffern.
1.5 Resilienzfaktoren
Unter Resilienzfaktoren versteht man Einstellungen, Eigenschaften und Fähigkeiten, die uns helfen, auch unter widrigen Umständen gesund zu bleiben oder schnell wieder gesund zu werden (Kalisch, Müller & Tüscher, 2015). Häufig entwickeln sich diese Resilienzfaktoren ganz nebenbei (z. B. indem man beobachtet, wie die eigenen Eltern mit Problemen umgehen). In anderen Fällen kann man aktiv an seinen Resilienzfaktoren arbei|20|ten (z. B. wenn man sich in Akzeptanz übt). Manchmal werden Resilienzfaktoren jedoch auch im Laufe des Lebens verschüttet und müssen erst wieder zu Tage gefördert werden (z. B. wenn Lebensveränderungen dazu geführt haben, dass der Kontakt mit einem eigentlich unterstützenden Umfeld abgebrochen wird). Die Zahl potenzieller Resilienzfaktoren ist groß. Hier drei Beispiele, die sich in der psychologischen Forschung als besonders wichtig herausgestellt haben: