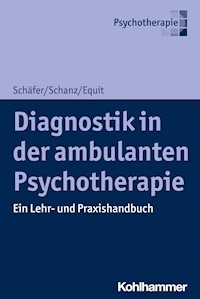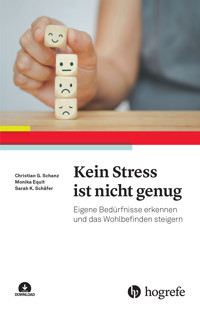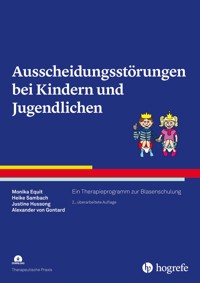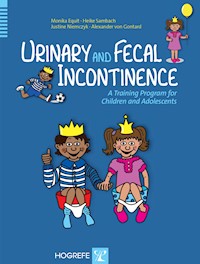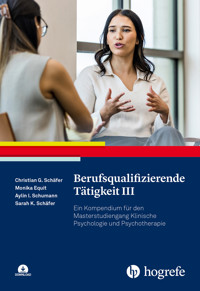
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die "Berufsqualifizierende Tätigkeit III (BQT-III)" ist ein Kernstück des neuen Masterstudiengangs Klinische Psychologie und Psychotherapie und ermöglicht Studierenden das Einüben psychotherapeutischer Methoden im direkten Kontakt mit Patient:innen. Das Kompendium liefert Leitfäden und Hintergrundinformationen zu allen von der Approbationsordnung vorgesehen psychotherapeutischen Methoden. Studierende werden so optimal auf die Aufgaben im Zuge der BQT-III vorbereitet. Der erste Teil des Buches konzentriert sich auf die Vermittlung der Grundlagen psychotherapeutischen Handelns, die den gesamten Therapieprozess begleiten und für alle Richtlinienverfahren von Bedeutung sind. Dabei werden sowohl das Erstellen von Fallkonzeptionen als auch die Grundlagen der psychotherapeutischen Beziehungsgestaltung und Gesprächsführung thematisiert. Darüber hinaus werden Anforderungen an die psychotherapeutische Dokumentation und die wichtigsten Aspekte der Berufsethik und des Berufsrechts beschrieben. Im zweiten Teil des Buches wird das gesamte für die BQT-III notwendige Methodenrepertoire anwendungsorientiert anhand zahlreicher Beispiele aufbereitet (z.B. psychodiagnostische Untersuchungen, Bezugspersonengespräche, Risiko- und Prognoseeinschätzungen). Die Buchinhalte können sowohl im Sinne eines Selbststudiums zur Vorbereitung auf die BQT-III als auch als Nachschlagewerk während der praktischen Umsetzung der Therapiemethoden im Zuge der BQT-III genutzt werden. Letzteres wird insbesondere durch ergänzende Online-Materialien erleichtert, die nach erfolgter Registrierung von der Hogrefe Website heruntergeladen werden können. Dozierende und Anleiter:innen können das Buch zudem als Basisliteratur für die Konzeption von Lehrveranstaltungen zur BQT-III nutzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Christian G. Schäfer
Monika Equit
Aylin I. Schumann
Sarah K. Schäfer
Berufsqualifizierende Tätigkeit III
Ein Kompendium für den Masterstudiengang Klinische Psychologie und Psychotherapie
Dr. Christian G. Schäfer (geb. Schanz), geb. 1990. Seit 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitseinheit Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität des Saarlandes und dort seit 2022 Lehrkoordinator für den Masterstudiengang Klinische Psychologie und Psychotherapie.
Prof. (apl.) Dr. Monika Equit, geb. 1978. Seit 2014 Leitung der Psychotherapeutischen Universitätsambulanz an der Universität des Saarlandes und seit 2015 Supervisorin und Co-Leitung des Weiterbildungsinstitutes für Psychotherapie Saarbrücken an der Universität des Saarlandes (WIPS GmbH).
M.Sc. Psych. Aylin I. Schumann, geb. 1992. Seit 2022 als Psychotherapeutin in eigener Praxis tätig. Seit 2023 geschäftsführende Leitung der psychotherapeutischen Hochschulambulanz (Kinder und Jugendliche) für Forschung und Lehre der Technischen Universität Braunschweig.
Jun.-Prof. Dr. Sarah K. Schäfer, geb. 1991. Seit 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) in Mainz. Seit 2023 Juniorprofessorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an der Technischen Universität Braunschweig.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock.com / SDI Productions
Satz: ARThür Grafik-Design & Kunst, Weimar
Format: EPUB
1. Auflage 2025
© 2025Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3299-1; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3299-2)
ISBN 978-3-8017-3299-8
https://doi.org/10.1026/03299-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Teil 1: Grundlagen therapeutischen Handelns
1 Grundlagen der Fallkonzeption
1.1 Der Therapieauftrag
1.2 Diagnose
1.3 Das individuelle Erklärungsmodell
1.4 Der Behandlungsplan
1.5 Fallkonzeption in der BQT-III
1.6 Zusammenfassung und Lernkontrollfragen
2 Grundlagen der Beziehungsgestaltung und Gesprächsführung
2.1 Basisvariablen der Beziehungsgestaltung
2.2 Grundlagen der Gesprächsführung
2.3 Beziehungsgestaltung und Gesprächsführung in den Richtlinienverfahren
2.4 Brüche in der Arbeitsbeziehung
2.5 Beziehungsgestaltung in der BQT-III
2.6 Zusammenfassung und Lernkontrollfragen
3 Grundlagen der Dokumentation
3.1 Form und Inhalt der Dokumentation
3.2 Einsichtsrecht
3.3 Dokumentation in der BQT-III
3.4 Zusammenfassung und Lernkontrollfragen
4 Grundlagen der Berufsethik und des Berufsrechts
4.1 Überblick über Gesetze, Ordnungen und Richtlinien
4.2 Wichtige berufsrechtliche Regelungen im Detail
4.3 Grundlagen der Berufsethik
4.4 Berufsrecht und Berufsethik in der BQT-III
4.5 Zusammenfassung und Lernkontrollfragen
Teil 2: Das Methodenrepertoire
5 Psychotherapeutisches Erstgespräch
5.1 Vorerfahrungen und Erwartungen von Patient:innen
5.2 Der Aufbau des Erstgesprächs
5.3 Besonderheiten des Erstgesprächs bei Kindern und Jugendlichen
5.4 Dokumentation des Erstgesprächs
5.5 Zusammenfassung und Lernkontrollfragen
6 Anamneseerhebung und -protokollierung
6.1 Anamneseprotokolle und die mündlich-praktische Fallprüfung
6.2 Durchführung und Protokollierung der Anamnesen
6.2.1 Orientierende Angaben
6.2.2 Soziale Anamnese
6.2.3 Biografische Anamnese
6.2.4 Familienanamnese
6.2.5 Krankheits- und Behandlungsanamnese
6.2.6 Suchtanamnese
6.3 Beispiel für ein Anamneseprotokoll bei Kindern
6.4 Zusammenfassung und Lernkontrollfragen
7 Psychodiagnostische Untersuchungen
7.1 Auswahl diagnostischer Verfahren
7.2 Störungsdiagnostik
7.2.1 Störungsdiagnostik nach ICD-10
7.2.2 Komorbiditäten
7.2.3 Störungsdiagnostik reliabel und valide gestalten
7.2.4 Differenzialdiagnostik
7.2.5 Spezifika der Störungsdiagnostik bei Kindern und Jugendlichen
7.3 Problemdiagnostik
7.3.1 SORKC-Analyse
7.3.2 ABC-Modell
7.3.3 Plananalyse
7.3.4 Beziehungsanalyse
7.4 Leistungsdiagnostik
7.4.1 Intelligenzdiagnostik
7.4.2 Aufmerksamkeitsdiagnostik
7.5 Neuropsychologische Diagnostik
7.6 Ressourcendiagnostik
7.7 Entwicklungsdiagnostik
7.8 Zusammenfassung und Lernkontrollfragen
8 Zwischen- und Abschlussevaluation
8.1 Evaluationsarten
8.2 Direkte und indirekte Veränderungsmessung
8.3 Klinisch bedeutsame Veränderungen
8.4 Zusammenfassung und Lernkontrollfragen
9 Abklärung der Indikationsstellung
9.1 Ist eine psychotherapeutische Behandlung indiziert?
9.2 Welches Psychotherapieverfahren ist indiziert?
9.3 Ist ein (teil-)stationäres oder ambulantes Behandlungssetting indiziert?
9.4 Ist eine Behandlung in einer Psychiatrie oder eine medizinische Rehabilitation indiziert?
9.5 Ist ein Aufenthalt auf einer offenen oder geschützten Station indiziert?
9.6 Ist eine Einzel- oder Gruppentherapie indiziert?
9.7 Zusammenfassung und Lernkontrollfragen
10 Risiko- und Prognoseeinschätzung
10.1 Prognose der zu erwartenden gesundheitlichen Entwicklung
10.2 Prognose des Risikos für Selbstgefährdung
10.3 Prognose des Risikos für Fremdgefährdung
10.4 Zusammenfassung und Lernkontrollfragen
11 Aufklärung von Patient:innen
11.1 Formalitäten der Aufklärung
11.2 Inhalt der Aufklärung
11.3 Zusammenfassung und Lernkontrollfragen
12 Psychotherapeutische Basismaßnahmen
12.1 Entspannungsverfahren
12.2 Psychoedukation
12.3 Zusammenfassung und Lernkontrollfragen
13 Gespräche mit Bezugspersonen
13.1 Gesprächsführung mit Bezugspersonen
13.2 Altersspezifische Aspekte von Gesprächen mit Bezugspersonen
13.3 Ziele und Funktionen des Einbezugs von Bezugspersonen
13.4 Dokumentation von Bezugspersonengesprächen
13.5 Zusammenfassung und Lernkontrollfragen
14 Therapieplanung
14.1 Evidenzbasierung der störungsspezifischen Behandlungsplanung
14.2 Detailplanung des störungsspezifischen Vorgehens
14.3 Individualisierung der Therapieplanung
14.4 Zusammenfassung und Lernkontrollfragen
15 Erstellung psychologischer Gutachten
15.1 Begutachtungsschritte
15.2 Erstattung des Gutachtens
15.3 Zusammenfassung und Lernkontrollfragen
16 Gruppenpsychotherapie
16.1 Arten von Therapiegruppen
16.2 Aufgaben von Gruppenleiter:innen
16.3 Zusammenfassung und Lernkontrollfragen
Literatur
Hinweise zu den Online-Materialien
|9|Vorwort
Die Berufsqualifizierende Tätigkeit III (BQT-III) ist eine tragende Säule der auf die Vermittlung von berufspraktischen Kompetenzen ausgerichteten klinischen bzw. psychotherapeutischen Masterstudiengänge. Das maßgebliche Ziel der BQT-III ist dabei die Vorbereitung auf den psychotherapeutischen Beruf sowie auf die postgraduale Weiterbildung zu einem:einer Fachpsychotherapeut:in. In diesem Buch haben wir Praxiswissen aufbereitet, das Studierende auf die Aufgaben und Anforderungen im Zuge der BQT-III optimal vorbereiten soll. Die Inhalte knüpfen dabei an den Wissensstand von Psychologie-Studierenden an und übersetzen die (theoretischen) Inhalte des Studiums in die psychotherapeutische Berufspraxis.
Der erste Teil des Buchs konzentriert sich auf die Vermittlung der Grundlagen psychotherapeutischen Handelns, die den gesamten Therapieprozess begleiten und für alle Richtlinienverfahren von Bedeutung sind. Dabei besprechen wir sowohl das Vorgehen bei der Erstellung einer Fallkonzeption als auch die Grundlagen der psychotherapeutischen Beziehungsgestaltung, Gesprächsführung und Dokumentation sowie die wichtigsten Aspekte der Berufsethik und des Berufsrechts. Im zweiten Teil des Buchs wird das gesamte für die BQT-III notwendige Methodenrepertoire anwendungsorientiert und anhand vieler Beispiele aufbereitet. Ergänzt werden die Buchinhalte durch Online-Materialien, die den Praxistransfer erleichtern und als Strukturierungs- sowie als Gedächtnisstütze dienen können.
Unser primäres Ziel beim Schreiben dieses Buches war es, Studierenden ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Hilfsmittel zum erfolgreichen Absolvieren der BQT-III und für den Einstieg in die Berufspraxis an die Hand zu geben. Darüber hinaus hoffen wir, Lehrpersonen mit diesem Buch eine gute Grundlage für die Durchführung von auf die BQT-III vorbereitenden Lehrveranstaltungen sowie für die Anleitung Studierender zur Verfügung zu stellen.
Wir wünschen allen Studierenden eine spannende und lehrreiche BQT-III, im Zuge derer sie die Freude am psychotherapeutischen Arbeiten entdecken können.
Braunschweig und Saarbrücken, Januar 2025
Christian G. Schanz,
Aylin I. Schumann,
Monika Equit
und Sarah K. Schäfer
|10|Einleitung
Der Gegenstand der Berufsqualifizierenden Tätigkeit III (BQT-III) – und damit auch die Inhalte dieses Buches – werden von der „Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten“ (PsychThApprO) vom 4. März 2020 vorgegeben. Die Approbationsordnung ist eine vom Bundesministerium für Gesundheit erarbeitete Rechtsverordnung, zu deren Aufgaben auch die Festlegung der Mindestanforderungen an die „Inhalte der hochschulischen Lehre sowie der berufspraktischen Einsätze“ (inkl. der BQT-III) zählen (§ 20 PsychThG). Daher möchten wir die Einleitung nutzen, um Ihnen einen Überblick zu geben, welche organisatorischen Rahmenbedingungen die Approbationsordnung für die BQT-III vorgibt und welche Leistungsanforderungen sie an Studierende stellt.
Organisatorische Rahmenbedingungen
Für die BQT-III ist ein Umfang von 20 ECTS-Punkten vorgesehen, was einem Arbeitsaufwand von 600 Zeitstunden entspricht. Davon müssen 450 Stunden in (teil)stationären und 150 Stunden in ambulanten Versorgungseinrichtungen erbracht werden. Darüber hinaus schreibt die Approbationsordnung vor, dass die stationären berufspraktischen Einsätze entweder en bloc oder in mindestens sechswöchigen Teilpraktika zu erbringen sind. Als zugelassene Versorgungseinrichtungen definiert die Approbationsordnung „Einrichtungen der psychotherapeutischen, psychiatrischen, psychosomatischen, neuropsychologischen Versorgung“ sowie „interdisziplinäre Behandlungszentren mit Psychotherapieschwerpunkt“ und Hochschulambulanzen (§ 18, Abs. 5 PsychThApprO). Vorgegeben ist, dass die praktische Anleitung in diesen Einrichtungen durch Psychologische Psychotherapeut:innen bzw. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen mit Fachkundenachweis erfolgen muss.
Hinweis
Die ambulante berufspraktische Tätigkeit wird an den meisten Standorten an den Hochschulambulanzen umgesetzt. Die meisten (teil-)stationären berufspraktischen Einsätze finden in psychiatrischen oder psychosomatischen Kliniken statt, mit denen die Universitäten Kooperationsverträge geschlossen haben.
|11|Leistungsanforderungen
Die Approbationsordnung definiert Einzelleistungen, die Studierende im Zuge Ihrer BQT-III erbringen müssen. Zu diesen Einzelleistungen gehört das Absolvieren folgender Aufgaben:
die Durchführung von vier Erstgesprächen,
die Erhebung von vier Anamnesen (inkl. Protokollierung),
die Durchführung von vier wissenschaftlichen psychodiagnostischen Untersuchungen,
die viermalige Abklärung von Indikationsstellungen oder alternativ die Durchführung von vier Risiko- und Prognoseeinschätzungen (inkl. Suizidabklärung),
die Durchführung von vier Aufklärungsgesprächen mit Patient:innen über diagnostische und klassifikatorische Befunde,
die Durchführung von drei psychotherapeutischen Basismaßnahmen (z. B. Entspannungsverfahren, Psychoedukation, Angehörigengespräche),
die Durchführung von Bezugspersonengesprächen in vier Behandlungsfällen (inkl. deren Dokumentation),
die Erstellung eines psychologisch-psychotherapeutischen Gutachtens.
Hinweis
Vorgeschrieben ist die Anwendung von Methoden aus „wissenschaftlich geprüften und anerkannten“ Psychotherapieverfahren. Für die Behandlung einer großen Anzahl von Störungsbildern sind dies die Kognitive Verhaltenstherapie, die Systemische Therapie sowie die Psychodynamische Psychotherapie (Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie, 2003, 2004, 2009). An den meisten Standorten werden in Lehrtherapien vor allem kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden genutzt, weshalb wir unsere Darstellung des Methodenrepertoires im zweiten Teil des Buches ebenfalls auf diesen Methodenschwerpunkt ausrichten.
Darüber hinaus macht die Approbationsordnung Vorgaben, in welchem Mindestumfang Studierende in die Behandlung von Patient:innen eingebunden werden müssen und welche Kriterien dabei zu berücksichtigen sind:
Insgesamt müssen Studierende die zuvor definierten Aufgaben (d. h. Erstgespräche, psychodiagnostische Untersuchungen usw.) im Zuge der Behandlung von mindestens zehn Patient:innen verschiedener Altersgruppen sowie mit Erkrankungen aus mindestens vier verschiedenen Störungsbereichen erbringen, wobei die Behandlungsfälle unterschiedliche Schwere- und Beeinträchtigungsgrade aufweisen müssen.
Sie müssen an mindestens zwölf aufeinanderfolgenden Sitzungen ambulanter Psychotherapie teilnehmen. Begleitend müssen diagnostische und therapeutische Handlungen eingeübt werden.
|12|Sie müssen darüber hinaus an mindestens zwei weiteren einzelpsychotherapeutischen Behandlungen mit einem Gesamtumfang von zwölf Sitzungen teilnehmen. Im Zuge derer müssen die Studierenden die Durchführung der Diagnostik und der Anamnese sowie die Therapieplanung und die Zwischen- und Abschlussevaluation übernehmen. Mindestens bei einem der Behandlungsfälle muss es sich um ein Kind oder einen Jugendlichen bzw. eine Jugendliche handeln.
Sie müssen mindestens zwölf Sitzungen Gruppenpsychotherapie begleiten.
Darüber hinaus legt die Approbationsordnung fest, dass die Studierenden an einrichtungsinternen Fortbildungen teilnehmen müssen.
Wichtig
An vielen Standorten wurden von Lehr- bzw. Studienkoordinator:innen und/oder Ambulanzleitungen Handreichungen erstellt, die Details der Umsetzung der BQT-III am jeweiligen Standort regeln. Um einen erfolgreichen und reibungslosen Ablauf der BQT-III zu ermöglichen, ist es sehr zu empfehlen, sich parallel zur Arbeit mit diesem Buch auch mit den standortspezifischen Vorgaben zur BQT-III auseinanderzusetzen.
|13|Teil 1: Grundlagen therapeutischen Handelns
|14|In diesem Teil des Buches besprechen wir wichtige Grundlagen therapeutischen Handelns, auf denen die Anwendung der diagnostischen und therapeutischen Techniken aufbaut, die im zweiten Teil des Buches beschrieben werden. Hierzu zählen Grundlagen
der Fallkonzeption,
der Beziehungsgestaltung und Gesprächsführung,
der Dokumentation sowie
der Berufsethik und des Berufsrechts.
Bei der nachfolgenden Darstellung der Grundlagen wird sowohl auf Besonderheiten aller Richtlinienverfahren als auch auf das Vorgehen in verschiedenen Altersgruppen eingegangen. Alle behandelten Grundlagen werden im Zuge der BQT-III implizit oder explizit zur Anwendung kommen.
|15|1 Grundlagen der Fallkonzeption
In der Fallkonzeption werden diagnostische Informationen gebündelt und in einen Sinnzusammenhang gebracht, der die Basis für die Durchführung von Behandlungsmaßnahmen bildet (Schanz, Equit & Schäfer, 2023). Zur Fallkonzeption gehören
der Therapieauftrag,
die (Verdachts-)Diagnose,
das individuelle Erklärungsmodell und
die Behandlungsplanung.
Die Fallkonzeption repräsentiert daher das (gegenwärtige) Fallverständnis der Therapeut:innen und markiert den Übergang von der Diagnostik zur Intervention (vgl. Abbildung 1).
Abbildung 1: Die Fallkonzeption als Schnittstelle zwischen Diagnostik und Intervention (modifiziert nach Schanz et al., 2023)
Dabei ist der Weg von der Diagnostik zur Fallkonzeption und von der Fallkonzeption zur Intervention keine Einbahnstraße. Denn auch wenn der diagnostische Prozess häufig mit einer standardisierten, für alle Patient:innen ähnlichen Diagnostik beginnt, wird er vor dem Hintergrund der Fallkonzeption immer wieder angepasst und individualisiert.
|16|Beispiel: Herr F.
Herr F. berichtet im Zuge des Erstgesprächs von Panikattacken und der Vermeidung von Menschenmengen, Fahrten auf Autobahnen und Brücken. Seine Therapeutin stellt daher die Verdachtsdiagnose einer Agoraphobie mit Panikstörung. Ausgehend von dieser Verdachtsdiagnose beschließt die Therapeutin den Einsatz des Fragebogens zu körperbezogenen Ängsten, Kognitionen und Vermeidung (AKV; Ehlers, Margraf & Chambless, 2001), d. h. einer Testsammlung, die dazu geeignet ist, den Schweregrad körperlicher, kognitiver und behavioraler Symptome einer Agoraphobie mit Panikstörung abzubilden. Im Zuge ihres sich entwickelnden Fallverständnisses hat die Therapeutin also den diagnostischen Prozess angepasst und die Standarddiagnostik um einen störungsspezifischen Fragebogen ergänzt.
Ebenso ist die Fallkonzeption mit dem Beginn konkreter Behandlungsmaßnahmen nicht abgeschlossen. Auch in der Interventionsphase werden immer wieder neue Informationen gewonnen und es werden (z. B. persönliche, kontextuelle, symptomatische) Entwicklungen eintreten, die das Fallverständnis verändern und daher zu einer fortlaufenden Anpassung der Fallkonzeption führen.
Beispiel: Herr F. (Forts.)
Nach der Diagnosesicherung und der Entwicklung eines individuellen Störungsmodells plant die Therapeutin mit Herrn F. die Durchführung einer expositionsbasierten Behandlung. Im Verlauf der Exposition in vivo stellt die Therapeutin fest, dass Herr F. in agoraphobischen Situationen immer wieder dissoziiert. Die Dissoziation senkt das Funktionsniveau von Herrn F. in den relevanten Situationen und reduziert so die Wirksamkeit der Expositionsbehandlung. Die Therapeutin exploriert mit Herrn F. die Ursprünge der dissoziativen Symptomatik und erweitert ihren Behandlungsplan um therapeutische Interventionen, die dazu dienen, die Dissoziation zu reduzieren (u. a. antidissoziative Skills). Die Therapeutin hat also infolge neu gewonnener Informationen im Interventionsprozess ihr Fallverständnis aktualisiert und davon ausgehend sowohl neue diagnostische Maßnahmen geplant als auch ihren Behandlungsplan angepasst.
1.1 Der Therapieauftrag
Psychotherapie ist eine Dienstleistung (höherer Art), bei der Therapeut:innen von Auftraggeber:innen zur Durchführung einer (Heil-)Behandlung beauftragt werden. Im Erwachsenen-Bereich kommt der Auftrag häufig von den Patient:innen selbst, bei Kindern und Jugendlichen hingegen häufig (auch) von Sorgeberechtig|17|ten. In seltenen Fällen kann der Auftrag auch von Dritten kommen (z. B. im Maßregelvollzug). Therapieaufträge setzen sich aus einem Veränderungsziel und einem vereinbarten Weg zur Zielerreichung zusammen. Häufige Veränderungsziele sind die Reduktion der Symptombelastung, die Steigerung des Funktionsniveaus, die Stärkung des Selbstbewusstseins oder auch das Lösen von beruflichen, partnerschaftlichen oder familiären Problemen und Konflikten (Faller, 2000; Ramnerö & Jansson, 2016).
Wichtig
Die Kosten für eine Psychotherapie werden nur dann von den (gesetzlichen) Krankenversicherungen übernommen, wenn eine psychische Erkrankung vorliegt, auf deren Behandlung die Psychotherapie ausgerichtet ist (Gemeinsamer Bundesausschuss, 2024). Das heißt, die Kosten werden nicht übernommen, wenn das (Haupt-)Ziel der Therapie beispielsweise in der Lösung partnerschaftlicher oder sozialer Probleme liegt. Auch in solchen Fällen kann eine Psychotherapie sinnvoll sein, allerdings müssen Patient:innen die Kosten einer Behandlung dann in der Regel selbst tragen (z. B. im Rahmen einer Paartherapie).
In manchen Fällen, bei denen zu Therapiebeginn keine (ausreichende) Veränderungsmotivation oder Störungseinsicht vorliegt, kann das erste Therapieziel auch darin bestehen, zunächst zu klären, ob eine Veränderung sinnvoll bzw. vorteilhaft sein könnte oder nicht. Das ist (im Erwachsenenalter) insbesondere beim Vorliegen von Abhängigkeitserkrankungen (Philips & Wennberg, 2014), Essstörungen (Carter & Kelly, 2015) und somatischen Belastungsstörungen (Mander et al., 2017) zu erwarten, bei denen der Impuls, eine Therapie zu beginnen, besonders häufig (auch) von Dritten und nicht von Patient:innen selbst kommt. Insbesondere – aber nicht ausschließlich – in solchen Fällen ist es wichtig, zwischen Therapie- und Veränderungsmotivation zu differenzieren. Eine ausreichend gute Therapieprognose setzt das Vorliegen von Therapie- und Veränderungsmotivation voraus (Krebs et al., 2019). Fehlt es zu Beginn der Therapie an Veränderungsmotivation, obwohl eine psychische Erkrankung vorliegt bzw. Leidensdruck und/oder Funktionseinschränkungen bestehen, sollten in der Regel Maßnahmen zur Förderung der Veränderungsmotivation durchgeführt werden (z. B. Pro-Kontra-Listen, motivierende Gesprächsführung, Stuhldialoge; Hötzel & Brachel, 2022). Werden die Versuche zur Förderung der Veränderungsmotivation abgelehnt oder bleiben sie ohne Erfolg, sollte die Therapie aufgrund einer zu schlechten Prognose beendet werden (Gemeinsamer Bundesausschuss, 2024). Sind die Versuche hingegen erfolgreich, kann im Anschluss gemeinsam ein neuer, auf Veränderungen ausgerichteter Auftrag formuliert werden.
Bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen ist dieses Thema sogar noch komplexer. Denn Therapie- und Veränderungsmotivation können bei verschiede|18|nen Systemmitgliedern vorhanden sein oder fehlen. Das Vorhandensein oder Fehlen von Therapie- und/oder Veränderungsmotivation sollte vor Beginn der Behandlung bei allen für den Prozess relevanten Personen geprüft werden (d. h. bei den Kindern und Jugendlichen, aber auch bei deren Sorgeberechtigten). Insbesondere bei externalisierenden Störungen (z. B. Störung des Sozialverhaltens) kommt es häufig vor, dass die Sorgeberechtigten die Inanspruchnahme eines Behandlungsangebots initiieren, die Kinder und Jugendlichen der Behandlung jedoch (mindestens) ambivalent gegenüberstehen. Dies zu erfassen, zu thematisieren und zum Gegenstand der Behandlung zu machen, ist ein wichtiger Teil vieler Therapien (Borg-Laufs, Gahleitner & Hungerige, 2018). Dabei ist es wichtig, die Gründe zu verstehen, die Therapie- und/oder Veränderungsmotivation erschweren. Bei Kindern und Jugendlichen können hierbei Ängste eine wichtige Rolle spielen (z. B. „Was kommt auf mich zu?“, „Kann ich der Person vertrauen?“, „Wird alles meinen Eltern erzählt?“). In anderen Fällen sind Kinder und Jugendliche sowie deren Sorgeberechtigte uneins über die Ziele einer Behandlung. Beispiele für wichtige Umstände, die die Therapie- und/oder Veränderungsmotivation auf Seiten der Sorgeberechtigten verringern können, sind (Borg-Laufs et al., 2018):
Das therapeutische Angebot wird auf Druck Dritter aufgesucht (z. B. Lehrer:innen).
Es bestehen keine klaren Zielvorstellungen.
Nach zahlreichen selbst initiierten Lösungsversuchen ist ein Gefühl von Resignation eingetreten.
Vorgeschlagene Veränderungen lösen Ängste und Schuldgefühle aus.
Eltern sind selbst zu stark belastet, um sich auf den Therapieprozess einlassen zu können.
Ist in den ersten Sitzungen verstanden worden, was Therapie- und/oder Veränderungsmotivation entgegensteht, geht es darum, gemeinsam an dieser zu arbeiten. Mittel hierzu können Strategien zum Aufbau intrinsischer Motivation sein (z. B. über realistisch mögliche positive Veränderungen informieren, Kontrolle der Patient:innen in den Sitzungen erhöhen), eine Klärung des Therapieauftrags und das Finden „kleinster gemeinsamer Ziele“ von Kindern, Jugendlichen und deren Sorgeberechtigten. Oftmals ist es so, dass Kinder und Jugendliche zunächst vor allem fremdmotiviert zur Behandlung kommen und sich im Laufe der ersten Sitzungen auf Basis eines tragfähigen therapeutischen Beziehungsangebots eine intrinsische Motivation zur Therapie und Veränderung entwickelt.
Wichtig
Nicht jeder Therapieauftrag kann bzw. sollte angenommen werden. Es sollten nur Therapieaufträge angenommen werden, zu deren Erfüllung Psychotherapie (wahrscheinlich) beitragen kann bzw. für deren Erfüllung Psychotherapie evidenzbasiert ist. Darüber hinaus sollten sich Aufträge auf für Patient:innen aus eigener Kraft |19|erreichbare Annäherungsziele beziehen, die mit den Werten und Lebenszielen der Patient:innen vereinbar sind (Michalak, Grosse Holtforth & Berking, 2007). Wenn Patient:innen Aufträge formulieren, auf die dies nicht zutrifft, sollte in der Regel zunächst versucht werden, gemeinsam einen geeigneten Auftrag zu entwickeln. Gelingt dies nicht, sollte eine Behandlung in der Regel abgelehnt werden.
Zum Festhalten bzw. Ausformulieren von Therapiezielen haben sich vor allem zwei Methoden in der Psychotherapie etabliert, die auch kombiniert werden können. Zum einen sollten Therapieziele „SMART“ formuliert werden (Drucker, 2008). Zum anderen empfiehlt sich die Nutzung einer „Zielerreichungsskalierung“ (Kiresuk & Sherman, 1968).
Ziele „SMART“ formulieren. Therapieziele sind „SMART“ formuliert, wenn sie spezifisch (S), messbar (M), attraktiv (A), realistisch (R) und terminierbar (T) sind. Die Anwendung dieser Kriterien führt in der Regel zu verhaltensnahen Annäherungszielen, die besonders gut geeignet sind, um in einer Verhaltenstherapie bearbeitet zu werden.
Beispiel: Herr F. (Forts.)
Herr F. möchte seine agoraphobische Symptomatik reduzieren. Gemeinsam mit seiner Therapeutin erarbeitet er ein „SMART“ formuliertes Ziel. Er möchte im Dezember (terminierbar) den Adventsmarkt seiner Heimatstadt gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn (spezifisch und attraktiv) ohne Sicherheitsverhalten und bei höchstens moderater Anspannung (messbar) besuchen können. Davon ausgehend, dass eine gut wirksame evidenzbasierte Behandlung für Agoraphobie mit Panikstörung vorliegt, die Behandlung im März begonnen wurde und Herr F. sowohl therapie- als auch veränderungsmotiviert ist, besteht eine gute Behandlungsprognose (realistisch).
Zielerreichungsskalierung. Bei der Zielerreichungsskalierung geht es darum, das Ausmaß der Zielerreichung auf einer (ordinalen) Skala abbildbar zu machen. Klassischerweise wird dafür eine bipolare Skala mit fünf Ausprägungen verwendet, die von „viel schlechter als erwartet“ bis „viel besser als erwartet“ reicht. Zu jedem Skalenpunkt werden zu Therapiebeginn zielspezifische Zustände definiert, die dem jeweiligen Skalenpunkt entsprechen. Im Therapieverlauf kann dann eingeschätzt werden, welchem Skalenpunkt der gegenwärtige Therapiefortschritt am ehesten entspricht. Ein Beispiel zeigt Abbildung 2.
Neben dem Festlegen von Therapiezielen gehört zur Auftragsklärung auch das Skizzieren des Wegs zur Zielerreichung. Dabei sollte Patient:innen eine Orientierung gegeben werden, was sie in der Therapie erwartet, wie lange die Therapie in etwa dauern wird und was sie selbst aber auch die Therapeut:innen zur Zielerreichung beitragen können bzw. müssen. Ausgehend davon können Patient:innen |20|eine informierte Entscheidung treffen, ob sie dem zustimmen und den Behandlungsauftrag erteilen möchten oder nicht. Gleichzeitig geht es dabei lediglich um eine grobe Skizze des Behandlungsplans. Eine Vertiefung von Details ist an dieser Stelle in der Regel noch nicht zielführend. Das liegt einerseits daran, dass den Therapeut:innen zum Zeitpunkt der Auftragsklärung (die i. d. R. in der Sprechstunde oder in der Probatorik stattfindet) relevante Informationen nur in Teilen vorliegen und viele Details daher noch gar nicht feststehen können. Andererseits zeigt die Erfahrung, dass einige Patient:innen auf ein Zuviel an Information eher verunsichert reagieren, da sie Überforderung und zu großen Veränderungsdruck befürchten. Dies ist jedoch an dieser Stelle im Therapieprozess eher kontraproduktiv, da Studien zeigen, dass insbesondere zu Behandlungsbeginn Hoffnung auf einen Behandlungserfolg ein guter Prädiktor für dessen späteres Eintreten ist (Constantino et al., 2018). Daher ist es wichtig, die geplante Behandlung für Patient:innen transparent zu skizzieren und dabei auch herausfordernde Elemente (z. B. eine geplante Expositionsbehandlung) nicht auszusparen, sich allerdings nicht in Details geplanter Maßnahmen zu verlieren (z. B. konkrete Stufen einer Expositionsbehandlung).
Abbildung 2: Auszug aus der Zielerreichungsskalierung von Herrn F.
Auch Kinder und Jugendliche müssen über die geplanten Behandlungsschritte informiert werden. Da Kinder und Jugendliche oft rechtlich nicht allein über Behandlungsschritte entscheiden können, ist die Aufklärung häufig komplexer und bezieht neben den Patient:innen auch deren Sorgeberechtigte ein. Dennoch ist es nicht zuletzt aus ethischen Gründen und für die Behandlungsmotivation wichtig, Kinder und Jugendliche in die Entscheidungsfindung über die Art und die Ziele der Behandlung einzubinden. Hierbei ist es essenziell, Informationen entwicklungsangemessen und dennoch transparent zu vermitteln. So sollte beispielsweise |21|eine entwicklungsangemessene Sprache gewählt und an die Erlebenswelt der jungen Patient:innen angeknüpft werden (z. B. als Vorbereitung einer expositionsbasierten Behandlung: „Vor den Sommerferien werden wir mit Übungen beginnen, bei denen du dich Situationen stellst, die dir aktuell Angst machen – zum Beispiel, mit dem Bus zur Schule zu fahren.“). Mit steigendem Alter (und fortschreitendem Entwicklungsstand) nähern sich Inhalte und Vorgehen bei der Information der Patient:innen stärker der Arbeit mit Erwachsenen an.
Beispiel: Herr F. (Forts.) – Besprechung des Wegs zur Zielerreichung bei bereits ausformulierten Zielen
Th.:Wenn Sie einverstanden sind, würde ich unsere Therapieziele noch einmal zusammenfassen. (Herr F. nickt.) Unser Fokus soll auf der Reduktion von Panikattacken und Vermeidungsverhalten liegen, sodass Sie sich wieder in der Lage fühlen, Ihren Alltag – sowohl beruflich als auch familiär – flexibel und ohne Sicherheitsverhalten zu bewältigen. Dabei sollen wir auch daran arbeiten, die Anspannung, die Sie häufig erleben, so weit zu reduzieren, dass Sie Aktivitäten wieder mehr genießen können. Habe ich das richtig verstanden? (Herr F. stimmt zu.) Bei der Erreichung dieser Ziele kann eine Psychotherapie Sie gut unterstützen. Es gibt eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Studien, die zeigen, dass verhaltenstherapeutische Maßnahmen zu einer starken Reduktion von Panikattacken, Anspannungszuständen und Sicherheitsverhalten beitragen können. Ist es in Ordnung, wenn ich Ihnen kurz skizziere, welches Vorgehen sich dabei bewährt hat? (Herr F. äußert sein Einverständnis.) Im Kern besteht das Problem bei einer Agoraphobie mit Panikstörung darin, dass man gelernt hat, dass von Situationen und Körperempfindungen, die per se normal und ungefährlich sind, vermeintlich eine Gefahr ausgeht, was zu Angsterleben führt. Bei Ihnen wäre eine solche Situation zum Beispiel der Besuch eines Adventsmarkts. In der Therapie werden wir daher Methoden anwenden, die Ihnen dabei helfen sollen, die ganz automatisch beim Besuch eines Adventsmarkts einsetzenden Befürchtungen und Angstreaktionen wieder zu verlernen. Klingt das für Sie nachvollziehbar oder haben Sie dazu Fragen? (Herr F. gibt an, dass das nachvollziehbar ist, und fragt, wie das zu schaffen ist.) Anfangen werden wir damit, dass wir uns anschauen, wie Ihre Angst entstanden ist und welche Befürchtungen Sie genau mit einem Adventsmarkt und verschiedenen Körperreaktionen verbinden. Dann werden wir gemeinsam einen Plan entwickeln, um zu testen, ob diese Befürchtungen begründet oder unbegründet sind. Dafür werden wir zum Beispiel bewusst gemeinsam Situationen aufsuchen, die objektiv ungefährlich, aber für Sie angstbesetzt sind. Das wird |22|Ihnen dabei helfen, Ihre Angst wieder zu verlernen. Typischerweise findet die Behandlung dabei wöchentlich statt und dauert zwischen sechs und neun Monaten. Haben Sie dazu Fragen, die wir gemeinsam besprechen sollen?
Manchmal ist es hilfreich, Therapieziele nach Priorität zu ordnen. Das ist vor allem der Fall, wenn viele Ziele angegeben werden und/oder das Erreichen der verschiedenen Ziele ganz unterschiedliche Methoden erfordert, sodass schrittweise vorgegangen werden sollte (z. B., wenn sowohl die Symptomreduktion bei einer Anorexia nervosa als auch bei einer komorbid vorliegenden posttraumatischen Belastungsstörung angestrebt wird). Das Bilden einer Hierarchie von Therapiezielen gelingt am besten, indem man die Ziele auf Karteikarten schreibt und diese an einem Whiteboard oder einem Flipchart auf den Achsen „Wichtigkeit“ und „Erreichbarkeit“ gemeinsam mit den Patient:innen ordnet (Schanz et al., 2023).
1.2 Diagnose
Diagnosen sind ein wichtiger Bestandteil der Fallkonzeption, insbesondere in verhaltenstherapeutischen Behandlungen und in psychiatrischen Settings. Bei der (deskriptiv-phänomenologischen) Diagnosestellung wird von den vorliegenden Symptomen auf das zugrunde liegende Syndrom geschlossen. Die Vergabe einer Diagnose geht mit Vorteilen, aber auch mit Nachteilen und Limitationen einher. Beginnen wollen wir mit der Betrachtung der Vorteile von (kategorialen) Diagnosen:
Evidenzbasierte Behandlung. Therapieleitlinien und Behandlungsmanuale sind häufig auf die Behandlung einer bestimmten Störung ausgerichtet. Eine valide Diagnosestellung vereinfacht daher die Identifikation von evidenzbasierten Behandlungsmöglichkeiten.
Anforderungen des Gesundheitssystems. Die Vergabe einer Diagnose ist eine zwingende Voraussetzung für die Kostenübernahme einer Therapie durch die (gesetzlichen) Krankenkassen (Gemeinsamer Bundesausschuss, 2024). Der Diagnosestellung kommt daher administrativ ein großer Wert zu (z. B. müssen [Verdachts-]Diagnosen an die Krankenversicherung übermittelt werden, damit Kosten übernommen werden können).
Kommunikation. Diagnosen werden in Deutschland auf Basis der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD; Weltgesundheitsorganisation [WHO], 1994, 2022) vergeben. Dieses Klassifikationssystem stellt ein international einheitliches Vokabular zur Benennung von Störungsbildern zur Verfügung. Überweist man beispielsweise Patient:innen mit der Diagnose „F33.2 Rezidivierende depressive Störung, mit |23|gegenwärtig schwerer Episode (G)“ in eine psychiatrische Klinik, haben die dortigen Kolleg:innen sehr schnell eine gute Vorstellung davon, welche diagnostischen und interventionellen Schritte vermutlich angezeigt sind.
Diesen Vorteilen einer Diagnosestellung stehen auch Nachteile gegenüber, die man bei der Diagnosestellung beachten sollte:
Defizitorientierung. In der ICD gibt es keine Diagnosen, bei denen Ressourcen oder Fertigkeiten gefordert oder benannt sind; stattdessen erfordert die Vergabe aller Diagnosen das Vorhandensein einer Reihe von Symptomen (WHO, 1994, 2022). Die Diagnose übermittelt daher ausschließlich „negative“ Informationen.
Stigmatisierung. Leidet eine Person unter einer psychischen Störung, weicht ihr Verhalten (per Definition) in bestimmtem Umfang von statistischen, sozialen und funktionalen Normen ab (Rief & Stenzel, 2012; Kring, Johnson & Hautzinger, 2019). Betroffene, Angehörige und Dritte können die Diagnosevergabe daher als eine Art Label (z. B. „gestört“) auffassen, wodurch Betroffenen Nachteile entstehen können. Beispielsweise kann es passieren, dass Patient:innen, bei denen eine hypochondrische Störung (F45.2) diagnostiziert wurde, bei der Äußerung von körperlichen Beschwerden von Behandler:innen und Angehörigen nicht mehr ernst genommen werden. Insbesondere aus systemischer Perspektive ist vor diesem Hintergrund auch relevant, dass Diagnosen Probleme sehr klar bei einzelnen Personen verorten, obwohl möglicherweise auch Systemvariablen (u. a. Wechselwirkungen in der Beziehungsgestaltung von Personen) an der Symptomentstehung und -aufrechterhaltung beteiligt sind (von Schlippe & Schweitzer, 2016).
Neben eindeutigen Vorteilen und Nachteilen geht die Diagnosestellung auch mit Limitationen einher, die zu Nachteilen werden können, wenn sie nicht angemessen berücksichtigt und mitgedacht werden:
Informationsgehalt. Eine Diagnose enthält nie alle Informationen, die für eine Behandlung relevant sind, kann aber dazu verleiten, das Fallverständnis auf die Diagnose zu beschränken (Negativbeispiel: „Die ‚Depressive‘ von Zimmer 6.“). Geschieht das, werden viele individuelle Fallcharakteristika übersehen, was eine erfolgreiche Behandlung weniger wahrscheinlich macht.
Künstliche Klassifikation. Psychische Diagnosen sind keine naturwissenschaftlichen Entitäten, sondern soziale Konstrukte, die einem gesellschaftlichen Wandel unterworfen sind. Entsprechend gibt es für keine psychische Störung (im engeren Sinne) einen objektiven Nachweis, wie dies etwa für einige somatische Erkrankungen der Fall ist (z. B. Nachweis eines bestimmten Erregers). Folglich geht eine Diagnosestellung immer mit einer (relevanten) Irrtumswahrscheinlichkeit einher.
Deskriptiv-phänomenologische Klassifikation. Die meisten Diagnosen und Störungskategorien in den gängigen Klassifikationssystemen sind deskriptiv-phänomenologisch. Das heißt, Diagnosen werden über eine Beschreibung (Deskription) |24|des Sichtbaren (Phänomen) definiert, also über ihre Symptome bzw. das gemeinsame Vorliegen verschiedener Symptome. Die Krankheitslehre (Nosologie), d. h., Annahmen über die hinter der Erkrankung stehenden pathologischen Mechanismen, findet jedoch – bis auf wenige Ausnahmen (z. B. posttraumatische Belastungsstörung) – kaum Beachtung bei der Klassifikation psychischer Erkrankungen. Während deskriptiv-phänomenologische Ansätze systematisch mit einer höheren Objektivität und Reliabilität der Diagnostik einhergehen als nosologische Ansätze, haben sie vergleichsweise weniger direkte Implikationen für die Behandlungsplanung (da sie z. B. keine Informationen enthalten, „warum“ jemand Panikattacken erlebt).
Damit die Diagnosestellung für die Fallkonzeption möglichst hilfreich ist, gilt es, ihre Vorteile zu nutzen und ihre Nachteile und Limitationen zu kompensieren. Dafür wird eine kategoriale Störungsdiagnostik u. a. durch dimensionale Ansätze sowie eine Problem- und Ressourcendiagnostik ergänzt. Das praktische Vorgehen bei der Diagnostik wird detailliert in Kapitel 7 beschrieben.
1.3 Das individuelle Erklärungsmodell
Das Erklärungsmodell beschreibt die individuellen prädisponierenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren, die zum Störungs- oder Problemgeschehen beitragen (Margraf & Lieb, 1995). Dadurch hat es direkte Implikationen dafür, welche Interventionen als zielführend erachtet werden, um die gegenwärtige Störung zu reduzieren, die zugrunde liegenden Probleme zu klären, gegenwärtige Herausforderungen zu bewältigen und zukünftigen Krisen vorzubeugen. Je nach Therapieschule werden dabei unterschiedliche Variablen besonders in den Fokus genommen. Die wichtigsten Annahmen zur Störungs- und Problementstehung in den Richtlinienverfahren werden nachfolgend (verkürzt) zusammengefasst. Ergänzend wird ein biomedizinisches Krankheitsverständnis besprochen, das psychopharmakologischen Behandlungen zugrunde liegt.
Kognitive Verhaltenstherapie. Die kognitive Verhaltenstherapie nimmt an, dass psychische Erkrankungen ebenso wie „gesundes“ Erleben und Verhalten als Resultat von Lernprozessen verstanden werden können (Beck & Haigh, 2014). Aus einer Vielzahl einzelner Lernerfahrungen formen sich bei jedem Menschen kognitive und affektive Schemata und Verhaltenspläne, deren Zusammenspiel helfen soll, Alltagssituationen zielführend zu bewältigen und nützlich auf diese zu reagieren. Insbesondere – aber nicht ausschließlich – infolge von schweren Belastungen (z. B. Vernachlässigung in der frühen Kindheit) kann es dazu kommen, dass Lernprozesse angestoßen werden, die bei den Betroffenen zu Schemata und Verhaltensplänen führen, die später zu Leiden und/oder Funktionseinschränkungen im Alltag beitragen (z. B. „Nicht mal meine Eltern konnten mich lieben“, „Ich bin wertlos“, |25|„Ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein“). Diese dysfunktionalen Schemata und Verhaltenspläne neigen dazu, sich selbst aufrechtzuerhalten und sogar weiter zu generalisieren, d. h., einen immer größeren Bereich des Lebens zu betreffen. Auf Ebene der Schemata liegt das u. a. daran, dass Menschen zu Assimilation anstelle von Akkommodation neigen, d. h., sie neigen dazu, ihre Interpretation neuer Informationen entsprechend ihrer zuvor bestehenden Schemata vorzunehmen, anstatt ihre Schemata an neue Informationen anzupassen. Dysfunktionale Verhaltenspläne wiederum resultieren häufig in kurzfristigen Vorteilen, die zur Aufrechterhaltung des Verhaltens beitragen, obwohl das Verhalten langfristig vor allem nachteilig ist (Caspar, 2018).
Beispiel
Eine Person wurde in ihrer Grundschulzeit gemobbt. Sie hat daraus gelernt, dass andere sie (vermeintlich) „immer negativ bewerten“ und dass eine negative Bewertung von anderen „schlimme Konsequenzen“ nach sich zieht. Interaktionen mit Gleichaltrigen sind für sie daher von Angst und Anspannung geprägt. In der Folge hat sie ihr Verhalten angepasst und den Kontakt mit Gleichaltrigen vermieden. Durch das Vermeiden der Interaktion mit Gleichaltrigen entgeht sie dem Angst- und Anspannungserleben sowie einer (vermeintlich) negativen Bewertung durch andere (kurzfristige Vorteile). Langfristig erschwert sie sich jedoch den Aufbau von sozialen Beziehungen und verzichtet auf die Chance positiver sozialer Interaktionen (langfristige Nachteile).
Durch die beschriebenen Mechanismen kommt es häufig zu einem selbstregulativen Prozess, der dysfunktionale Erlebens- und Verhaltenstendenzen immer weiter verfestigt, bis sie die Kriterien einer psychischen Störung erfüllen (z. B. die Kriterien einer sozialen Phobie; Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 2006). Im Behandlungsrational der kognitiven Verhaltenstherapie geht es daher darum, diese dysfunktionalen Schemata und Verhaltenspläne infrage zu stellen und neue funktionale Schemata und Verhaltenspläne aufzubauen. Hierzu versucht die kognitive Verhaltenstherapie korrigierende Erfahrungen herbeizuführen, die die selbstregulativen Prozesse der psychischen Störungen durchbrechen sollen. Dafür kann es wichtig sein, die ursprünglichen Entstehungsbedingungen zu kennen und zu klären. Als wichtiger wird jedoch das Verständnis der aktuellen (sich selbst aufrechterhaltenden) Störungsdynamik gesehen, da diese auch dann fortbestehen kann, wenn die auslösenden Bedingungen bzw. Probleme nicht mehr vorliegen. In diesem Sinne ist das Vorgehen der kognitiven Verhaltenstherapie am ehesten als gegenwarts- und störungsorientiert zu beschreiben. Das zeigt sich u. a. auch darin, dass die kognitive Verhaltenstherapie das Richtlinienverfahren mit den meisten störungsspezifischen Modellen und Behandlungsansätzen ist und Therapieerfolge (z. B. in Wirksamkeitsstudien) am ehesten – aber nicht ausschließlich – an der Symptomreduktion bemisst (Margraf & Schneider, 2018). Das heißt, |26|Behandlungen gelten dann als wirksam, wenn sie bestimmte Symptome in relevanter Weise verringern (z. B. Reduktion depressiver Symptome vom klinisch relevanten in den klinisch unauffälligen Bereich).
Merke
In kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlungen wird ein individuelles Störungsmodell erstellt, indem Schemata identifiziert und Verhaltenspläne abgeleitet werden, die das Verhalten situationsübergreifend beeinflussen (Makroanalyse; Schäfer, Schanz & Equit, 2022). Darüber hinaus werden die Dynamik des Störungsgeschehens sowie seine selbstregulativen Mechanismen auf Ebene einzelner Situationen betrachtet (Mikroanalyse).
Psychoanalytisch begründete Verfahren. Der Fokus psychoanalytisch begründeter Verfahren liegt nicht primär auf dem Verständnis und der Reduktion einer (deskriptiv-phänomenologisch klassifizierten) Erkrankung, sondern auf dem Verständnis und der Klärung der biografisch frühen (analytische Therapie) oder aktuellen ursächlichen Probleme (tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie), die der Erkrankung zugrunde liegen (Rudolf, 2014). Entsprechend sind psychoanalytisch begründete Verfahren problemorientiert und gruppieren psychische Störungen auf Basis der vermuteten Ursachen in strukturelle Störungen, konfliktbedingte Störungen sowie Traumafolgestörungen:
Strukturelle Störungen basieren auf einem Defizit an strukturellen Fähigkeiten. Strukturelle Fähigkeiten sind z. B. Selbstreflexion, Impulssteuerung, Empathie sowie Bindungsfähigkeit (Arbeitskreis OPD, 2023), und werden in den ersten Lebensmonaten und -jahren durch positive Beziehungserfahrungen mit den Bezugspersonen aufgebaut. Fehlt es an solchen Erfahrungen, versuchen die Betroffenen, die Strukturdefizite durch die Ausbildung von Bewältigungsstilen (d. h. narzisstisch, histrionisch, zwanghaft, schizoid) zu kompensieren. Reichen diese Bewältigungsstile nicht aus, um aktuelle Herausforderungen zu meistern, kommt es zur Symptombildung. Dabei ist relevant, dass Bewältigungsstile zwar das Ich vorübergehend stabilisieren, jedoch auch die Wahrscheinlichkeit von repetitiven (Beziehungs-)Herausforderungen deutlich steigern und die Wahrscheinlichkeit senken, diese erfolgreich zu bewältigen.
Konfliktbedingte Störungen resultieren aus einer unzureichenden Bewältigung (früh)kindlicher Entwicklungsaufgaben, die in Grundkonflikten Ausdruck findet (z. B. in Bezug auf Nähe, Bindung, Autonomie, Identität; Rudolf, 2014). Die Wahrscheinlichkeit einer unzureichenden Bewältigung der assoziierten Entwicklungsaufgaben ist vor allem bei negativen Beziehungserfahrungen in den ersten Lebensjahren erhöht. Die Grundkonflikte werden von den Betroffenen abgewehrt und in das Unbewusste verdrängt. Versagt die Abwehr später an aktuellen Herausforderungen, kommt es zu einer Aktualisierung des Grundkonflikts in Form eines Aktualkonflikts sowie zur Symptombildung. Relevant ist |27|dabei das Konzept der repetitiven Konfliktmuster. Dieses impliziert beispielsweise, dass eine Person mit einem stark ausgeprägten Grundkonflikt der Bindung auch im Erwachsenenalter wahrscheinlicher Bindungskonflikte erlebt und größere Schwierigkeiten damit hat, diese zu bewältigen.
Traumafolgestörungen haben im Gegensatz zu strukturellen und konfliktbedingten Störungen keinen direkten Entwicklungsbezug, sondern resultieren aus dem Erleben traumatischer Erfahrungen in der späten Kindheit, in der Jugend oder im Erwachsenenalter. Auch wenn bei ausreichend schwerer Traumatisierung jeder Mensch eine Traumafolgestörung entwickeln kann, wird angenommen, dass strukturelle Defizite und verdrängte Grundkonflikte das Risiko einer Symptombildung beeinflussen (Rudolf, 2014). Je ausgeprägter strukturelle Defizite sind und je stärker die Ausprägung der Grundkonflikte, desto wahrscheinlicher resultieren Traumatisierungen in einer Symptombildung.
Bei strukturellen Störungen besteht das Behandlungsrational im Kern in der Förderung struktureller Fähigkeiten (Rudolf, 2014). Bei konfliktbedingten Störungen geht es um die Klärung des Grundkonflikts (analytische Psychotherapie) oder des aktualisierten Konflikts (tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie). Bei Traumafolgestörungen ist keine psychoanalytisch fundierte Psychotherapie im engeren Sinne indiziert (d. h. Arbeit an Konflikten und/oder Förderung des Strukturniveaus), sondern eine traumafokussierte Therapie (Schäfer et al., 2019).
Merke
In psychoanalytisch begründeten Verfahren wird ein Erklärungsmodell der zugrunde liegenden Problematik unter besonderer Berücksichtigung des Strukturniveaus und der (Grund)Konflikte erstellt (Rudolf, 2014). Dazu wird vor allem eine detaillierte Beziehungsdiagnostik (inkl. der Analyse des Übertragungsgeschehens) genutzt (Arbeitskreis OPD, 2023; Wöller & Kruse, 2018).
Systemische Therapie. Die systemische Therapie ist lösungsorientiert ausgerichtet. Das heißt, ihr primäres Ziel besteht darin, Patient:innen zu unterstützen, einen als problematisch erlebten Zustand zu bewältigen (von Schlippe & Schweitzer, 2016). Um dieses Ziel zu erreichen, kann die Vergabe einer Diagnose nützlich sein – muss sie aber nicht.
Vor- und Nachteile der Diagnosevergabe – Beispiel: ADHS
Die Vergabe der Diagnose einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) hat Vor- und Nachteile. Die Diagnose kann Betroffenen z. B. helfen, ein Unterstützungssystem zu aktivieren (z. B. Nachteilsausgleich, Schulassistenz), und/oder ihnen eine hilfreiche (neurobiologische) Erklärung für ihre Problematik liefern. Sie kann aber auch zu Ausgrenzung führen und den |28|Betroffenen das Gefühl vermitteln, dass sie „das Problem“ sind, „nie richtig“ funktionieren werden und „eh nichts daran ändern können“. Das heißt, die Vergabe der Diagnose kann (u. a. abhängig davon, wie sie kommuniziert und wie sie verarbeitet wird), bei der Lösung von Problemen unterstützen, das Problem verfestigen oder die Entstehung neuer Probleme wahrscheinlicher machen.
Ebenso kann es – muss es aber nicht – für eine Lösungsfindung hilfreich sein, eine mutmaßliche (!) Ursache für den als problematisch erlebten Zustand zu identifizieren. Denn alle in Psychotherapien relevanten Probleme haben multiple und miteinander interagierende Ursachen, weshalb alle postulierten Erklärungsmodelle unterkomplex sind und immer alternative Modelle (mit gleichem oder höherem Erklärungswert) identifizierbar wären. Der Wert eines Erklärungsmodells resultiert daher aus seiner Nützlichkeit, nicht aus seinem (mutmaßlichen) Wahrheitsgehalt.
Beispiel: Frau P.
Im Jugendalter hatte sich das Essverhalten von Frau P. sukzessive verändert. Sie aß immer weniger, übergab sich nach dem Essen, trieb viel Sport. Ihr Umfeld betrachtete diese Entwicklung mit viel Sorge. Zu dieser Zeit gab es viel Streit zwischen Frau P. und ihren Eltern, und die Beziehung ihrer Eltern wurde konfliktreicher. Ihre Eltern wurden zunehmend „streng“ und Frau P. wurde zunehmend „widerspenstig“. Frau P. wurde damals in der Schule gemobbt, hatte wenige Freund:innen und keine Hobbys mehr. Sie hatte das Gefühl, gar nicht so genau zu wissen, wer sie eigentlich war.
Potenzielle Zusammenhänge: Wie wirkten diese Faktoren nun zusammen? Waren die familiären Streitigkeiten Folge oder Ursache des „besorgniserregenden“ Ernährungsverhaltens von Frau P.? Oder beeinflussten sich diese Faktoren gegenseitig? Oder hatten diese Faktoren gar nichts miteinander zu tun? War das fehlende Identitätsgefühl von Frau P. Folge oder Ursache der interaktionellen Probleme in der Schule, der wenigen Sozialkontakte und fehlenden Hobbys? Oder beeinflussten sich diese Faktoren gegenseitig? Oder hatten sie gar nichts miteinander zu tun? Bestand ein (uni-, bi- oder multidirektionaler) Zusammenhang zwischen der familiären, der schulischen und der Ernährungssituation? Oder handelte es sich um weitestgehend unabhängige Entwicklungen? Gab es vielleicht noch weitere Einflussfaktoren, die noch gar nicht beschrieben wurden? Zum Beispiel Probleme am Arbeitsplatz des Vaters? Die kurzzeitige Trennung der Eltern in der Kindheit von Frau P.? Kam Frau P. mit einem „problematischen“ Temperament zur Welt?
Implikationen: Die Patientin und ihre Psychotherapeutin werden sicher mutmaßliche Ursachen für die Anorexia nervosa finden und ein in sich kohärentes Erklärungsmodell entwickeln. Wichtig ist jedoch, sich klarzumachen, dass sie genauso gut ein (ganz anderes) Erklärungsmodell entwickeln könnten, |29|das genauso (nicht) zutreffend wäre. Die wichtigere (und zugleich schwerer zu beantwortende) Frage ist daher: Welche Erklärung wäre für Frau P. möglichst hilfreich?
Entsteht ein Problem, liegt es in der Natur des Menschen, (mutmaßliche) Erklärungen für dieses Problem zu entwickeln. Wenn diese Erklärungen hilfreich sind, unterstützen sie die Betroffenen entweder, (gut) mit dem Problem zu leben oder es zu lösen. In Therapien sehen wir jedoch in der Regel Personen, deren bisherige Erklärungsmodelle für ein Problem nicht zu einer befriedigenden Lösung geführt haben (z. B. „Ich fühle mich nicht wertvoll. Das liegt daran, dass ich zu dick bin. Ich muss weiter abnehmen“). Aufgabe systemischer Therapeut:innen ist es daher, gemeinsam mit den Patient:innen neue Perspektiven auf ihr Problem und dessen Ursachen sowie seine Erklärung zu entwickeln, die neue potenzielle Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. In dieser Auflösung der Problemtrance (d. h. der Auflösung der Annahme, dass die „wahre“ Erklärung für ein Problem gefunden wurde und diese leider nur eine sehr begrenzte Anzahl an Lösungen zulässt) und der Vergrößerung des Möglichkeitsraums (d. h. das Erwägen alternativer Erklärungsmodelle, aus denen sich neue potenzielle Lösungen ableiten lassen) besteht das (Haupt-)Rational einer systemischen Therapie.
Merke
In der systemischen Therapie wird versucht, ein Erklärungsmodell zu entwickeln, das möglichst viele neue Lösungsmöglichkeiten eröffnet. Dazu werden die (häufig) von einfachen Kausalitäten und Linearität geprägten Erklärungsansätze der Systemmitglieder um zirkuläre Wechselwirkungen und neue Perspektiven ergänzt. Hierzu nutzt die systemische Therapie u. a. zirkuläres Fragen, Mehrpersonensettings und Aufstellungen (Wagner, 2018).
Biomedizinisches Krankheitsmodell. Ergänzend zum Krankheitsverständnis der psychotherapeutischen Richtlinienverfahren ist für die klinische Praxis (im Zuge der BQT-III) vor allem das biomedizinische Krankheitsverständnis und das sich aus ihm ergebende psychopharmakologische Behandlungsrational relevant (Müller & Eckert, 2016). Im biomedizinischen Krankheitsverständnis sind psychische Erkrankungen vor allem durch (neuro)biologische Dysfunktionen mitbestimmt. Diese Dysfunktionen betreffen vor allem den Neurotransmitterhaushalt. Psychopharmakotherapie zielt darauf ab, diese Dysfunktionen zu korrigieren und so psychopathologische Symptome zu reduzieren. Psychopharmaka wirken dabei auf folgenden Wegen:
Die Synthese von Neurotransmittern wird beeinflusst.
Die Ausschüttung von Neurotransmittern wird beeinflusst.
Die Deaktivierung von Neurotransmittern wird beeinflusst.
Postsynaptische Rezeptoren werden beeinflusst.
|30|Merke
Das individuelle Erklärungsmodell im biomedizinischen Verständnis speist sich maßgeblich durch die Beschreibung von psychopathologischen Symptomen und deren Zusammenhänge mit Dysfunktionen im Neurotransmittersystem. Ein wichtiges Instrument der Diagnostik ist dabei die Erhebung des psychischen bzw. psychopathologischen Befunds (Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie, 2022).
1.4 Der Behandlungsplan
Der Behandlungsplan skizziert das geplante Vorgehen zur Erreichung der Therapieziele unter Berücksichtigung der Diagnose und des individuellen Erklärungsmodells. Wie in Kapitel 1.1 erläutert, müssen Psychotherapien, deren Kosten von den (gesetzlichen) Krankenversicherungen übernommen werden sollen, im Kern auf die Behandlung einer psychischen Störung ausgerichtet sein (Gemeinsamer Bundesausschuss, 2024). Eine dementsprechend störungsorientierte Behandlungsplanung kann in drei Schritten vorgenommen werden (vgl. Tabelle 1).
Tabelle 1: Vorgehen bei der störungsorientierten Behandlungsplanung
Schritt
Ziel
Informationsquelle
1
Evidenzbasierung der störungsspezifischen Behandlungsplanung
Behandlungsleitlinien und Überblicksarbeiten
2
Detailplanung des störungsspezifischen Vorgehens
Therapiemanuale und Praxishandbücher
3
Individualisierung und (ziel- sowie problemspezifische) Erweiterung des Vorgehens
Individuelle Fallcharakteristika
Evidenzbasierung der störungsspezifischen Behandlungsplanung. Psychotherapeut:innen sind einem evidenzbasierten Vorgehen verpflichtet. Evidenzbasierung heißt, die Durchführung der Behandlung erfolgt
entsprechend dem aktuellen Stand der Forschung,
auf Basis der praktischen Erfahrung von Expert:innen (inkl. den Behandler:innen selbst) sowie
in Einklang mit den Wünschen der Patient:innen (Cochrane, 2024).
Zur Gewährleistung eines evidenzbasierten Vorgehens sollte die störungsspezifische Behandlungsplanung damit beginnen, dass man sich mit den Behandlungsleitlinien auseinandersetzt. Behandlungsleitlinien haben folgende Aufgaben und Ziele (BÄK, KBV & AWMF, 2022):
|31|wissenschaftliche Evidenz und Praxiserfahrung systematisch zusammenfassen,
Evidenz vor dem Hintergrund methodischer und klinischer Aspekte bewerten und
das Vorgehen der (ersten) Wahl unter Berücksichtigung von Nutzen und Risiken definieren.
Das heißt, in Behandlungsleitlinien erfahren Behandler:innen, welches Vorgehen auf Basis wissenschaftlicher Studien und vor dem Hintergrund der praktischen Erfahrungen eines Expert:innen-Gremiums (z. B. erfahrener Kliniker:innen in diesem Bereich) empfohlen wird. In Deutschland koordiniert die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF) die Leitlinienerstellung durch wissenschaftliche medizinische Fachgesellschaften (AWMF, 2025). AWMF-Leitlinien haben eine Gültigkeit von jeweils fünf Jahren, ehe eine aktualisierte Version vorgelegt werden sollte. Da das Wissen, das den Behandlungsleitlinien zugrunde liegt, daher zwangsläufig nicht immer dem neuesten Erkenntnisstand entspricht, sondern mehrere Jahre alt sein kann, empfiehlt es sich, die Auseinandersetzung mit den Leitlinien um eine Auseinandersetzung mit aktuellen systematischen Übersichtsarbeiten zu ergänzen. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Leitlinien nicht innerhalb der Fünf-Jahres-Frist aktualisiert werden, was häufig aufgrund des ressourcenintensiven Prozesses der Leitlinienerstellung der Fall ist. Methodisch hochwertige Überblicksarbeiten zu Wirksamkeitsstudien können z. B. über die Cochrane Library identifiziert werden (https://www.cochranelibrary.com; Cochrane Deutschland, 2024).
Detailplanung des störungsspezifischen Vorgehens. Die in Behandlungsleitlinien und qualitativ hochwertigen Übersichtsarbeiten ausgesprochenen Empfehlungen sind naturgemäß eher „grob aufgelöst“ (z. B. Welcher Empfehlungsgrad besteht für welche Art von Psychotherapie?) und enthalten wenig Details zur praktischen Umsetzung konkreter Behandlungsmaßnahmen. Daher sollten für die Detailplanung der Behandlung Therapiemanuale und/oder Praxishandbücher genutzt werden. Empfiehlt eine Behandlungsleitlinie beispielsweise die Nutzung einer traumafokussierten Psychotherapie bei Vorliegen einer posttraumatischen Belastungsstörung (Schäfer et al., 2019), können Therapiemanuale und/oder Praxishandbücher genutzt werden, um nachzulesen, wie eine traumafokussierte Psychotherapie praktisch umgesetzt wird (z. B. Lühr, Zens & Müller-Engelmann, 2021).
Individualisierung und (ziel- sowie problemspezifische) Erweiterung des Vorgehens. Behandlungsleitlinien, Übersichtsarbeiten, Therapiemanuale und Praxishandbücher beschreiben ein Standardvorgehen, an dem die Therapie (in der Regel) orientiert werden sollte, das jedoch häufig nicht eins zu eins auf den jeweiligen Behandlungsfall anwendbar ist (Schanz et al., 2023). Stattdessen sollte das Standardvorgehen vor dem Hintergrund individueller Charakteristika des Behandlungsfalls adaptiert werden. Eine Individualisierung ist aus mehreren Gründen häufig zielführend:
|32|Behandlungsleitlinien und Übersichtsarbeiten basieren auf (randomisiert-kontrollierten) Studien, die häufig strenge Ein- und Ausschlusskriterien haben. Dadurch können sich Studienteilnehmer:innen in relevanten Aspekten von Patient:innen in der klinischen Praxis unterscheiden. Oft werden z. B. Personen mit komorbiden Erkrankungen oder akuter Selbst- und Fremdgefährdung aus Studien ausgeschlossen.
Außerdem können weder Behandlungsleitlinien und Übersichtsarbeiten noch Therapiemanuale und Praxishandbücher auf alle Eventualitäten in der Entstehungsgeschichte einer psychischen Erkrankung eingehen. Auch sind individuelle Lebensumstände und Persönlichkeitseigenschaften von Patient:innen sowie Erfahrungen und Fähigkeiten von Therapeut:innen in der Regel nicht im Fokus von Leitlinien oder Manualen. Daher wird das Standardvorgehen (fast) immer Aspekte enthalten, die im individuellen Fall nicht hilfreich sind und angepasst werden sollten.
In den meisten Fällen gibt es auch Therapieziele, die nicht störungsspezifisch sind und sich daher auf Bereiche beziehen, die in (störungsspezifischen) Behandlungsleitlinien, Übersichtsarbeiten, Therapiemanualen und Praxishandbüchern in der Regel nicht thematisiert werden (z. B. einen Sinn im eigenen Leben finden; klären, wie es beruflich weitergehen soll; oder bei Kindern und Jugendlichen: Freunde am neuen Wohnort finden; eine Perspektive nach der Schule entwickeln). Aus dem Fehlen von Hinweisen zur Bearbeitung solcher Themen in der einschlägigen Literatur sollte jedoch nicht geschlossen werden, dass diese nicht wichtig wären.
Insbesondere bei der Individualisierung des Vorgehens kann die Behandlungsplanung und Qualitätssicherung von einem Erfahrungsaustausch in Supervision und/oder Intervision profitieren. Die praktische Ausgestaltung der Therapieplanung wird detailliert in Kapitel 14 beschrieben.
1.5 Fallkonzeption in der BQT-III
Im Zuge der BQT-III werden Sie aktiv in den Diagnostikprozess mit Patient:innen einbezogen (z. B. im Zuge von Erstgesprächen, psychodiagnostischen Untersuchungen und der Risiko- und Prognoseeinschätzung) und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Fallkonzeption. Darüber hinaus fordert die Approbationsordnung ausdrücklich Ihre Beteiligung an der Therapieplanung in mindestens einem Behandlungsfall (§ 18 Abs. 2 Satz 3 PsychThApprO). Das heißt, hier wird es Ihre Aufgabe sein, ausgehend vom Therapieauftrag, der Diagnose und dem individuellen Erklärungsmodell unter Nutzung von Leitlinien, Übersichtsarbeiten, Therapiemanualen und Praxishandbüchern – begleitet und unterstützt durch Ihre Anleiter:innen – Interventionen zu planen, die Patient:innen helfen sollen, ihre Therapieziele zu erreichen. Im Zuge Ihrer Teilnahme an mindestens zwölf aufeinanderfolgenden |33|Behandlungsstunden in einem Behandlungsfall und insgesamt mindestens zwölf weiteren Behandlungsstunden bei mindestens zwei einzelpsychotherapeutischen Behandlungen von Patient:innen werden Sie außerdem in die Umsetzung einer Behandlungsplanung, also in die Gestaltung konkreter Interventionen einbezogen (§ 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 PsychThApprO).
1.6 Zusammenfassung und Lernkontrollfragen
Zusammenfassung von Kapitel 1:
Die Fallkonzeption repräsentiert das gegenwärtige Fallverständnis und setzt sich aus dem Therapieauftrag, der Diagnose, dem individuellen Erklärungsmodell sowie dem Behandlungsplan zusammen.
Der Therapieauftrag besteht aus den individuellen Therapiezielen und einer Absprache über den Weg zur Zielerreichung. Therapieziele sollten explizit besprochen werden, „SMART“ formuliert sein und/oder in Form einer Zielerreichungsskalierung fixiert werden.
Diagnosen erleichtern die Planung einer individualisierten Behandlung, helfen, den administrativen Anforderungen des Gesundheitssystems gerecht zu werden, und erleichtern die Kommunikation. Gleichzeitig sind sie defizitorientiert und in gewissem Maße stigmatisierend. Durch die künstliche und deskriptiv-phänomenologische Kategorienbildung sowie ihren begrenzten Informationsgehalt haben sie zudem Limitationen, die zu Nachteilen werden können, aber nicht müssen.
Welche Art von Modell genutzt wird, um eine individuelle Erkrankung zu erklären, ist vor allem vom Krankheitsverständnis abhängig. Das kognitiv-verhaltenstherapeutische Krankheitsverständnis basiert auf Annahmen zu (dysfunktionalen) Schemata und Verhaltensplänen. Das psychoanalytische Problemverständnis fokussiert strukturelle Fähigkeiten und (biografisch frühe) Konflikte. In der systemischen Therapie wird nicht versucht, das „eine wahre“ Erklärungsmodell zu finden, sondern das bisherige Problemverständnis der Patient:innen durch die Betrachtung einer Vielzahl an potenziellen Einflussfaktoren sowie die Annahme zirkulärer Wechselwirkung zu erweitern. Im biomedizinischen Krankheitsverständnis, das psychopharmakologischen Behandlungsansätzen zugrunde liegt, werden Veränderungen im Neurotransmitterhaushalt als (mit-)ursächlich für psychische Erkrankungen postuliert.
Die (störungsspezifische) Behandlungsplanung sollte in drei Schritten erfolgen: Im ersten Schritt sollten Behandlungsleitlinien und qualitativ hochwertige systematische Übersichtsarbeiten gesichtet werden. Im zweiten Schritt wird eine störungsspezifische Detailplanung auf Basis von Therapiemanualen und Praxishandbüchern durchgeführt. Im letzten Schritt wird der Behandlungsplan entsprechend den Fallcharakteristika der Patient:innen individualisiert.
|34|Lernkontrollfragen
Nennen Sie die vier Bestandteile der Fallkonzeption.
Welches Verhältnis besteht zwischen Diagnostik, Fallkonzeption und Intervention?
Welche Kriterien sollte ein Therapieauftrag erfüllen?
Wofür steht das Akronym SMART bei der Formulierung von Therapiezielen?
Beschreiben Sie das Vorgehen bei der Zielerreichungsskalierung.
Nennen Sie die Vorteile, Nachteile und Limitationen von Diagnosen.
Beschreiben Sie die Grundlagen des verhaltenstherapeutischen, psychoanalytisch fundierten, systemischen und biomedizinischen Krankheits- und Problemverständnisses.
Nennen Sie die grundlegenden diagnostischen Methoden zur Erarbeitung des individuellen Krankheits- bzw. Problemverständnisses in den Richtlinienverfahren.
Nennen Sie die drei zentralen Merkmale evidenzbasierter Behandlungen.
Beschreiben Sie die drei Schritte der (störungsorientierten) Behandlungsplanung.
Weiterführende Literatur
Retzlaff, R. (2023). Systemische Therapie – Fallkonzeption, Therapieplanung, Antragsverfahren: Ein praktischer Leitfaden. Heidelberg: Carl-Auer.
Rudolf, G. (2018). Psychodynamische Psychotherapie: Die Arbeit an Konflikt, Struktur und Trauma.Stuttgart: Schattauer.
Schanz, C. G., Equit, M. & Schäfer, S. K. (2023). Therapie-Basics: Fallkonzeption und Behandlungsplanung.Weinheim: Beltz.
|35|2 Grundlagen der Beziehungsgestaltung und Gesprächsführung
Die therapeutische Beziehung ist ein wichtiger allgemeiner Wirkfaktor von Psychotherapie, der das Ergebnis einer Behandlung in vergleichbarem Maße beeinflusst wie die Wahl der Therapiemethode (Norcross & Wampold, 2011). Schulen-, diagnosen- und altersgruppenübergreifend bestehen kleine bis mittlere Zusammenhänge zwischen Therapieergebnissen und Beziehungsqualität, wobei sich die Stärke der Zusammenhänge auf Ebene einzelner Diagnosen bedeutsam unterscheidet (z. B. kleine Zusammenhänge bei Substanzabhängigkeit; mittlere Zusammenhänge bei Borderline-Persönlichkeitsstörung; Flückiger et al., 2018; Shirk & Karver, 2003). Studien operationalisieren die therapeutische Beziehung dabei in den meisten Fällen nach dem Konzept der „therapeutischen Arbeitsbeziehung“, das folgende Komponenten umfasst (Bordin, 1979):
die Übereinstimmung hinsichtlich der Ziele,
die Übereinstimmung hinsichtlich des Wegs zur Zielerreichung,
die affektive Bindung zwischen Patient:innen und Therapeut:innen.
Das heißt, dass eine gute Auftragsklärung – zur Gewährleistung einer Übereinstimmung hinsichtlich der Ziele sowie des Wegs zur Zielerreichung – wahrscheinlich einen relevanten Anteil am generell positiven Effekt der Beziehungsqualität hat. Daher ist es wichtig, diese im Zuge der Fallkonzeption entsprechend stark zu gewichten (vgl. Kapitel 1). Darüber hinaus ist es relevant, dass die Beziehungsgestaltung der Therapeut:innen ein verlässliches Bindungsangebot darstellt. Zwar ist auch bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen unumstritten, dass die therapeutische Beziehung eine zentrale Rolle spielt, allerdings konzentriert sich die Forschung noch immer stärker auf das Erwachsenenalter (Borg-Laufs, Gahleitner & Hungerige, 2018). Im Folgenden weisen wir jedoch auf Besonderheiten der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hin, die Sie während Ihrer BQT-III bedenken sollten.
Besonderheiten der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen