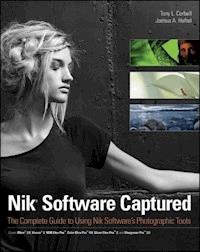7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Tierforscher Lutz Dirksen nimmt uns mit auf eine Expedition: Zu den Stachelrochen in Australien, den Grizzlys in Alaska, den Quastenflossern in der Tiefe vor der afrikanischen Küste, den Anakondas in Südamerika bis hin zu den Vielfraßen in der finnischen Tundra. Für ihn geht das Abenteuer erst los, wenn einem die Wildnis so richtig auf den Pelz rückt. Dirksen erzählt Geschichten mit Gänsehautfaktor, die die Anmut, die Geheimnisse und die Gefahren der Wildnis spürbar machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Über den Autor
Der promovierte Zoologe Lutz Dirksen gehört zu den weltweit führenden Experten für Amphibien und Reptilien. Nach Jahren als leitender Direktor der Leguan Forschungs- und Aufzuchtstation in Honduras kehrte er 2005 nach Deutschland zurück. Seine zahlreichen Reisen führten ihn rund um den Globus. Bei seinen Diavorträgen und Fernsehauftritten, darunter bei stern TV, hat er sein Erzähltalent unter Beweis gestellt. Mehr über Lutz Dirksen unter www.anakondas.de
Lutz Dirksen
Keine Angstvor Anakondas
Die unglaublichsten Begegnungenin der Wildnis
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2013/2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Matthias Auer, Bodman-Ludwigshafen
Titelbild: © von shutterstock/Sebastian Duda,shutterstock/Rudchenko Liliia, shutterstock/Sandra Cunningham,shutterstock/Muzhik, shutterstock/rangiz, © Lutz Dirksen
Umschlaggestaltung: Christina Seitz, Berkheim
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-2503-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Inhalt
Prolog
1: Nachtwache mit Anakonda
2: Wie wir den Biber zum Beißen brachten
3: Tauchfahrt ins Bodenlose
4: Inselschicksale
5: Herzschlag-Sekunden
6: Messerscharfe Argumente
7: Der Mann auf dem Krokodil
8: Ein Zehnfinger-Nest für den Regenpfeifer
9: Der Clan der Vielfraße
10: Die Story vom Bären und der tickenden Uhr
11: Am seidenen Faden
12: Das Donnern der Dickschädel
Epilog
Danksagung
Prolog
Einsamer geht es kaum. Siedlungen oder vereinzelt stehende Hütten – Fehlanzeige. Weit und breit kein Mensch. Nicht einmal weiße Kondensstreifen von Flugzeugen verwehen hier in den Luftströmungen der Atmosphäre. Fünf Tagesreisen sind wir von dem kleinen Indianerdorf entfernt, das an der Mündung des Rewa liegt, einem Zufluss des großen Stroms Rupununi. Im unteren Bereich des Flusses haben wir noch kleine Unterstände von Fischern gesehen. Irgendwann passierten wir dann aber die letzte menschliche Behausung, ohne uns dessen bewusst zu sein. Wir schippern nun tief durch die amazonisch geprägte Wildnis von Guyana. Und sind ganz auf uns allein gestellt.
Das Knattern der Motoren unserer hoffnungslos überladenen Kanus dringt schon lange nicht mehr in unser Bewusstsein. Schleife um Schleife lassen wir hinter uns und winden uns den Fluss hinauf. Kilometer für Kilometer. Wir haben die Boote durch Stromschnellen gezogen und sie, um mehrere Wasserfälle zu umgehen, sogar weite Strecken durch den dichten und unwegsamen Dschungel ziehen und schleppen müssen.
Flussaufwärts bedeutete dann bergaufwärts. Das alles ist zu einer zeitraubenden und kräftezehrenden Angelegenheit ausgeartet. Und genau das macht den Unterschied aus: Denn wo der Fluss die einzige Verbindung zu anderen darstellt, sind die Menschen darauf angewiesen, dass er auch schiffbar ist. Kein Wunder also, dass hier zwischen all den Stromschnellen und Wasserfällen niemand wohnt. Wir sind mitten in der unberührten Natur angekommen. Und genau das war unser Ziel. Hier müssen sie einfach sein. Hier hindert sie niemand daran, zu kolossalen Ausmaßen heranzuwachsen: Anakondas, die größten Schlangen der Welt.
Die Große Anakonda kommt nicht nur in den Gewässern Amazoniens einschließlich der Orinoko-Region vor, sondern ist bis weit in den Süden Brasiliens, Paraguays und Boliviens beheimatet. Wenn auch keine Unterarten existieren, so ist es doch offensichtlich, dass sich die Schlangen regional unterscheiden. In den Überschwemmungssavannen von Venezuela werden sie nicht so groß wie in den Flüssen tief im Dschungel. Heftig wird darüber spekuliert, warum das so ist.
Als Biologe kann ich schwerlich dem Reiz widerstehen, in die unberührte Wildnis vorzudringen, in der die Tierwelt den Menschen nicht kennt und ihm noch unbekümmert gegenübertritt. Wo sonst wäre es möglich, einen natürlichen Bestand zu erfassen? Als Anakonda-Experte ist es zudem eine euphorisierende Gelegenheit, sich auf die Spuren von Anakondas von außergewöhnlichem Kaliber zu begeben, um die Hintergründe ihres Riesenwuchses zu erforschen.
Während und nach meiner Promotion an der Uni Bonn über Systematik und Vorkommen der Anakondas hielt ich über 800 Anakondas in meinen Händen. Ein großes lebendes Exemplar über fünf Meter Länge war allerdings bisher nicht darunter. Größtenteils hatte es sich um konservierte Anakondas aus wissenschaftlichen Sammlungen von Naturkundemuseen in vielen Ländern Europas und Südamerikas sowie den USA gehandelt. Mehrfach habe ich in Südamerika Feldforschungen mit Blick auf die insgesamt vier Anakonda-Arten betrieben. Bis in ein entlegenes Gebiet ganz ohne menschliche Aktivitäten bin ich dabei noch nie gekommen.
Auf der aktuellen, ganz besonderen Expedition nach Guyana begleitet mich der Bonner Kollege Jörg. Er ist von Haus aus Ornithologe, also ein Vogelkundler, den insbesondere Raubvögel und alles Krähenartige faszinieren. Im letzten Moment hat er sich unserer Expedition angeschlossen. Dieses Abenteuer, diese einmalige Gelegenheit will er sich nicht entgehen lassen.
Ich kam schon nach kurzer Zeit nicht umhin, Jörg einen etwas speziellen Charakter zu attestieren. Er gehört zu der Spezies von Biologen, die sich das Philosophieren zu eigen gemacht haben. Jörg ist intelligent, aber eben auf seine Art. Er atmet einen Gedanken ein, zerpflückt ihn im Kopf, bis der ursprüngliche Sinn hoffnungslos verloren ist. Was dann aus ihm heraussprudelt, nötigt zum Nachdenken. Letztens noch begann er über das »Nichts« zu philosophieren, das vor dem Urknall herrschte. Dazu stellte er folgende Thesen auf:
Aus dem »Nichts« kann nichts entstehen, was einem jeder Physiker bestätigen wird.Alles, was vor dem Urknall das »Nichts« war, ist demzufolge auch danach ein »Nichts«.Folglich sind wir selbst auch Teil des »Nichts« und also bei genauer Betrachtung nicht existent …Er schließt seine philosophischen Exkurse am liebsten mit den Worten »Quod erat demonstrandum«, was zu beweisen war! Kurzum: Jörg ist ein wenig anstrengend. Und dies ist seine erste Expedition in den Dschungel Südamerikas.
Hintergrund unserer Expedition ist die fünfteilige Tierserie Big Five Südamerika, zu der wir unseren Teil beitragen. In Anlehnung an die »Big Five« Afrikas haben sich Filmteams aufgemacht zu den Andenbären, den Jaguaren, den Großen Ameisenbären, den Riesenottern – und eben den Großen Anakondas. Eine geniale Idee der Redakteure Bernd Strobel und Udo Zimmermann vom Bayrischen Rundfunk!
Auf Tierexpeditionen geschieht viel Spannendes und Unterhaltsames, während die Kamera nicht läuft oder keine verwertbaren Bilder liefert. Es sind vor allem die Tierfilmer und Biologen, die sich in der Wildnis den Tieren nähern, sie beobachten und ihnen manchmal näher kommen als beabsichtigt. Der Fernsehzuschauer sieht dann das Ergebnis, den fertigen Film. Er folgt gebannt den Berichten. Doch er erfährt nur wenig darüber, wie der Film oder bestimmte Szenen zustande gekommen sind. Dahinter verbergen sich oft abenteuerliche Geschichten voller Entbehrungen und Mühen, gelegentlich aber auch erheiternde Geschehnisse. Immer, wenn sich eine gute Gelegenheit bot, habe ich deshalb mit Biologen und Tierfilmern das Gespräch gesucht, und wir erzählten uns mit glänzenden Augen von heranpreschenden Flusspferden, beißwütigen Schlangen oder von den Tricks und Begebenheiten, die zu gelungenen Aufnahmen führten.
Wider Erwarten mussten dann auch Jörg und ich uns eine lange Nacht im Dschungel von Guyana um die Ohren schlagen. Wir lagen aber nicht im Tarnzelt auf der Lauer. Weit gefehlt. Wir bewachten eine riesige Anakonda! So hatten wir viel Zeit, uns von ganz außergewöhnlichen Begebenheiten zwischen Menschen und Tieren zu erzählen, von denen im Folgenden die Rede sein wird.
Brechen Sie also mit mir auf in die Wildnis. Fiebern Sie mit, und sehen Sie den unglaublichsten Begegnungen zwischen Tieren und Menschen entgegen!
1
Nachtwache mit Anakonda
03:04 Uhr
Sie hat endlich Ruhe gegeben. Der vor mir liegende massige Leib atmet tief ein und aus. Ich denke, der mit schwarzen Punkten versehene, überdimensioniert wirkende Feuerwehrschlauch sammelt neue Kräfte. Das ist gut so, das ermöglicht es mir, mich in Ruhe auf meine Nachtwache vorzubereiten. Ich kippe viel zu viel Kaffeepulver und etwas Zucker in meinen Becher, gieße kaltes Wasser darüber und rühre um. Ich habe noch eine lange Nacht vor mir, in der ich es mir niemals verzeihen würde, einzuschlafen. Neben den dreibeinigen Campinghocker lege ich den neuen Roman von Frank Schätzing, nehme meinen Laptop auf den Schoß und klappe ihn auf.
Erst vor wenigen Minuten hat mich mein Kollege Jörg geweckt, damit ich die letzte Nachtwache übernehme. Mit einem Baumwollsack über ihrem Kopf liegt die Anakonda nun friedlich zusammengerollt vor mir. Am Abend war sie noch sehr unruhig und versuchte immer wieder, sich aus dem Staub zu machen. Es war nervenaufreibend für uns und kostete viel Kraft, diesen Koloss ein ums andere Mal in die Mitte unseres Camps zurückzuverfrachten.
Während ich mich einrichte, erzählt Jörg von den drei Stunden seiner Nachtwache. Die Riesenschlange wollte trotz des Baumwollbeutels mehrfach wegkriechen. Ich sinniere kurz darüber, wie geschlaucht der Schlauch vor mir wohl ist, und frage Jörg, wie er sie daran hindern konnte, ganz auf sich allein gestellt.
Er gähnt herzhaft und sagt: »Indem ich ihr die Hand auf den Kopf gelegt habe!«
Das Koffein wirkt noch nicht. Ich bin noch zu verschlafen, um einen möglichen Scherz zu erkennen, und plappere ihm verständnislos nach: »Du hast ihr also die Hand aufgelegt?«
»Ja!«
»Und sie ist einfach liegen geblieben?«
»Ja.«
Ich schaue ihn an und kann immer noch keinen Witz ausmachen. Endlich lässt er sich zu einer Erklärung herab: »Die Anakonda spürte dann, dass ich noch da war, und hat es aufgegeben, sich verdrücken zu wollen.«
So einfach soll es sein, die riesige Schlange zum Bleiben zu bewegen? Ich bin mir noch immer nicht sicher, ob Jörg sich einen Scherz mit mir erlaubt: »Mach das mal vor, ich will das sehen!«
»So!«, sagt Jörg und legt seine Hand auf den Kopf der Schlange.
Die Schlange bewegt sich etwas, bleibt aber liegen. Das überzeugt mich – vorläufig.
»Und sie hat dabei nicht versucht zu beißen?«, frage ich.
»Nein.«
Ich bin erstaunt, aber nicht über die spärliche Reaktion der Schlange, sondern darüber, dass sich Jörg so kurzfasst. Derart wortkarg habe ich ihn noch nie erlebt. Allerdings habe ich auch noch nie um drei Uhr nachts mit ihm gesprochen. Es ist bestimmt die Müdigkeit, die ihn so einsilbig werden lässt. Das ist vielleicht auch gut so, denke ich. Er wird sich gleich schlafen legen, und ich kann in Ruhe aufschreiben, was wir gestern alles erlebt haben. Nach Tagesanbruch werde ich ohnehin nicht dazu kommen, denn Hektik ist vorprogrammiert. Ich werde die Anakonda vermessen und wissenschaftlich untersuchen, während die Kameras auf uns gerichtet sind.
Ich spüle mehr von der etwas zähflüssigen Brühe in meinem Becher hinunter, um die Wirkung des Koffeins zu beschleunigen.
»Schmeckt’s?«, fragt Jörg grinsend. Ich nicke, obwohl es nicht stimmt. Das war vielleicht ein Fehler, ich hätte besser den Kopf schütteln sollen, denn nun öffnet er die Dose und lässt Kaffeepulver in seine Tasse rieseln. Es ist eine fließende Bewegung, mit der er Wasser darüberkippt und umrührt. Er setzt sich neben mich auf einen Holzstamm. Das wird wohl nichts mit dem Schreiben, denke ich und behalte recht, denn nun werden seine Sätze länger.
»Du bist echt ziemlich verrückt, ausgerechnet mit diesen grottigen Ungeheuern wissenschaftlich zu kuscheln. Wenn mich meine Vögel mal zwacken, umarmen sie mich nicht gleich so heftig wie deine Anakondas.« Am Tag zuvor hatte er eine Ahnung davon bekommen, was passieren kann, wenn man einer großen Anakonda zu nahe kommt. Jörg spielt darauf an, dass Riesenschlangen ihre Beute umschlingen und erwürgen.
»Welcher Teufel hat dich bloß geritten, dich auf diese Viecher einzulassen? Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, als du gestern zu der Anakonda ins Wasser gesprungen bist?«
»Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, es ging alles viel zu schnell«, antworte ich ausweichend.
»Wenn ich mir unsere Aktion von gestern durch den Kopf gehen lasse, hm, das war nicht nur leichtsinnig, das war ein atemberaubender Irrsinn! Was wäre passiert, wenn die Anakonda uns ernsthaft angegriffen hätte?«
Ich staune, Jörg wird nachträglich vom Wenn und Aber eines bestandenen Abenteuers geplagt. Darum geht es also, denke ich. Er will Absolution für seine ausgestandene Angst. Oder steht er unter Schock? »Das kann ich dir auch nicht sagen. Sicher, der Kampf hätte für uns weit schlimmer ausgehen können, wenn sie einen von uns gebissen und umschlungen hätte. Hat sie aber nicht. Darüber zermartere ich mir lieber nicht das Hirn.«
Wir schweigen jetzt beide und brüten vor uns hin.
Irgendwie hat Jörg mich angesteckt, denn nun beginne ich mich selber zu fragen, ob es zu verantworten war, dass wir uns gestern Hals über Kopf in ein gefährliches Abenteuer gestürzt haben. Und ich weiß, dass die Eindrücke des vergangenen Tages – so wie vergleichbare frühere – noch oft auf der Leinwand meines Kopfkinos abgespult werden …
Von Anakondas gepackt
»Mit denen stimmt etwas nicht!« Es war Frühling 1995, als Professor Wolfgang Böhme diesen Satz zu mir sprach. Er ist Herpetologe und hat im Zoologischen Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig in Bonn eine der bedeutendsten Amphibien- und Reptiliensammlungen Deutschlands aufgebaut. Wenn mir jemand bei meinem Problem würde helfen können, dann er, zumal er der Betreuer meiner Diplomarbeit über die Reptilien Boliviens war.
Er hatte bereits eine scheinbar endlos lange Zeit auf die Fotos gestarrt, die ich ihm unter die Nase hielt. Seinen Kopf hielt er ein wenig schief, während sein viel gerühmtes fotografisches Gedächtnis arbeitete, wie immer schnell und präzise. Dass er diesen Satz von sich gab, war schon einmal gut. Ein Stein fiel mir vom Herzen. Ich hatte befürchtet, mich gnadenlos zu blamieren. Tief in den Eingeweiden des Museums hatte ich mich tagelang mit einem Problem herumgeschlagen: Ich brütete über den Fotos zweier Anakondas. Es war zum Mäusemelken, ich hatte die gesamte Fachliteratur aus der Bücherei des Museums durchgearbeitet, um immer wieder an denselben Punkt zu kommen: Es war mir einfach nicht möglich, die Anakondas zu bestimmen. Ich hatte die Fotos im Herbst 1994 für meine zoogeografische Diplomarbeit in Bolivien gemacht, mich dort aber nicht weiter mit den Riesenschlangen befasst. Woher hätte ich wissen sollen, was man alles nicht weiß? Ich hätte es nicht für möglich gehalten, welch immense Wissenslücken es bei diesen spektakulären Großreptilien bislang noch gab. Die Anakonda ist immerhin die größte Schlange der Erde!
Die beiden Exemplare hatten meinen Weg rein zufällig gekreuzt. Meine erste Anakonda lag mehrfach überrollt, blutig und zerquetscht im Straßenstaub. Ein überaus trauriger Augenblick im Leben eines angehenden Reptilienforschers. Ich hatte sie zunächst nicht einmal als Schlange wahrgenommen, als ich mit dem Jeep eine Vollbremsung machte, um nicht auch noch über den großen, langen Gegenstand auf der Piste zu brettern. Sie war etwas über drei Meter lang. Ich wusch ihr dann den Schmutz vom Kopf, legte sie schlangenförmig neben die Straße und schoss einige Fotos.
Ein paar Tage später bremste ich erneut abrupt ab. Emsige Tätigkeiten folgten: Ich riss die Tür des Jeeps auf und streifte mir im Hinauslaufen meinen Fanghandschuh für größere Schlangen über die Hand. Eine knapp zwei Meter lange Anakonda überquerte gerade die Piste. Fast hätte ich sie überfahren, beherzt griff ich nun zu. Natürlich wusste ich, dass Anakondas nicht giftig sind. Ich umfasste ihren Nacken, ihre Beißversuche blieben erfolglos. Stattdessen wickelte sie sich um meinen Arm und übte kräftig Druck darauf aus. Sie dankte mir mein Interesse, indem sie ein äußerst übel riechendes weißes Analsekret abließ. Noch lange nachdem ich die Anakonda wieder freigelassen hatte, hielt ich deshalb den Arm aus dem Fenster des Jeeps.
Damals konnte ich mir nicht vorstellen, dass diese zwei anscheinend gewöhnlichen Anakondas die Initialzündung zu meiner Doktorarbeit sein würden: Das Thema Anakondas hatte mich gepackt! Erst konnte ich es nicht fassen, dass weder die Verbreitung der einzelnen Arten annähernd erforscht war, noch, wie viele Arten überhaupt existieren. Die beiden Anakondas aus Bolivien stellten sich sogar als neue Art heraus.
Grundlagenforschung findet zum größten Teil in den Forschungseinrichtungen dieser Welt statt. Viele Fragestellungen in Bezug auf die Anakondas ließen sich jedoch nur beantworten, indem ich zu ihnen nach Südamerika reiste. Es ist, jenseits von Fachbüchern und Computern, immer diese unmittelbare Nähe zu ihnen in schlammigen Flüssen und Seen gewesen, die für mich den besonderen Reiz meiner Forschungsprojekte ausgemacht hat: Ich bin dann mitten unter ihnen im wilden Amazonien, hinterlasse meine Fußabdrücke in ihren schlangenförmigen Spuren, trinke das Wasser, in dem sie leben.
Der perfekte Platz
Das Prasseln des Regenschauers hat schlagartig aufgehört. Die Sonne taucht den Fluss wieder in gleißendes Licht. Wallende Dunstschwaden steigen jetzt aus dem feuchten Urwald auf und lassen die Umrisse der Bäume mehr oder weniger durchschimmern, je nachdem, wie weit sie von uns entfernt sind. Ich denke an die Dampfhölle des Planeten Jupiter. Allerdings ist die Stimmung friedlich und ruhig wie in einer Traumlandschaft oder einem verwunschenen Märchen. Bei Einsetzen des tropischen Regengusses hatten wir schnell an einer Uferböschung festgemacht und uns abwartend unter eine Plane gekauert. Als die Regenwolken ausgewrungen sind und nur noch letzte Nachzügler ins Wasser ploppen, luge ich unter der Plane hervor. Was ich erblicke, lässt mich einen tiefen Seufzer ausstoßen.
Ganz in der Nähe sehe ich eine Landzunge, die in samtenes Sonnenlicht gehüllt ist. Das Ufer ist halb mit einer angespülten Sandbank, halb mit einem kurz geknabberten Kräuterrasen bedeckt. Meistens sind es Wasserschweine, die das frische, zarte Grün am Wasserrand abweiden. Die wiederum sind ein begehrter Happen für größere Anakondas. Inmitten dieser einladenden Landzunge ist ein Baum ins Wasser gestürzt, von dem nur noch das Gerippe der dickeren Äste vom Stamm absteht. Lediglich seine ehemals obere Hälfte taucht in das Wasser ein. Besser geht es nicht. Da ist er, der optimale Platz. Es kann gar nicht anders sein, hier muss einfach eine Anakonda hausen. An einem solchen Ort fühlt sie sich wohl, ich weiß es genau, ich spüre geradezu ihre unsichtbare Präsenz.
Doch es ist keine Anakonda in Sicht. Entgegen jeder Wahrscheinlichkeit ist sie wohl ausgerechnet in diesem Augenblick ausgeflogen. Ich bin mir sicher, vor dem Regen war sie noch da. Bestimmt hat sie ausgerechnet jetzt eine Beute erspäht, der sie sich tauchend nähert. Wer will es ihr verdenken, dass sie sich einen gehaltvollen Happen holt, der ihr den Magen füllt? Anakondas sind an das Leben im Wasser angepasst. Sie schwimmen exzellent und können lange tauchen. Nasenöffnungen und Augen liegen wie bei den Krokodilen oben am Kopf, sodass sie kaum wahrnehmbar im Wasser lauern können. Am liebsten verdrücken sie Säugetiere, Reptilien und Vögel. Wenn sie noch klein sind, fressen sie aber auch schon mal Fische und Amphibien.
Vielleicht beobachtet sie uns ja, ohne dass wir es bemerken. An mir nagt der unrealistische Gedanke, dass dieser Situation eine besondere Pointe zugrunde liegt: Kaum, dass wir dann diesen Ort verlassen haben, wird eine gigantische Anakonda aus den Fluten an dem Baumstamm emporkriechen und sich hämisch grinsend in der Sonne aalen. Und es macht mir in diesem Moment wenig Mut, dass Anakondas nicht wirklich grinsen können.
Diese Art von Gedanken wird durch die Tatsache verstärkt, dass wir schon seit mehreren Wochen erfolglos nach Anakondas suchen. Mit Mick und Bill, die beide von Ureinwohnern abstammen, sowie Jörg bin ich längst viel weiter den Fluss im ehemaligen British Guyana hinaufgefahren, als ursprünglich geplant war. Zwei Boote inklusive Besatzung haben wir im Basiscamp zurückgelassen, einem Gebiet, in dem wir ursprünglich die Anakondas finden und filmen wollten. Mit nur einem Boot haben wir weitere Wasserfälle und Stromschnellen bezwungen. Wir sind seit einer gefühlten Ewigkeit auf dem Fluss unterwegs und haben keine einzige Anakonda gesehen. Das ist frustrierend. Tag um Tag haben wir die Ufer des Stroms mit unseren Blicken nach den Riesenschlangen durchforstet. Der Rücken eines jeden von uns meldet mittlerweile immer wieder das Bedürfnis nach einem weichen Sofa oder einer wohltuenden Massage an – vergeblich. Rückenlehnen sind ein Luxus, den unsere Boote nicht bieten.
Große Anakondas müssten doch nicht wie Nadeln, sondern wie Baumstämme im Heuhaufen zu entdecken sein, denke ich, mal wieder vor mich hin brütend. Ehrfürchtig betrachte ich den perfekten Platz, auf dem nur eines fehlt: eine fette Anakonda. Optimale Orte wie diesen hier habe ich schon viele gesehen – sehr viele. Und es schmerzt mich jedes Mal erneut, wenn sich wieder einmal keine Anakonda auf einem für die Kamera genialen Sitzplatz, wie ich ihn gerade vor mir habe, niedergelassen hat. Die schlangenlose Landzunge kommt mir vor wie eine sommerliche Blütenwiese ohne Schmetterlinge und Bienen oder wie die Serengeti ohne Gnu- und Zebraherden.
Wir sind ratlos. Seit Wochen fahren wir den Fluss entlang, ohne bisher auch nur die Spur einer Anakonda erblickt zu haben. Wir verstehen die Welt nicht mehr. Sollte es an der etwas verregneten Trockenzeit liegen? Oder kommen Menschen sogar bis in diese entlegene Gegend, Jäger vielleicht, die es auf die Häute der Anakondas abgesehen haben? Meine Hoffnung, eine intakte Anakonda-Population anzutreffen, sinkt von Tag zu Tag.
Die Liebe war noch nie ein leichtes Spiel
Eine intakte Population zur richtigen Jahreszeit. Das wäre der Hauptgewinn schlechthin! Dann könnten wir auch das unvergleichliche Liebesleben der Anakondas beobachten. Zunächst das Übliche: Die Weibchen dieseln ihre Umgebung mit einem verlockenden Liebesparfüm ein. Die Männchen können den Pheromonen nicht widerstehen und strömen in Scharen herbei. Dann aber wird es speziell: Sie alle schlingen sich um das viel größere Weibchen. Bis zu 15 Männchen sind in diesen Paarungsknäueln schon gezählt worden. Die Männchen versuchen sich in die für die Paarung richtige Position zu quetschen und die Konkurrenten wegzudrücken. Das sieht dann aus, als würden armdicke Spaghetti sich gegenseitig umarmen. Für das Weibchen ist das eine anstrengende Angelegenheit. Über vier Wochen kann dieses liebestolle Knäuel zusammenbleiben. Die Weibchen lassen sich dabei auf mehrere Männchen ein. Während ihrer Paarungszeit und Trächtigkeit fressen sie nicht. Nach der Geburt der kleinen Schlangen können sie daher bis zu 40 Prozent ihres ursprünglichen Gewichts verloren haben. Kein Wunder, dass die Weibchen anschließend schon mal ein Jahr mit der Fortpflanzung pausieren und Kräfte sammeln für die folgende Saison.
Auch die rudimentären Beine in Form von zwei beweglichen Spornen rechts und links der Kloake spielen bei der Paarung eine Rolle. Die Beckenknochen sowie die Oberschenkelknochen in den Spornen gelten als sicherer Beweis für die Abstammung der Schlangen von vierbeinigen Echsen. Die Männchen kitzeln und kratzen die Weibchen mit diesen Spornen bei der Paarung. Es wurde beobachtet, dass diese Stimulation die Weibchen dazu veranlasst, eine für das Männchen günstigere Paarungsposition einzunehmen. Wer weiß, vielleicht empfinden die Weibchen es weniger als Kratzen denn als erregende Massage, die sie empfänglicher werden lässt? Einer anderen Theorie zufolge soll das Bewegen der Sporne dazu dienen, die Spermapfropfen der Vorgänger zu entfernen. Vielleicht ist ja an beiden Hypothesen ein Funke Wahrheit dran.
Männchen suchen aktiv nach möglichst großen Weibchen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Ein großes Weibchen kann mehr und größere Nachkommen produzieren. 81 junge Schlangen sind schon gezählt worden, denn Anakondas sind lebend gebärend. Aber auch die Weibchen sind aktiv an der Auswahl der Männchen beteiligt, denn sie positionieren bevorzugte Männchen an optimaler Stelle, indem sie diese mit ihrem Schwanz festhalten. Von anderen Schlangenarten ist bekannt, dass die Weibchen ihre Kloake verschließen können, wenn ein Männchen nicht gefällt. Das dürfte den Anakonda-Weibchen auch in den Kram passen. Immerhin bevorzugen sie größere Männchen. Warum aber sind dann die Männchen im Verhältnis zum Weibchen so viel kleiner? Größere Männchen haben doch einen Selektionsvorteil! Es muss also noch einen anderen Faktor geben, der die Größe der Männchen begrenzt. Dazu gibt es folgende These: Da größere Männchen versehentlich von kleineren für Weibchen gehalten und umschlungen werden, kommen diese nicht zum Zug. Daraus ergäbe sich ein Nachteil für zu große Männchen. Die optimale Größe hätte deshalb ein Männchen, das möglichst groß, aber immer noch klein genug ist, um nicht von den Konkurrenten versehentlich für ein Weibchen gehalten und umärmelt zu werden.
Wir verstauen die Plane, die uns vor dem Tropenregen geschützt hat, starten den Außenborder und legen ab. Sehnsuchtsvoll schaue ich zurück zu dem perfekten Anakonda-Platz, bis er hinter der nächsten Flussbiegung verschwindet. Monoton lärmen die Motoren, während wir erneut dem mäandernden Flusslauf folgen. Kehre um Kehre. Wenn wir nicht in der Mitte des Flusses fahren, hören wir die Wellen ans Ufer klatschen, die unser Boot verursacht. Das Kreischen der davonfliegenden Papageien verkündet unser Kommen schon lange im Voraus. Das stört uns aber nicht, schließlich können Schlangen nicht hören.
Anakonda-Flimmern
Plötzlich drosselt Bootskapitän Mick den Motor. Als wir die Ursache für den Halt erkennen, ist es wie ein Fieberschub, der uns für einen existenziellen Kampf pusht. Endlich haben wir sie entdeckt, die Königin der Seen und Flüsse Südamerikas! Ein kleines Stück voraus liegt eine Anakonda am Ufer. Ein gigantisches Prachtexemplar! Wir sind noch weit entfernt, doch je näher wir kommen, desto begeisterter sind wir: Sie ist exorbitant groß, eine monumentale Wuchtbrumme. Wir sind total aus dem Häuschen! Sie ist der Grund unserer Reise und das Ziel unserer Sehnsüchte. Der erhoffte Sechser im Lotto, und zwar mit Zusatzzahl. Jetzt müssen wir nur noch näher an sie herankommen, bevor sie in die Unsichtbarkeit des braunen Wassers entfleucht.
Unter Experten ist man sich einig, dass es besonders mächtige Exemplare der Großen Anakonda kaum noch in der Nähe von Menschen gibt. Im Gegensatz zu Säugetieren wachsen Reptilien zeit ihres Lebens. Insbesondere Riesenschlangen legen auch nach der Geschlechtsreife noch kräftig zu. Proportional zu ihrer Größe wächst leider auch die Angst der Menschen vor ihnen, ob nun begründet oder nicht. Der Mensch schafft sich seine Umwelt, und was er für gefährlich hält, wird ausgemerzt. In Mitteldeutschland hat er Wolf und Bär ausgerottet, in Südamerika tötet er die großen Anakondas.
An ihrer Größe erkenne ich sofort, dass es sich um ein Weibchen handelt. Männchen erreichen selten mehr als eine Länge von drei Metern, niemals jedoch die Größe des Weibchens, das wir aus vielleicht 50 Metern Entfernung sehen. Auch ist die Anakonda viel zu massig für ein Männchen. Weibchen wiegen ein Vielfaches der Männchen. Es heißt sogar, dass von allen Landwirbeltieren bei Anakondas der größte Gewichtsunterschied zwischen den Geschlechtern besteht.
Unser Prachtexemplar sonnt sich auf einer flachen, lehmigen Stelle unter einer steil abfallenden, bröckeligen Uferböschung. Direkt neben ihr stehen große Sträucher, deren teils unterarmdicke, überhängende Äste weit in den Fluss hineinragen. Das Geäst verdeckt sie teilweise, ihr Kopf ist für uns nicht zu sehen. Dieser schmuddelige Platz entspricht so gar nicht unseren Vorstellungen von einem perfekten Liegeplatz. Aber das ist jetzt vollkommen unwichtig.
Zunächst steuern wir die andere Seite des Flusses an. Hier beratschlagen wir, wie wir weiter vorgehen. Um die Situation besser einschätzen zu können, paddeln Mick und Bill zuerst langsam den Strom hinauf. Es geht darum, auszukundschaften, ob es möglich ist, vom Land aus an die Riesenschlange heranzukommen. Die beiden erklettern sodann die mehrere Meter hohe Uferböschung auf der anderen Seite und schleichen sich an die Anakonda heran. Die nimmt keine Notiz von unseren Scouts und bleibt zum Glück bewegungslos liegen. Nach ihrer Rückkehr fällt das Urteil der beiden Kundschafter eindeutig aus: »Keine Chance.« Die Anakonda wäre längst im Fluss verschwunden, bis wir die matschige Böschung bis zu ihrem Platz hinuntergeklettert wären.
Es ist bereits später Nachmittag, und in der Ferne braut sich erneut ein bedrohliches Gewitter zusammen. Es ist absehbar, dass sich in kurzer Zeit die dunkle Wolkenfront vor die Sonne schieben und sich wieder kühles Nass über uns ergießen wird. Ich denke an die alten Edgar-Wallace-Filme, bei denen gespenstische Gewitter ein Unglück ankündigen und die Spannung steigen lassen. Ist es ein Vorzeichen, das uns warnt? Wir haben indes keine Zeit, darüber nachzudenken, denn wir vermuten, dass die Anakonda bei Gewitter ihren Sonnenplatz verlassen wird.
Kurz diskutieren wir. Dann steht der Plan. Wir versuchen die Schlange vom Boot aus zu fangen. Das ist kritisch, da wir nur zu viert sind. Wir werden die Anakonda überraschen, indem wir ganz plötzlich mit dem Boot vor ihr erscheinen. So versperren wir ihr den Fluchtweg ins Wasser. Ich werde alles daransetzen, ihr eine Seilschlaufe um den Kopf zu legen, die an einem Stock befestigt ist. Nach dem Zuziehen der Schlaufe wollen wir sie, Kopf voran, mit gemeinsamen Kräften ins Boot ziehen.
Bevor wir starten, bauen wir am Ufer gegenüber eine Kamera auf, richten sie auf die Anakonda und lassen sie laufen. Wir besteigen unser Boot und lassen uns bewegungslos abtreiben. Erst als wir aus dem Sichtfeld der Anakonda verschwunden sind, kreuzen wir den Fluss. Der Außenborder wird gestartet. Das knatternde Motorengeräusch ist nicht weiter problematisch, da sie uns ja, wie gesagt, nicht hören kann. Die Gehörknöchelchen werden im Schlangenschädel nicht mehr dazu verwendet, Schall weiterzuleiten, sondern dazu, das Maul noch weiter aufzureißen, um große Beute als Ganzes zu verschlingen.
Das Anakonda-Patt
Dicht am Ufer preschen wir zum Liegeplatz der Anakonda vor. Noch kann sie uns nicht sehen, da die ins Wasser hängenden Sträucher ihr die Sicht versperren. Was wird geschehen? Eine unerträgliche Spannung hat mich gepackt. Eine Art Lähmungszustand. Ähnlich muss sich ein Fußballer fühlen, bevor er zu einem spielentscheidenden Elfmeter antritt. Nur dass es sich bei ihm um einen Sport handelt, wir uns jedoch weit draußen in der Wildnis in wenigen Augenblicken auf den Kampf mit einer mordsmäßig großen Anakonda einlassen werden. Dann ist es so weit, die Anakonda taucht vor uns auf. Sie hebt sofort den Kopf in unsere Richtung und scheint verwirrt zu sein. Der Überraschungseffekt jedenfalls ist gelungen. Da ich vorne im Bug mit Stock, Seil und Schlaufe stehe, schaut sie in meine Richtung. Ihre Augen blitzen mich an. Es ist ihr anzumerken, dass sie beunruhigt ist. Ihre muskulösen Körperschlingen bewegen sich. Ich bin jetzt genau vor ihr, vielleicht einen Meter von ihrem Kopf entfernt. Das ist der Augenblick der Entscheidung, denke ich. So schnell wie möglich stoße ich den Stock vor, um die darunter hängende Schlaufe um ihren Kopf zu bugsieren. Als Nächstes bräuchte ich nur noch an dem Seil zu ziehen, und die Schlaufe würde sich fest um ihren Hals legen. Wir hätten sie, und könnten sie ins Boot ziehen. Doch Theorie und Praxis sind oft wie Feuer und Eis. So auch hier, denn die Anakonda reißt ihren Kopf blitzschnell nach hinten, die Schlaufe baumelt im Leeren. Hat sie geahnt, was ich vorhatte, oder war es der Reflex eines Raubtieres? Jedenfalls kann ich ihren Kopf vom Boot aus nicht mehr erreichen.
Die Anakonda wirkt durch unser störendes Auftauchen in ihrer unmittelbaren Nähe gereizt und zieht es vor, sich seitlich davonzumachen. Sie kriecht flott auf die ins Wasser hängenden Äste und Zweige zu. Schon taucht ihr Kopf ins trübe Flusswasser ein und verschwindet in der braunen Flut.
Dann traue ich meinen Augen kaum. Mick springt plötzlich in den Fluss und kämpft sich durchs Wasser ans Ufer vor. Er packt eine hintere Körperschlinge und stemmt sie in die Höhe. Selbst noch bis zum Bauch im Wasser stehend, reicht er uns das schuppige Reptil und schreit: »Nehmt den Schwanz und zieht sie ins Boot!« Sofort greifen sechs Hände gleichzeitig nach dem Reptil, und tatsächlich gelingt es uns in gemeinsamer Anstrengung, die Anakonda festzuhalten. Das Boot schwankt bedenklich und treibt etwas mit der starken Strömung ab. Wasser schwappt herein, als ein Teil des Anakonda-Körpers auf dem Bootsrand aufliegt. Das Boot ist aus Metall und würde sofort sinken, wenn es mit Wasser vollliefe. Wir verlagern also schnell unser Gewicht auf die andere Seite, ohne die Schlange loszulassen.
Wir wollen die Anakonda ins Boot hieven, doch so leicht lässt sich diese gigantische Schlange nicht überwältigen. Sie ist Kraft pur und hat sich im Gewirr der Sträucher um dicke Äste gewickelt. Eine Pattsituation ist entstanden. Die Anakonda kann nicht flüchten, wir sie nicht ins Boot ziehen. Und wieder traue ich meinen Augen nicht, als Mick im Wasser in das Dickicht zu der Anakonda vordringt. Der ist ja komplett lebensmüde, denke ich. Er versucht sie von den Ästen zu lösen. Mick ist in Reichweite ihres Kopfes, der zunächst noch unter der Wasseroberfläche abgetaucht bleibt. Die Anakonda kämpft und will sich aus unserem Griff befreien.
Mick schafft es alleine nicht. Plötzlich sehe ich, wie er ins Wasser greift und angestrengt an seinem Bein hantiert. Die Anakonda hat eine Schlinge um sein Bein gelegt! Wenn sie ihn jetzt beißt, weitere Schlingen um ihn legt und ihn unter Wasser zieht, dann hat er ein ernstes Problem. Mick ist in großer Gefahr. Doch das Gesträuch vor mir ist viel zu dicht, als dass ich ihm direkt zu Hilfe kommen könnte.
Ohne nachzudenken, springe ich trotzdem auf der Flussseite ins Wasser, schwimme um das Boot herum und arbeite mich zu ihm in das Gestrüpp vor. Mir ist äußerst mulmig zumute, als ich unter zwei dicken Ästen hindurchtauchen muss, um zu Mick zu gelangen. Bei ihm angekommen, packen wir gemeinsam den sich windenden Körper und befreien mühsam sein Bein.
Das Haupt der Medusa
Plötzlich taucht der riesige Kopf des Reptils zwischen uns und dem Boot auf. Womöglich braucht die Schlange frische Luft. Ich weiß allerdings aus Erfahrung, dass Anakondas viel länger ohne Sauerstoff auskommen. Vermutlich will sie sich orientieren – oder sich aggressiver zur Wehr setzen. Dicke Regentropfen prasseln mittlerweile ins Wasser und erschweren der Anakonda die Orientierung. Doch sie hat mich entdeckt und starrt mich bewegungslos an. Dieser Moment von Angesicht zu Angesicht lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich verharre bewegungslos.
Schon mehrfach bin ich von Schlangen gebissen worden. Für die Psyche gibt es kaum etwas Schlimmeres als das panische Erschrecken angesichts eines auf dich zufliegenden Schlangenkopfes mit weit geöffnetem Maul, dessen Zähne sich unweigerlich in deine Haut und dein Fleisch graben werden. Ein Schock vom Feinsten! Dann der Biss. Ganz kurz nur, das ist ausreichend. Die kleinen nadelartigen Wunden sind allerdings nicht wirklich das Problem, außer natürlich bei Bissen von Giftschlangen. Aber: Wer weiß schon, ob ihn eine giftige oder eine harmlose Schlange gebissen hat?! Wie aus einem dunklen Albtraum kriecht die Angst ins Bewusstsein, dass die Schlange ein tödliches Gift injiziert haben könnte. Manch einer ist schon am Schock und der Angst vor einem giftigen Biss gestorben, obwohl die Schlange zu den harmlosen gehörte.
Mich haben bisher immer nur ungiftige Schlangen erwischt, vermutlich, weil ich als Schlangenexperte entsprechend lässig mit denen umging, die ich als ungiftig erkannte. Gebissen wurde ich immer in die Hände. Auch auf dieser Expedition bin ich nicht verschont geblieben. Die Kameraleute hatten mich gebeten, einen Hundskopfschlinger – ja, so heißt die Art wirklich – aus dem Schatten auf einen Ast in das blendende Licht des herannahenden Abends zu setzen. Diese Schlangenart ist giftgrün und gehört wie die Anakonda zu den Riesenschlangen. Allerdings ist sie bedeutend kleiner und darauf spezialisiert, mit zwei besonders langen Fangzähnen Vögel aus der Luft zu erbeuten. Ich hatte nicht bedacht, dass Schlangen, die Vögel im Flug abgreifen können, extrem schnell sind. Als ich sie losließ, schoss sie auf meine Hand zu und hieb ihre beiden Fangzähne mit Schwung in meinen Daumen. Es tat ziemlich weh. Ich säuberte und desinfizierte die beiden Wunden, klebte ein Pflaster darüber und war bereit, den Vorfall schnell zu vergessen. Die Leute um mich herum allerdings, die das beobachtet hatten, erwarteten besorgt, dass ich bald umfallen würde. Da nützten auch alle Beteuerungen nichts, dass die Schlange ungiftig sei.
Von einer Anakonda wurde ich zum ersten Mal 1998 gebissen. Ich erläuterte gerade einem bolivianischen Kollegen ein spezielles Schuppenmerkmal am Maul einer 1,80 Meter langen Beni-Anakonda. Er hielt die Anakonda in seinen Händen – und dabei bin ich ihrem Kopf mit meinem Zeigefinger zu nahe gekommen. Völlig überraschend biss sie blitzschnell kräftig in meinen Finger. Reflexartig zog ich meine Hand zurück. Dadurch rissen ihre Zähne Wunden, die stark bluteten. Nachdem die Blutungen endlich gestoppt waren, schaute ich mir mit einer gewissen Faszination die ungefähr 20 nadelstichartigen Bissstellen an meinem Finger an. Sie waren in kleinen Reihen angeordnet. Immerhin: Ich bekam dadurch einen unwiderlegbaren Beweis geliefert für ein Detail des Kieferbaus der Riesenschlangen, das nur in speziellen Fachbüchern beschrieben steht: Sie haben innen im Oberkiefer eine zweite Zahnreihe, die sich anhand der Bissspuren an meinem Finger abzeichnete. Sich beißen zu lassen wäre also eine ideale Methode, um Biologiestudenten die Kieferanatomie der Riesenschlangen nachhaltig einzuprägen. Ärgerlich an meinem Erlebnis war nur, dass der Anakonda eine Zahnspitze abgebrochen war und dies erst Wochen später wegen einer dadurch entstandenen Eiterbeule von mir entdeckt wurde.
Marías Biss
Auch María biss mich in die Hand. María war allerdings kein Bond-Girl, sondern ein frei lebendes, 1,50 Meter langes Weibchen der Paraguay-Anakondas. Diese Art ist kleiner als die weiter nördlich beheimatete Große Anakonda. María nimmt an einem Forschungsprojekt teil, durch das die Lebensgewohnheiten der Anakondas erforscht werden sollten. Ihren Namen gab ihr der argentinische Biologe Tomás Waller. Schon lange stand ich in regem Austausch mit diesem Kollegen und freute mich darauf, ihn und seine Anakondas endlich kennenzulernen. 2002 besuchte ich ihn in Argentinien. Ein Kamerateam eines Privatsenders begleitete mich, um eine Dokumentation über sein Anakonda-Projekt zu drehen.
María trug einen Sender, mit dem sie zielgenau geortet werden konnte. Die Batterie des Senders war jedoch fast leer und sollte ausgetauscht werden. Das bedeutete: anpeilen und sie einfangen. Das Kamerateam war begeistert. Endlich wieder Action, nachdem wir zuvor kein Glück dabei gehabt hatten, eine andere Anakonda des Projekts mit Namen Vicky aufzuspüren. Wir hatten uns Vicky mit Antenne und Empfänger genähert, doch sie war zu tief in Wurzelhöhlen am Ufer eines Sees versteckt. Mein Kamerateam war enttäuscht. Ich hatte meinen ganzen Arm in die Höhle gesteckt und versucht, die Anakonda zu ertasten. Dabei hielt mir das Team das Mikro vor die Nase, und ich sollte darüber sprechen, was ich da mache und ob ich Angst habe, gebissen zu werden. Wer würde das schon vor laufender Kamera zugeben! Ich verneinte.
Die Filmcrew hoffte, dass mein Arm um eine daran hängende Anakonda verlängert wäre, wenn ich ihn wieder aus der Höhle ziehen würde. Eine blutüberströmte Hand mit einer in die Finger verbissenen Anakonda, das wäre gut für die Einschaltquoten gewesen, erklärte mir der Kameramann später …
Doch zurück zu María: Sie hatte es sich in einem flach abfallenden See bequem gemacht, wie uns das Pling des Peilgerätes mitteilte. Wir folgten dem Signalton ungefähr 15 Meter weit in das hüfthohe kalte Wasser hinein. María musste uns längst entdeckt haben und war auf Tauchstation gegangen. Als das Pling des Peilgerätes bei senkrechter Stellung am lautesten zu hören war, bedeutete dies: Die Schlange war direkt unter uns! Mit unseren Armen tasteten wir in die trübe Tiefe. Es stellte sich dann heraus, dass sie sich gut einen Meter unter der Wasseroberfläche zwischen großen, inselartigen Grasbüscheln verbarg. Patricio, ein Mitarbeiter des Projektes, bekam sie in die Hände und hob sie langsam aus dem Wasser. Das passte María gar nicht, und als der Kopf zum Vorschein kam, war deutlich die Angriffsstellung der Anakonda zu erkennen. Den vorderen Körperteil hielt sie s-förmig, so konnte sie nach vorne schnellen und zubeißen. Der Angriff auf Patricio stand direkt bevor. Sofort versuchte ich, sie hinter dem Kopf zu fassen. Da drehte sich María erstaunlich flink zu mir um. Und schoss vor. Gut ein Dutzend Zähne bohrten sich in meine Hand. Blut lief die nassen Finger hinab und färbte meine Hand rot. Das alles geschah zu meinem Leidwesen ausgerechnet in bestem Blickwinkel vor laufender Kamera. Das Team freute sich, jetzt hatten sie ihre erhofften Bilder. Diese Szene wurde später in der Dokumentation mehrfach und in Zeitlupe gezeigt!
Abends betrachtete ich das Muster der nadelstichartigen Bisswunden. Es kam mir vor, als hätte mir María ihren persönlichen Stempel hinterlassen. Vielleicht war es ja ihre Unterschrift zur Teilnahme am Projekt, die sie ausgerechnet mir geben wollte. Wenn ich heute darüber nachdenke, dann sah es allerdings eher nach einer Kündigung aus.
Keine der Schlangen, die mich gebissen haben, ist jedoch annähernd so groß gewesen wie die Anakonda, mit der ich mich jetzt in Guyana, im Fluss lauernd, konfrontiert sehe. Sie nimmt mich ins Visier und hat guten Grund, verärgert zu sein. Bei ihr würde ich die Hand nicht zurückziehen können, sollte sie mich mit ihren gut 100 etwa drei Zentimeter langen Zähnen packen.
Die Anakonda würde nicht nur beißen, sondern sich auch um mich wie um eine Beute winden und zudrücken. Anakondas sind bei dieser Nahkampfmethode besonders geschickt. Sie jagen im Wasser und drücken den umschlungenen Angreifer unter die Wasseroberfläche. Die Beute ersäuft elendiglich. So werden die Anakondas im Kampf kaum verletzt und müssen weniger Energie aufbringen. Im Wasser sind sie klar im Vorteil, folglich auch besonders gefährlich.
Mick und ich sind immer noch im Wasser und in Reichweite des Anakonda-Weibchens. Ein Frontalangriff des Reptils wäre jetzt fatal. Sie ist die Herrscherin des Flusses und es nicht gewohnt, dass sich Tiere an sie heranwagen. Immer noch funkeln mich ihre Augen an, während sie mich mit ihrem Blick fixiert. Das sieht nicht gut aus, denke ich. Vielleicht ist es aber genau dieser Blick zu mir, der sie von dem Geschehen um sie herum ablenkt. Geistesgegenwärtig hat sich Bill den Stock mit der Seilschlaufe geschnappt und legt sie ohne Umschweife um ihr Haupt. Er zieht die Schlaufe zu, sofort will die Anakonda seitlich ausbrechen. Zumindest kann sie uns jetzt nicht mehr erreichen, denke ich. Jörg hält noch immer den Schwanz in seinen Händen. »Lass jetzt den Schwanz los, hilf mir mit dem Seil!«, brüllt Bill hektisch. Jörg lässt den Schwanz ins Wasser platschen, und gemeinsam ziehen sie nun den Kopf der sich heftig wehrenden Anakonda zum Boot. Als sie den Kopf über den Bootsrand hieven, schnappt sich Bill den Hals des Ungetüms mit beiden Händen, um zu verhindern, dass sich seine langen, spitzen Zähne in Arme oder Beine der Bootsbesatzung bohren. Die Anakonda droht: Das Maul ist weit aufgerissen. Ihr zischender Atem vermischt sich mit dem von Bill.
Das Boot schaukelt heftig und gerät erneut in Schieflage. Wieder schwappt Wasser über die Reling. Stück für Stück ziehen Bill und Jörg die Schlange ins Boot. Mick und ich helfen, tief im Strom stehend, mit, indem wir immer wieder ihren in die Sträucher verschlungenen Körper losmachen – und auch unsere Beine von ihm befreien. Wir sind völlig außer Atem, nass, verdreckt, zerkratzt und erschöpft, als das letzte Ende der Schlange endlich über den Bootsrand rutscht.
Ich wate zum Boot, um mir einen Überblick zu verschaffen. Es schüttet jetzt aus allen Kübeln. Bill hält weiterhin den Kopf der Schlange fest, während Jörg noch mit dem sich windenden Körper kämpft. Wir klettern schnell ins Boot und helfen ihm, die Schlange zu halten. Jetzt haben wir sie sicher. Ich schaue auf die Anakonda und kann es kaum fassen: Was für ein kapitaler Fang! Geschätzte 120 Kilogramm Schlange wälzen sich vor mir im Boot. Später beim Vermessen werde ich feststellen, dass sie eine Länge von annähernd sechs Metern besitzt. Sie ist größer als die über 500 Anakondas eines Forschungsprojektes in den Überschwemmungssavannen im benachbarten Venezuela. Wir sind begeistert. Ein Volltreffer! Uns ist der große Wurf geglückt. Dieses Exemplar ist ein Beleg dafür, dass die Anakondas an ganzjährig Wasser führenden Flüssen größer werden als in Regionen mit saisonaler Trockenheit. Wir sind uns sicher: Wenn wir noch weitere Anakondas in der unberührten Wildnis Guyanas finden, werden noch weit größere Exemplare darunter sein. In glaubwürdigen Berichten ist von bis zu neun Meter langen Schlangen die Rede.
Und es gab sogar noch größere Schlangen: Titanoboa, eine nahe Verwandte der Anakondas, lebte vor 60 Millionen Jahren in Südamerika. Paläontologen fanden extrem große Wirbel dieser Schlange. Daraus errechneten sie eine Länge von unglaublichen 15 Metern! Ein wahrlich unglaublicher Titan muss sie gewesen sein und ganz sicher die Herrscherin über ihre längst vergangene Welt. Noch mehr als bei den Anakondas muss das Leben dieser Giganten ans Wasser angepasst gewesen sein. Selbst große Anakondas sind an Land sehr langsam, wirken eher plump und unbeholfen als schnell und agil.
Etwa 15 Minuten haben wir mit der Anakonda gerungen – uns erschien es allerdings wie eine Ewigkeit. Ohne Micks beherzten Sprung ins Wasser und seinen Mut, sich zwischen den Sträuchern in die Reichweite des riesigen Mauls der Anakonda zu begeben, hätten wir dieses muskulöse Kraftpaket niemals gefangen. Bestimmt gehörte auch eine gehörige Portion Glück dazu, dass wir es tatsächlich geschafft haben, ohne dass einer von uns größere Blessuren davongetragen hat.
Die Himmelsschleusen öffnen sich jetzt wie zur ultimativen Sintflut. Der Regen holt uns in die Wirklichkeit zurück, kühlt unsere erhitzten Gemüter ab. Wir ziehen der Schlange einen Baumwollbeutel über den Kopf. Ein solcher Beutel bietet entscheidende Vorteile: Das Reptil kann atmen, sieht aber nichts mehr – und kann nicht mehr richtig zubeißen. Erfahrungsgemäß bleiben Reptilien mit einem Beutel über dem Kopf ruhig liegen. Jetzt erinnern wir uns wieder an die Kamera, die nach wie vor am gegenüberliegenden Ufer steht und filmt. Zum Glück hatten wir sie mit einem Regenschutz versehen. Als wir sie holen, stellen wir enttäuscht fest, dass sich fast die ganze Szene außerhalb des Blickwinkels der Kamera abgespielt hat, weil die Anakonda seitlich ins Gestrüpp ausgewichen ist. Lediglich der schwankende Bug des Bootes und Wellen im Wasser lassen erahnen, welches Drama sich soeben abgespielt hat.