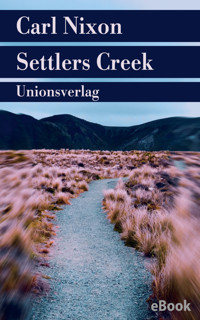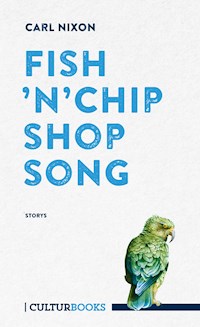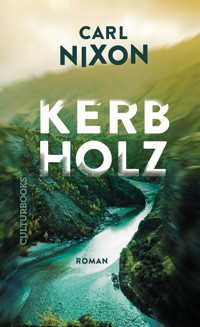
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Die neuseeländische Version eines Outback Noir, ungemein spannend und atmosphärisch erzählt.« The Observer Ein packender und psychologisch präziser Roman über die Bedeutung von Familie und das Überleben in einer unwirtlichen Natur – mit der wilden Westküste Neuseelands als eine der Hauptfiguren. Eine britische Familie stürzt an der dünn besiedelten Westküste Neuseelands mit dem Auto über eine Klippe in die Tiefe. Nur die drei Kinder auf dem Rücksitz überleben den Unfall. Nach zwei Tagen werden sie von zwei Outlaws gerettet, die mitten im Buschland eine abgelegene Farm betreiben. Schnell stellt sich heraus, dass den vermeintlichen Rettern ein paar günstige Arbeitskräfte gerade gelegen kommen … Schon bald führt jedes Kind seinen ganz eigenen Kampf ums Überleben und die Freiheit. Und im fernen England macht sich ihre Tante auf die Suche nach den Verschwundenen. Mit einem tiefen Verständnis für die Psychologie seiner Figuren fragt Nixon danach, welche äußeren und inneren Zwänge den Menschen prägen, welche Verpflichtungen wir unseren Verwandten gegenüber haben – den Lebenden und den Toten – und vor allem, was eine Familie im Kern eigentlich ausmacht. »Neuseeland war das letzte Land der Welt, das von Menschen besiedelt wurde. Mich interessiert der historische Prozess, wie Menschen nach Neuseeland kommen und dann durch das Land verändert werden. In Kerbholz sind es drei Kinder aus der englischen Oberschicht, die plötzlich auf sich allein gestellt mit dieser rauen Landschaft und den Bedingungen, die sie dort vorfinden, zurechtkommen müssen. Mir schien dies ein Spiegelbild der Geschichte Neuseelands zu sein.« Carl Nixon Pressestimmen (Auswahl) »Neben der perfekt beschriebenen Landschaft Neuseelands sind es die komplizierten moralischen Entscheidungen, mit denen sich die Figuren auseinandersetzen müssen, die diesen Roman zu einer packenden Geschichte über Verlust und Überleben machen.« Karen Dionne »Nixon beschreibt Erfahrungen, die unsere tiefsten Ängste berühren: einer grausamen Natur und, vielleicht noch schlimmer, wenig vertrauenswürdigen Menschen ausgeliefert zu sein.« World Editions »Nixons Beschwörung der realen Landschaft Neuseelands und des inneren Gegenstücks seiner Figuren bleibt lange im Gedächtnis haften.« The Times »Äußerst filmisch und eindringlich.« Radio New Zealand »Kerbholz ist ein Roman der besten Art: komplex, nachdenklich, erschütternd, und mit einer solchen Leichtigkeit geschrieben, dass man ihn nicht mehr aus der Hand zu legen vermag.« Louise Ward, Wardini Books »Man riecht förmlich den Busch des neuseeländischen Hinterlands, sieht die Vögel fliegen, spürt den feuchten Waldboden.« Alyson Baker, Nelson Public Libraries
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Deutschsprachige eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2023
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
The Tally Stick © by Carl Nixon 2020
By agreement with Pontas Literary & Film Agency.
The assistance of Creative New Zealand
towards the translation of this book is
gratefully acknowledged by the publisher.
Korrektorat: Christin Ullmann
Herstellung: Klaus Schöffner
Umschlaggestaltung: Cordula Schmidt Design, Hamburg
Umschlagabbildung: © Michael Hall, Gettyimages
1. Auflage 2023
ISBN 978-3-95988-231-6
Über das Buch
Eine britische Familie stürzt an der dünn besiedelten Westküste Neuseelands mit dem Auto über eine Klippe in die Tiefe. Nur die drei Kinder auf dem Rücksitz überleben den Unfall. Nach zwei Tagen werden sie von zwei Outlaws gerettet, die mitten im Buschland eine abgelegene Farm betreiben. Schnell stellt sich heraus, dass den vermeintlichen Rettern ein paar günstige Arbeitskräfte gerade gelegen kommen …
Schon bald führt jedes Kind seinen ganz eigenen Kampf ums Überleben und die Freiheit. Und im fernen England macht sich ihre Tante auf die Suche nach den Verschwundenen.
Ein packender und psychologisch präziser Roman über die Bedeutung von Familie und das Überleben in einer unwirtlichen Natur – mit der wilden Westküste Neuseelands als eine der Hauptfiguren.
Über den Autor
Carl Nixon, geboren 1967 in Christchurch, Neuseeland, schreibt Romane, Kurzgeschichten und Dramen. Er gewann mit seinen Werken zahlreiche Preise, und gleich sein erster Roman »Rocking Horse Road« war auch in Deutschland ein Erfolg: Das Buch stand 2012 vier Monate lang auf der KrimiZEIT-Bestenliste. Es folgten die Romane »Settlers Creek« (2013), »Lucky Newman« (2015) und die Geschichtensammlung »Fish 'n' Chip Shop Song« (2019).
»Neuseeland war das letzte Land der Welt, das von Menschen besiedelt wurde. Mich interessiert der historische Prozess, wie Menschen nach Neuseeland kommen und dann durch das Land verändert werden. In Kerbholz
Carl Nixon
Kerbholz
Roman
Kerbholz: historisch, mit Einkerbungen über Schulden markiertes Holzstück, das in zwei Teile gespalten wird, die als Beweisstücke an Kreditgeber und Schuldner ausgehändigt werden
Familie:
Das Auto mit den drei schlafenden Kindern verließ die Erde. Vom Rand der bewaldeten Steilküste, an der sich die vom Regen glatte Straße in die so tückische Kurve krümmte, bis hinab zum reißenden Fluss am Fuß der Klippen waren es fast zwanzig Meter. Es schien kein Mond in dieser Nacht, niedrige, bleierne Wolken verdeckten den Himmel. Für den Bruchteil – eines Bruchteils – eines Augenblicks hing das Auto wie schwebend in der Luft. Sehr bald würden die Kinder anfangen zu fallen. Hinab auf die Wipfel der Bäume. Hinab auf das zwischen den Felsbrocken entlangrauschende Wasser. Der Zukunft entgegen.
Die einzig wache Person war der Fahrer, der Vater der Kinder, John Chamberlain. Der Schein des Armaturenbretts fiel auf sein langes, schmales Gesicht. Er starrte nach vorn, nach Osten, wo die Scheinwerfer über einen schier endlosen Wald leuchteten; dicke, diamantene Regentropfen kreuzten den Lichtkegel. Mehr noch als Angst lag Unglauben auf seinem Gesicht. Mit beiden Händen umklammerte er das Lenkrad, als hätte er noch immer alles unter Kontrolle. Vielleicht glaubte er, es gäbe sogar jetzt noch irgendein Manöver, das er ausführen könnte, irgendeinen geheimen Hebel, von dem nur wenige wüssten, nach dem er suchen, den er betätigen konnte; etwas – irgendetwas, womit er seine Familie retten konnte. Hinter ihm seufzte eines der Kinder auf und bewegte sich im Schlaf.
»Julia.« Johns Stimme war ein trockenes Flüstern.
Die Mutter der Kinder saß neben ihm, ihr Kinn ruhte vogelartig an ihrer Schulter, den Kopf hatte sie gegen die Tür gelehnt, abgepolstert durch eine Strickjacke. Einige Zeit zuvor hatte sie den Sicherheitsgurt gelöst – er war unbequem gewesen –, und nun kringelte er sich locker ihre Schulter hinab in die flache Mulde ihres Schoßes. Sie träumte von Pferden. Drei gescheckte Stuten liefen nebeneinander über ein trockenes, karges Feld. Weißer Staub wirbelte auf und stieg um sie herum empor. Immer schneller liefen die Pferde, als versuchten sie, dem aufgeworfenen Staub zu entkommen. In Julias Traum dröhnten die Hufe der Pferde unvorstellbar laut.
John wünschte sich, es bliebe Zeit, sich bei seiner Frau zu entschuldigen. Es gab so viele Dinge, die ihm leidtaten: die vielen Stunden, die er bei der Arbeit verbracht hatte; dieser armselige Streit wegen der Tapete; die Frau in Tottenham, von der Julia immer noch nichts wusste. Am meisten bereute er, die Kinder in dieses Land gebracht zu haben. Julia hatte London nicht verlassen wollen. Er hatte sie bedrängt. Ja, das war das richtige Wort, bedrängt, jetzt konnte er es zugeben. Er hatte darauf bestanden, dass dieser Job ein Sprungbrett sei. Eine einfache Möglichkeit, Fuß zu fassen, bevor es weiterginge. Er hatte ihr eine Zukunft mit einer Versetzung ins New Yorker Büro versprochen, vielleicht sogar nach Paris. Sie würden ein Kindermädchen einstellen, sobald sie sich in dem Haus in Wellington, einem malerischen kleinen Städtchen, eingelebt hätten. »Es sind gerade mal zwei Jahre am Ende der Welt«, hatte er gesagt. »Du musst Neuseeland als ein großes Abenteuer sehen.« Am Ende hatte sich Julia auf seine Sicht eingelassen. Sie war eine gute Ehefrau. Eine gute Mutter.
Vor ein paar Stunden hatte die Familie in einem kleinen Ort haltgemacht, um Steak mit Pommes zu essen. Julia sprach davon, ein Zimmer für die Nacht zu nehmen. Vielleicht könnten sie am nächsten Morgen mit den anderen Touristen einen Spaziergang durchs Tal machen, um sich den Gletscher anzusehen? Begeistert von der Idee sahen die Kinder von ihrem Essen auf.
»Es ist nur eine Wand aus schmutzigem Eis«, sagte er und schob mit dem Daumen seinen noch halb vollen Teller zur Seite. »Da gibt’s nichts zu sehen. Außerdem wird dieser Regen bestimmt nicht so schnell aufhören, jedenfalls nicht vor morgen früh. Wir sollten zusehen, dass wir weiterkommen.«
Man hatte John gesagt, dieser Teil des Landes sei ein Naturwunder, ein Relikt der Vorzeit, aber sie hatten in den letzten drei Tagen ihrer Reise nichts als unerbittlichen Regen und graue Küsten kennengelernt, nichts als hinter Wolken verborgene Berge und halb gare Pommes. Hätten sie Eintritt bezahlt, er hätte sein Geld zurückverlangt.
Als sie das Restaurant verließen, war es bereits dunkel. Vornübergebeugt hetzten sie zum Auto; die Aufschrift »Zimmer frei« auf dem Neonschild vor dem Motel nebenan verschwamm durch den strömenden Regen bis zur Unkenntlichkeit. Er hatte so etwas noch nie gesehen. Tropfen so groß wie Murmeln. Monsunregen.
Er war die Küste hinuntergefahren, auf dem Weg zu dem einzigen Gebirgspass, den es so weit südlich gab. Selbst bei voller Leistung hatten die Scheibenwischer schwer damit zu kämpfen, das Wasser von der Windschutzscheibe zu fegen. Die drei ältesten Kinder hatten es sich mit Kissen, Schlafsäcken und einer Wolldecke auf dem Rücksitz gemütlich gemacht. Eingelullt vom Vibrieren des Motors und den Trommelschlägen des Regens auf dem Dach, waren sie schnell eingeschlafen. Das Baby, Emma, brauchte länger, um zur Ruhe zu kommen. Sie lag zu Füßen seiner Frau in einem tragbaren Bettchen, einem modischen Hippie-Babytragesack, der bis unters Kinn hochgezogen werden konnte. Sie hatten es von Julias Schwester Suzanne als Abschiedsgeschenk bekommen. Damals hielt John das Bett für eine Verschwendung von kostbarem Platz, aber es hatte sich als überraschend nützlich herausgestellt. Emmas Gequengel hatte sich in ein sanftes Schnaufen verwandelt und dann in Stille aufgelöst.
Laut Landkarte waren sie auf einem Highway unterwegs, aber John kam es mehr wie eine Nebenstraße vor. Es gab keine Ortschaften mehr, keine Straßenlaternen, nicht einmal ein erleuchtetes Farmhausfenster in der Ferne. Schließlich führte die Straße sie von der Küste fort. Über lange Kilometer hinweg wuchsen die Bäume bis direkt an den Asphalt heran, ihre Äste waren mit Moos überwuchert. Das Scheinwerferlicht ließ sie kurz aufleben, dann verschwanden sie hinter ihnen in der Dunkelheit. Alles ertrank in dem unaufhörlichen Regen. Keine Lichter tauchten im Rückspiegel auf. Kein einziges Auto auf dem Weg nach Norden kam ihm entgegen.
John hatte das Wasser auf der Straße erst im letzten Moment gesehen. Es breitete sich am Ende einer geraden Strecke aus, auf der er unbedachterweise beschleunigt hatte. Er trat auf die Bremse und spürte, wie der Wagen ins Rutschen geriet, während er dagegen ankämpfte. Wie wild am Steuer zu reißen, brachte gar nichts, das Auto hatte seinen eigenen Willen und ließ sich nicht überzeugen. Mit immer noch hohem Tempo verließen sie die Straße. Die Reifen gruben sich in den schmalen Streifen aus Schlamm und Kiesel, und die Motorhaube drang in die weichen Falten des Waldes ein. Eigentlich hätten sie einen Baum erwischen und gewaltsam am Straßenrand zum Stehen kommen müssen, wo man sie nur Stunden später gefunden hätte. Stattdessen glitt das Auto wie eine Klinge zwischen den Stämmen hindurch. Die einzigen Geräusche waren der Motor, der Regen und das lange Schrammen von Zweigen über Metall. Sie pflügten voran, einen steilen Abhang hinab, zermalmten Farne, knickten Schösslinge um, bis zu der Klippe über dem Fluss, die von der Straße aus nicht zu sehen gewesen war. Auch das letzte große Hindernis, einen Granitfelsen von der Größe einer Waschmaschine, verfehlte das Auto geflissentlich um nur wenige Zentimeter.
Es schoss vorwärts.
In die Luft. Wo es hängen blieb.
Für den Bruchteil eines Augenblicks leuchteten die Scheinwerfer nach Osten über den Wald. Diamanten glitzerten in weißem Licht. Eines der Kinder bewegte sich und seufzte im Schlaf, als die Scheibenwischer ihren Abwärtsbogen zogen. Es war alles so schnell gegangen, dass John noch keinen verständlichen Laut von sich gegeben hatte.
Es stimmt also, dachte er. Zum Ende hin verlangsamt sich alles.
»Julia.«
Vom Gewicht der Maschine gezogen, neigte sich das Auto nach vorn. Die Scheinwerfer veränderten ihren Winkel und enthüllten wild sprudelndes Wasser und schemenhafte Felsbrocken.
Und dann fielen sie.
Als Julia ihn schließlich ansah, bemerkte John, dass sich ihre Augen mit Angst füllten, wie Wasser einen blau gekachelten Pool. Er versuchte, seine Hand nach ihr auszustrecken. Er wollte sie beruhigen, aber es war zu schwer geworden, sich zu bewegen. Wenn nur der Sicherheitsgurt nicht so stark gegen seine Brust drücken würde. Beinahe konnte er sie erreichen.
Die Art und Weise, wie John ihren Namen sagte, erschreckte Julia mehr als der nicht zu entschlüsselnde Ausdruck auf seinem Gesicht. Über seine Schulter hinweg sah sie die Welt außerhalb des Autos als albtraumhaftes Kaleidoskop auf sie zustürzen. Ungewollt schoss ihr ein Gebet durch den Kopf. Ein Gebet zu einem Gott, an den sie zuletzt vor vielen Jahren als kleines Mädchen geglaubt hatte. Der verschmähte Gott ihrer Mutter. In einer flüchtigen Beschwörung, eher einem Wunsch, flehte Julia jemand Mächtigeren, als sie selbst es war, an, sie zu retten. Bitte mach, dass ich noch nicht aufgewacht bin. Lass mich immer noch träumen.
Das Auto fiel schneller. Es kippte ab, begann sich zu drehen.
Julia Chamberlain bemerkte nicht mehr, dass es ihrem Ehemann doch noch gelang, ihren Arm zu berühren. Ihr letzter Gedanke, bevor sie starb, galt dem Baby zu ihren Füßen.
Auch John Chamberlains letzter Gedanke galt den Kindern. Er hoffte, dass sie noch schliefen. Er wollte nicht, dass ihre letzten Augenblicke von Angst erfüllt waren. Vor allem aber sollten sie nicht merken, dass er sie im Stich gelassen hatte.
Wasser Felsen wirbelndes weißes Licht
der Wagen
fiel
fast wiefi…
Oben auf dem Highway waren zwei verschmierte Reifenspuren im Schlamm, die in die so gut wie unberührte Wand aus Büschen und Bäumen führten, der einzige Beweis, dass die Chamberlains jemals dort gewesen waren. Bis zum Morgengrauen passierte kein anderes Auto die Straße. Da hatte der heftige Regen, der entgegen John Chamberlains Vorhersage im Restaurant doch vor Anbruch des Tages nachgelassen hatte, die Spuren bereits fortgespült. Es war ein Zaubertrick. Nach nur fünf Tagen in diesem Land hatte sich die Familie Chamberlain in Luft aufgelöst.
Es war der 4. April.
TEIL I
1
4. April 1978
Katherine wurde aus dem Schlaf gerissen, hinein in Dunkelheit und Chaos. Sie wurde hin und her geschleudert, durchgerüttelt und herumgeworfen, wusste nicht, wo hinten oder vorn war, oben oder unten, rechts oder links. Im Inneren dieser sich entfaltenden Explosion konnte sie nicht sagen, wo sie selbst endete und wo die Welt begann. In diesem unverorteten Durcheinander hatten bevor es losging und nachdem es vorbei war keinerlei Bedeutung, es existierte nichts als Lärm und Schmerz. Wie lange es andauerte, konnte sie nicht sagen.
Bis dann …
Ihr erster zittriger Atemzug. Und noch einer. Kaum bei Bewusstsein schwebte sie durch tiefe Dunkelheit. Was war das für ein Geräusch? Wind? Wasser? Ja, das könnte es sein – Wasser. Wasser, das aus den Wasserhähnen in die lange, weiße Wölbung der Badewanne im oberen Badezimmer zu Hause in der Hornton Street lief. Allerdings viel lauter als das, als würde sie ihr Ohr direkt an den Wasserhahn halten – oder vielleicht waren es viele Badewannen, die sich alle auf einmal füllten? Auch konnte sie durch das Rauschen dieses Vielleicht-Wassers ein metallisches Knarzen und Ächzen hören, wie ein Zug, der langsam in einen Bahnhof einfuhr. Sie musste auf dem Heimweg von der samstäglichen Einkaufstour mit Mutter in der U-Bahn eingeschlafen sein. Ein Zugunglück, dachte sie ohne jede Emotion. Ich bin in der U-Bahn, deswegen ist es so dunkel, und der Zug ist entgleist. Oder vielleicht hatte jemand eine Bombe gezündet. Sie hatte einmal zufällig mit angehört, wie sich ihre Eltern über Bombenanschläge in der Stadt unterhielten. Menschen waren ums Leben gekommen. Das waren die Iren, die jagen alles in die Luft, auch wenn sie nicht wusste, warum. Mutter hatte besorgt geklungen. Vater hatte gesagt, sie sollten so etwas nicht vor den Kindern besprechen.
»Katherine.«
Jemand rief von weit weg ihren Namen.
»Katherine. Wach auf.«
Sie öffnete die Augen. Schloss sie gleich wieder. Versuchte es erneut. Ihre Augen fühlten sich an wie Puppenaugen, die sich nur öffneten, wenn man ihren Kopf anhob. Von irgendwoher kam ein wenig Licht, milchig und kalt. Etwas drückte gegen ihre Brust. Es tat weh, wenn sie atmete, scharfe Stiche, die sie als rote Blitze sehen konnte, obwohl ihre Augen geschlossen waren. Auch ihr Hals tat weh, als sie den Kopf drehte. Alles war in verwischte Schatten gehüllt, und ihr Blick glitt von den Formen ab, die sich um sie herumdrängten. Sie wusste nur, dass sie sich in einem engen Raum befand.
Plötzlich wurde ihr schwindelig, und sie merkte, wie sich ihr Magen hob. Ihr Mund öffnete sich wie von selbst, und sie spürte, wie Erbrochenes warm an ihr herunterlief, atmete den säuerlichen Geruch ein. Sie schämte sich, stellte sich vor, was Vater wohl dazu sagen würde.
»Katherine.«
Sie stieß mit der Hand in die Richtung von Maurices Stimme.
»Nicht! Das tut weh.«
Sie fühlte etwas Weiches.
»Lass das!«
Jetzt konnte sie das Gesicht ihres Bruders erkennen, auch wenn sein Körper sich noch immer in der Dunkelheit verlor. Er war nicht weit entfernt, so wie sie gedacht hatte, sondern ganz nahe bei ihr. Und Tommy auch. Er befand sich direkt unter ihr und blinzelte sie an.
»Wir hatten einen Unfall«, sagte Maurice schluchzend.
»Was?«
»Wir hatten einen Unfall«, wiederholte er lauter. »Mein Bein tut weh. Irgendwas stimmt da nicht.«
»Was ist passiert?«
»Ein Autounfall.«
»Das Auto? Was ist denn mit dem Auto?«
»Du hörst gar nicht richtig zu! Wach endlich auf.«
Trotz der Umstände wurde Katherine wütend. Warum musste Maurice so mit ihr reden? Musste immer so überlegen tun? Außerdem war er es schließlich, der viel zu leise sprach. Durch das ständige Rauschen um sie herum konnte sie ihn kaum verstehen.
»Wir sind mit dem Auto verunglückt«, sagte sie langsam und begriff erst, als sie es aussprach, was sie da sagte.
»Ja, als wir geschlafen haben. Da ist Wasser. Du musst mir helfen. Mein Bein ist eingeklemmt.«
Jetzt verstand sie. Sie hatten einen Unfall gehabt, mitten in der Nacht. Und jetzt steckten sie alle auf dem Rücksitz fest.
»Mum«, sagte sie. Und dann etwas lauter: »Dad.«
Sie versuchte, sich aufzurichten, um zwischen den Vordersitzen mit ihren hohen Kopfstützen hindurchzusehen, aber bei jeder Bewegung flammte stechender Schmerz in ihrer Brust auf. Stöhnend sank sie zurück. Sie konnte gerade mal einen kleinen Teil der Windschutzscheibe ausmachen. Sie war an tausend Stellen zersprungen, ein weißes, rissiges Netz. Licht sickerte von draußen durchs Glas.
»Dad!«
»Hör auf zu schreien«, zischte Maurice wütend. »Er wird nicht aufwachen. Du musst mir helfen.«
»Ich kann nichts sehen.«
Es roch nach Kacke und dem Gestank ihres eigenen Erbrochenen, und sie schmeckte Blut.
»Das Wasser ist kalt.« Maurice gab einen erstickten Laut von sich, der sie erschreckte.
Wovon sprach er? Wie konnte da Wasser sein? Sie waren im Inneren des Autos. Ihr fiel ein, dass es während der Fahrt sehr stark geregnet hatte. Wollte er sagen, dass Regen ins Auto kam?
»Hör auf, die Augen zuzumachen. Du musst endlich richtig aufwachen. Sieh mich an. Sieh hier nach unten.«
Nach unten? Ja, jetzt verstand sie. Maurice saß gar nicht neben ihr. Er und Tommy waren da unten. Sie war hier oben. In der Dunkelheit tastete sie mit den Händen über ihren Körper. Da war ihr Sicherheitsgurt, sie war immer noch angeschnallt. Er hielt sie in Position, verhinderte, dass sie fiel. Das musste bedeuten … das Auto … lag … auf der Seite.
»Dad!«
»Hör auf!«
Maurice bewegte sich, dann schrie er auf.
»Was ist denn los?«
Er wimmerte.
»Maurice? Mo?«
»Mein Bein ist eingeklemmt. Wir müssen raus hier. Das Wasser ist eiskalt, und ich glaube, es steigt immer weiter an.«
Sie starrte in die Schatten, die alles außer dem Kopf und den Schultern ihres Bruders verborgen hielten, und sie verwandelten sich in Wasser. Es floss durch den Innenraum des Autos. Katherine sah das immer noch halb mit Milch gefüllte Fläschchen des Babys darin hin und her dümpeln. Sie erkannte ein durchnässtes Kissen, eine durchweichte Decke, ein aufgeschwemmtes Exemplar von Fünf Freunde im Zeltlager, das sie sich von der Familie geliehen hatte, die sie in der ersten Nacht in Wellington getroffen hatten. Ein Fluss. Das also war das Geräusch, das sie die ganze Zeit gehört hatte. Das Auto war in einen Fluss gestürzt.
Katherine tastete nach der Schnalle ihres Sicherheitsgurtes. Der Verschluss schnappte auf. Sie spürte, wie sie abrutschte, dann hing ihr der Gurt unter dem Kinn. Als sie den Kopf drehte, schrammte er ihr schmerzhaft übers Ohr. Sie rutschte mit den Beinen voran zur Tür des Autos, die jetzt der Boden war. Das eiskalte Wasser packte zu, und sie rang nach Luft. Es reichte ihr bis zu den Knien.
»Geh runter von mir!« Maurice versuchte, sie wegzustoßen.
Tommys Ellbogen und Schulter drückten sich gegen sie, und er stöhnte, das erste Geräusch, das sie von ihm hörte.
»Tommy? Bist du verletzt?«
Er antwortete nicht. Er hatte sich aufgerichtet und war schon fast aus dem Wasser raus.
»Alles wird gut«, sagte Katherine im Tonfall ihrer Mutter. »Maurice, du musst versuchen, dein Bein freizubekommen.«
»Ich schaff’s nicht, das hab ich doch schon gesagt. Es steckt fest.«
Sie griff ins Wasser und tastete mit einer Hand das Bein ihres Bruders ab. Das Wasser reichte ihr bis zur Schulter, als sie seinen Schuh erreichte. Ihre Finger wurden schon ganz taub.
»Nicht!«, schrie er ihr ins Ohr.
»Ich muss es abtasten.«
»Das tut weh.«
Sie ignorierte ihn. Das hier war Maurices Turnschuh. Und da: ein Metallstück des Sitzes – das Schienenstück, das den Sitz vor- und zurückgleiten ließ. Ihre Hände versuchten zu verstehen, auf welche Weise das Bein ihres Bruders festgeklemmt war.
»Ich muss deine Schnürsenkel aufmachen.«
»Sei vorsichtig.«
Es dauerte ziemlich lange. Als sie die Schnürsenkel endlich aufgefriemelt hatte, zog sie am Bein ihres Bruders. Es kam frei. Erneut schrie Maurice auf und schlug ihr mit dem Handrücken ins Gesicht.
»Lass das!«, sagte sie.
Sie zog ihn aus dem Wasser, er fühlte sich kalt und klamm an. Er stand auf einem Bein da, als sich die drei Kinder in dem engen Raum des auf der Seite liegenden Autos zitternd aneinanderpressten.
Jetzt, wo sie aufrecht stand, konnte Katherine ihren Vater sehen. Ein über das Lenkrad gebeugter Schatten, das Gesicht dorthin gerichtet, wo Mutter sitzen sollte, es aber aus irgendeinem Grund nicht mehr tat.
Sie muss sich bereits befreit haben. Sie ist rausgeklettert und holt Hilfe. Natürlich hat sie die kleine Emma mitgenommen.
»Dad«, sagte Katherine.
Sie griff zwischen die Sitze und zupfte am Hemd ihres Vaters. Er bewegte sich nicht.
Kein Problem, so was passiert in Filmen ständig. Wenn jemand einen Schlag auf den Kopf bekommt, ist er bewusstlos, aber nicht lange.
Schon bald würde Vater sich stöhnend aufsetzen und den Kopf schütteln.
Er würde Kopfschmerzen haben und ein Ei an der Stirn, dort, wo er gegen das Lenkrad geprallt war. Die Beule würde wahrscheinlich verbunden werden müssen, aber vorher würde er ihnen allen aus dem kaputten Auto helfen. Dann würde Vater nach Mutter und Emma suchen und anschließend Hilfe holen gehen.
»Lass das«, sagte Maurice. »Wir müssen hier raus. Du musst die Tür aufmachen.«
Katherine hob den Arm, packte den Griff und drückte, so fest sie konnte. Ächzend gab die Tür ein paar Zentimeter nach.
»Hilf mir.«
Sie drückten gemeinsam, und die Tür schwang mit einem metallischen Quietschen auf. Maurice und Katherine hoben beide die Hände über den Kopf, in der Erwartung, sie würde wieder zufallen, doch sie blieb offen stehen. Dichter Regen fiel auf ihre nach oben gerichteten Gesichter.
Katherine zog sich als Erste hoch. Als sie auf der Tür balancierte, fiel ihr auf, dass ihre Brille verschwunden war. Nicht dass sie ihr in der Dunkelheit und dem Regen eine große Hilfe gewesen wäre, aber sie trug sie schon, seit sie eingeschult worden war.
So viel immerhin konnte sie erkennen: Ein Scheinwerfer ragte gerade so aus dem Wasser, er leuchtete noch. Es war das einzige Licht. Unter ihr drängte eine weißköpfige Welle gegen das Dach und hielt das Auto gegen einen großen Felsbrocken gedrückt. Überall um sie herum strudelte und schäumte Wasser zwischen den Felsen hindurch. Im Auto war das Tosen des rauschenden Wassers laut gewesen, nun war es ohrenbetäubend. Unter das Tosen mischte sich das Grollen von Steinen, die durch das Flussbett getrieben wurden. Sie packte das Metall fester. Wenn sie fiel, würde sie weggespült werden, bevor sie auch nur einen Schrei von sich geben konnte. Sie drehte den Kopf und sah hinter sich. Dort gab es keine Hoffnung, nur Dunkelheit. In der entgegengesetzten Richtung befand sich der Felsen, gegen den das Auto gedrückt wurde. Dahinter konnte sie undeutlich etwas erkennen, das sie für Bäume hielt.
Sie sah auf die nach oben gerichteten Gesichter ihrer Brüder. »Da ist ein großer Felsen. Ich glaube, da können wir draufklettern.«
»Kannst du die Straße sehen?«, fragte Maurice.
»Nein.«
»Sie muss da irgendwo sein.«
Sie streckte ihre Hand aus. »Gib mir die Decke.«
Ausnahmsweise diskutierte Maurice nicht mit ihr. Die Decke war schwer vom Wasser. Sie wrang sie, so gut sie konnte, über dem Rand der Wagentür aus, auch wenn der Regen gleich wieder in die Wolle eindrang.
Tommy beim Hochklettern zu helfen, war schwierig. Er schien nicht zu verstehen, was sie von ihm wollte. Als er endlich draußen war, setzte er sich neben sie auf die Tür und starrte ausdruckslos vor sich hin.
Maurice erwies sich als noch schwieriger. Er atmete stoßweise und gab jedes Mal, wenn er sein verletztes Bein bewegte, saugende Geräusche von sich. Zweimal schrie er auf und fiel wieder nach unten. Als auch er endlich oben war, deutete sie in die Dunkelheit.
»Da. Siehst du?«
»Was?«
»Wir können über die Felsen dort gehen. Na los.«
Vom Auto auf den Felsbrocken zu gelangen, erwies sich als so leicht, wie aus einer U-Bahn auf den Bahnsteig zu steigen. Maurice hatte seinen Arm um Katherines Schultern gelegt und ließ ihn dort. Tommy folgte ihnen wie ein Welpe, den sie aus einem Sack befreit hatten. Die Kinder bewegten sich in kleinen, vorsichtigen Schritten über die Felsen im Fluss, bis sie schließlich das Ufer erreichten. Heftig zitternd starrten sie zurück in die Scheinwerfer des Autos. Die Kleidung klebte an ihren Körpern, und der Regen klatschte ihnen die Haare fest an den Kopf. Sie ließen die Arme hängen, und Wasser rann von ihren Fingerspitzen auf den steinigen Boden.
»Vater wird bald aufwachen«, sagte Katherine ruhig. »Er wird nachkommen. Und Mutter auch«, fügte sie hinzu und fühlte sich schuldig, sie auch nur für ein paar Sekunden außer Acht gelassen zu haben. Maurice sagte nichts. Er blinzelte das Wasser aus den Wimpern.
Katherine wusste, dass Scheinwerfer mit einer Batterie betrieben werden. Wenn man die Tür aus Versehen einen Spalt offen stehen ließ, wie es ihre Mutter einmal getan hatte, blieb das kleine Innenlicht an, und das reichte aus, um die Batterie zu entladen. Vater hatte sie zu Beginn der Reise davor gewarnt. Es war also naheliegend, dass die Batterie irgendwann leerlaufen und sie in kompletter Dunkelheit zurücklassen würde. Sie sah hinter sich: Nichts als peitschender Regen und drohend aufragende Bäume.
»Wir müssen aus dem Regen raus«, sagte sie.
Maurice antwortete nicht. Er hatte sich auf den Boden sinken lassen, das Kinn auf die Brust gelegt.
»Maurice.«
Er sah zu ihr auf. »Was?«
»Wir müssen irgendwo hin, wo wir vor dem Regen geschützt sind. Sonst sterben wir noch.«
2
14. November 2010
Suzanne stand mit ihren beiden Enkelsöhnen in der Tür ihres Londoner Hauses und sah zu, wie das Auto ihres Sohnes vorfuhr. Hinter den Dächern der Reihenhäuser auf der anderen Straßenseite erhob sich die Kuppel des Imperial War Museum. Tim war das Auto holen gegangen, die Jungs hatten hier bei ihr gewartet. Jetzt war er gezwungen, in zweiter Reihe zu halten. Die Warnblinkanlage leuchtete orange in der Abenddämmerung. Im Haus begann das Telefon zu klingeln.
Da kann sich der Anrufbeantworter drum kümmern, dachte sie.
Jeden zweiten Sonntag kam Tim aus Brighton mit den Jungs zu Besuch. Sie freute sich auf ihre gemeinsamen Nachmittage. Manchmal gingen sie die Straße runter ins italienische Restaurant oder auch zum Griechen, den sie weniger mochte, aber den ihr Sohn bevorzugte. Wenn sie Lust dazu hatte, was ungefähr jedes zweite Mal der Fall war, kochte Suzanne selbst, meistens einen Lammbraten. Gelegentlich kam auch die Mutter der Jungs, Astrid, mit, aber meistens waren es nur Tim und die Enkel. Suzanne nahm Astrids Abwesenheit nicht persönlich. Ihre Schwiegertochter arbeitete viel, und ein Tag ganz für sich allein war ihr zweifellos hochwillkommen.
Heute war es ziemlich regnerisch, und sie waren zu Hause geblieben. Nach dem Mittagessen hatte sie die Jungs von ihren iPads losgeeist, und sie hatten zu viert Cluedo gespielt.
»Auf Wiedersehen, Nana«, sagte George. »Danke, dass wir hier sein durften.«
Der gute George, immer so förmlich. »Aber gern, mein Lieber. Es war mir eine Freude.«
»Wiedersehen«, sagte Danny und umarmte sie flüchtig.
Sie sah zu, wie sie geschickt den überfluteten Rinnstein nahmen. Danny setzte sich auf den Beifahrersitz und war sofort in sein Handy vertieft. George erklomm den Rücksitz. Er drehte sich in der noch offenen Tür nach ihr um und lächelte, die Zähne hoben sich weiß von seiner dunklen Haut ab.
Tim ließ die Seitenscheibe herunter und lehnte sich über Danny. »Tschüss, Mum«, rief er. »Bis in zwei Wochen. Ich ruf dich an.«
Als das Auto anfuhr, hörte sie den kurzen hohen Ton des Anrufbeantworters, gefolgt von einer leisen Frauenstimme, die eine Nachricht hinterließ.
Trotz des Regens trat sie auf den Gehweg hinaus, um ihnen hinterherzuwinken. Es war ein Abschiedsritual, das sie mit den Jungs schon seit Kleinkindertagen praktizierte, auch wenn inzwischen nur noch George mitmachte. Er drehte sich in seinem Sitz zu ihr um und winkte wie wild. Suzanne winkte noch stürmischer zurück. Daraufhin verdoppelte George seine Anstrengungen, bis seine Hand nur noch ein verschwommener Klecks war. Das Auto entfernte sich, und es fiel ihr zunehmend schwer, ihn auszumachen. Am Ende der Straße flackerten die Bremslichter auf, dann bog das Auto links ab. Sie waren fort.
Suzanne blieb noch einen Moment lang stehen, erfüllt von der Melancholie, die sie jedes Mal am Ende ihrer Besuche überkam. Tim und Astrid hatten die Jungs, die biologische Brüder waren, aus einem Waisenhaus in Äthiopien geholt und adoptiert. Niemand wusste genau, wie oder wo ihre Eltern gestorben waren. Offenbar gab es keinerlei Aufzeichnungen darüber. Man hatte Tim gesagt, dass keiner der Verwandten es sich leisten könne, die Jungs bei sich aufzunehmen. Damals hatte Suzanne Zweifel – eigentlich, so vermutete sie, Urängste – wegen der Adoption gehabt, auch wenn sie natürlich nichts gesagt hatte. Sicherlich war es nicht zu verhindern gewesen, dass die Kinder durch ihre frühen Erfahrungen traumatisiert worden waren, auch wenn niemand genau sagen zu können schien, worin diese bestanden. Würde die Adoption schwarzer Kinder durch weiße Eltern beim Heranwachsen nicht zu unzähligen Problemen führen? Sowohl für Tim und Astrid als auch für die beiden selbst? Würde dieses ganze Arrangement ihrer aller Leben nicht hoffnungslos verkomplizieren?
Sie hatte die Jungs zum ersten Mal getroffen, sobald sie in Gatwick aus dem Flugzeug stiegen. Danny war keine zwei Jahre alt und konnte kaum laufen. George war noch ein Baby. Sie waren so viel schwärzer, als sie gedacht hatte. Es klang schrecklich, das war ihr bewusst, aber ihre Hautfarbe hatte sie noch lange Zeit aus der Bahn geworfen. Jedes Mal, wenn sie sie sah, war sie aufs Neue überrascht. Sie ertappte sich dabei, die Haut der Jungs bei jeder Gelegenheit zu berühren oder ihnen heimlich mit den Händen über Arme und Beine zu streichen, wenn sie dösten oder bei ihr saßen und sie ihnen Geschichten über väterliche Kaninchen und pflichtbewusste Züge vorlas. Sie zeichnete die weichen Falten ihrer Bäuche nach, ihre Wangen und kaum verborgenen Knochen. Ihre Füße faszinierten sie am meisten. Sie nahm sie oft zwischen die Hände, fuhr zärtlich mit dem Daumen über die Linie auf ihren Zehenspitzen, dort, wo die rosafarbene Haut ihrer Fußsohlen endete, als könnte sie die exakte Stelle ertasten, die Schwelle, an der das Schwarz begann.
Jetzt, zwölf Jahre später, hatten sich die Jungs bestens eingelebt. Sie waren alles andere als die verstörten Geiseln eines früheren Lebens. Keine ihrer Befürchtungen hatte sich bewahrheitet. Manchmal allerdings, meist in ungewöhnlichen Situationen, erwischte ihre Hautfarbe sie immer noch auf dem falschen Fuß. Erst kürzlich war es wieder passiert, bei Tim zu Hause, als Danny tropfend, mit nichts als einem Handtuch um seine schmalen Hüften, aus dem Bad in den Flur trat. Oder an dem Tag, als sie bei Georges Jahresabschlusspräsentation an der Schule dabei gewesen war. Nervös hatte er in seinem weißen Uniformhemd mit dem Rücken zur Tafel vor der Klasse gestanden, in der Hand sein Vulkan-Diorama. Und letzten Sommer im Freibad, als Danny mit den Füßen auf dem Rand des hohen Sprungbretts über dem Wasser balancierte. Von unten betrachtet hatte ihr Enkel ausgesehen wie ein wunderschönes schwarzes Loch, das jemand in das blaue Metall des Himmels geschnitten hatte.
Wieder im Haus, verriegelte sie die Tür und ging in die Küche. Tim achtete darauf, sie mehrmals in der Woche anzurufen, aber meistens hörte sie bis zu ihrem nächsten Besuch nichts mehr von den Jungs. Eine Großmutter aus den Augen war eine Großmutter aus dem Sinn. Sie schaltete den Wasserkocher ein, nahm ihre Lieblingstasse aus dem Küchenschrank über ihrem Kopf und drückte die rot blinkende Taste des Anrufbeantworters.
»Hallo. Ich bin nicht sicher, ob das die richtige Nummer ist, aber ich versuche, jemanden zu erreichen: Suzanne Barnett. Ihr Geburtsname ist Suzanne Taylor. Sie war die Schwester von Julia Elizabeth Chamberlain. Mein Name ist Victoria Hall, ich bin Attachée der New Zealand High Commission hier in London. Es tut mir leid, Sie an einem Wochenende zu stören, aber es handelt sich um eine dringende Angelegenheit, und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich zurückrufen könnten.« Die Stimme trug langsam und deutlich eine Nummer vor.
Die Tasse schlug gegen die Kante des Küchentresens, zerbrach, fiel auf die Fliesen und zersprang in viele noch kleinere Stücke. Suzanne machte keine Anstalten, die Überreste aufzusammeln, sondern blieb kerzengerade und still zwischen den Scherben stehen. Hin und wieder streckte sie den Arm aus, um sich die Nachricht noch einmal anzuhören. Sie hätte nicht sagen können, wie oft sie sie abspielte. Oft genug, um auch noch die letzte darin enthaltene Information herauszufiltern.
Victoria Hall sprach so, wie es an teuren Schulen ausgebildete Neuseeländer taten. Es war auch möglich, dass die Frau eine Zeit lang in England gelebt und es sich hier angeeignet hatte. Nur der gelegentliche flache Vokal – die erste Silbe in Zealand, die für einen kurzen Moment oben in ihrer Nase widerhallte – ließ ihre Herkunft aus Neuseeland oder Australien erkennen. Darüber hinaus konnte man schwerlich mehr sagen, als dass Victoria Hall jung, kompetent und tüchtig klang.
Suzanne rief nicht sofort zurück. Stattdessen verbrachte sie die nächsten beiden Stunden damit, das Haus aufzuräumen. Die Scherben der zerbrochenen Tasse schepperten vom Kehrblech in den Abfalleimer. Sie legte das Cluedo-Spiel zurück in die Schachtel und verstaute sie auf dem Bücherregal. Sie lief so lange auf der Suche nach Dingen, die in Ordnung gebracht werden mussten, durch die Zimmer, bis es draußen dunkel war. Statt Licht zu machen, verließ sie sich auf den matten Schein der Straßenlaternen, der durch die Fenster drang.
Aber irgendwann gab es nichts mehr zu tun. Wieder in der Küche, wählte sie die Nummer aus dem Gedächtnis. Nach dem fünften Klingeln meldete sich eine Männerstimme.
»Hallo, hier ist Jeff.«
»Könnte ich bitte Victoria Hall sprechen? Sie hat mir eine Nachricht hinterlassen.«
»Moment, ich hole sie.«
Im Hintergrund war eine Mädchenstimme zu hören.
Der Mann sagte: »Nein, es ist für Vic.«
Während sie wartete, starrte Suzanne durch das Glas in der Tür in die Nacht hinaus, wo der Kirschbaum fast formlos in den Schatten verschwand.
»Hallo, hier spricht Victoria.«
»Hallo. Mein Name ist Suzanne Taylor. Sie haben mir eine Nachricht hinterlassen.«
»Oh, ja, danke, dass Sie zurückrufen. Ich weiß nicht, ob ich bei Ihnen richtig bin, aber ich versuche, wie erwähnt, die Schwester von Julia Chamberlain ausfindig zu machen. Sind Sie das vielleicht?«
Suzanne wollte sagen: Nein, es tut mir leid. Ich habe noch nie von einer Julia gehört. Wie war noch mal der Nachname? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie Sie diese Frau erreichen können. Sie würde sich verabschieden und auflegen und anschließend so lange auf der blinkenden Taste des Anrufbeantworters herumdrücken, bis nichts mehr von ihm übrig wäre. Und damit hätte es sich dann.
»Ja, ich bin Julias Schwester.«
»Oh, gut. Da bin ich aber erleichtert. Die Kontaktdaten, die wir von Ihnen haben, sind nicht mehr aktuell.«
»Seit meiner Scheidung benutze ich wieder meinen Mädchennamen. Und ich bin ein paarmal umgezogen. Worum geht es denn, bitte?«
»Es tut mir leid, ich will nicht unhöflich sein, aber es handelt sich um eine ziemlich heikle Angelegenheit. Ich muss sicher sein, dass ich die richtige Person erreicht habe. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen?«
»Nur zu.«
Es fiel ihr nicht schwer, zu beweisen, wer sie war. Es war ein seltsames Gefühl, die Namen ihrer Neffen und Nichten zu nennen. Ihr wurde klar, dass sie im Laufe der Jahre zwar oft an sie gedacht, ihre Namen aber schon eine Ewigkeit nicht mehr ausgesprochen hatte.
»Können Sie mir jetzt sagen, worum es hier eigentlich geht?«
»Es sind schlechte Neuigkeiten, fürchte ich. Vor etwa einer Woche hat in Neuseeland ein Doktorand, der in der West-Coast-Region eine Vogelkolonie erforscht, menschliche Überreste gefunden. Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber sie wurden als die sterblichen Überreste Ihres Neffen Maurice Chamberlain identifiziert.«
»Wie?«
»Entschuldigung? Was meinen Sie?«
»Wie wurden sie identifiziert?«
»Zahnärztliche Unterlagen. Die Polizei hatte sie in der Akte zu dem Vermisstenfall. Es besteht nicht der geringste Zweifel, dass es sich um Ihren Neffen handelt. Offenbar wurde auch eine gravierte Uhr seines Vaters bei ihm gefunden. Auf der Rückseite steht der Name John Chamberlain … Sind Sie noch dran?«
»Ja.«
»Es tut mir sehr leid, dass Sie auf diese Weise davon erfahren.«
»Nein, schon gut. Es ist ein Schock. Ich meine, nach zweiunddreißig Jahren.«
»Ja, natürlich. Das glaube ich.«
»Ich hatte aufgegeben.«
»Verständlicherweise.«
»Gab es noch weitere Knochen? Von anderen, meine ich?«
»Nein. Die Polizei hat die ganze Gegend abgesucht. Da war nichts weiter.«
Viel mehr konnte Victoria Hall ihr nicht sagen, außer dass die Überreste am Fuße einer Klippe nahe der Tasmanseeküste gefunden worden waren.
William hatte recht. »Also ist ihr Auto doch ins Meer gestürzt.«
»Die Polizei glaubt das eigentlich nicht. Laut dem Senior Sergeant, mit dem ich gesprochen habe, gibt es dort in der Nähe keinerlei Straßen. Er meinte, Ihr Neffe sei höchstwahrscheinlich oben auf den Klippen entlanggegangen und abgestürzt.«
»Wollte er Hilfe holen?«
»Ich weiß es nicht, tut mir leid.«
»Nein, natürlich nicht. Ich denke bloß laut.«
»Der Bericht des Coroners wird Ihnen mehr verraten, aber das kann noch eine ganze Weile dauern.«
»Wo liegt die Fundstelle denn?«
»Lassen Sie mich nachsehen.« Papierrascheln. »Ich weiß, es ist sehr abgelegen … Hier haben wir sie. Die Stelle befindet sich ungefähr zehn Kilometer südlich der nächstgelegenen Siedlung. Sie heißt Bruce Bay.«
»Ich kenne Bruce Bay.«
»Wirklich?« Sie klang zweifelnd, als müsste Suzanne sich irren.
»Ich war im Laufe der Jahre oft an dieser Küste. Dann habe ich in der Lodge in Bruce Bay übernachtet.«
»Verstehe. Dann kennen Sie sich wohl besser aus als ich. Ich habe noch nie davon gehört.«
»Wer hat ihn gefunden?«
»Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich kann es herausfinden, wenn Sie möchten. Er hat die Möwenkolonie erforscht.«
Suzanne lauschte Victoria Halls Ausführungen darüber, wie es nun weitergehen würde. Der Fall müsse von einem neuseeländischen Coroner untersucht werden. Irgendwann gebe es dann einen Bericht – nein, sie könne nicht genau sagen, wie lange das dauern werde –, und natürlich würde Suzanne als Allererste eine Kopie erhalten.
***
Suzanne saß an ihrem Schreibtisch im Wohnzimmer und öffnete einen Ordner auf dem Desktop. Sie hatte alle Dokumente und Fotos einscannen lassen. Nicht dass in der Familie Chamberlain besonders viele Fotos gemacht worden wären. Es gab gerade mal ein paar Dutzend. Abgesehen von ein paar schönen Schnappschüssen von Maurice und Katherine stammten die meisten der Kinderfotos aus ihren Schulen.
Da war Maurice. Es war sein letztes Schulfoto an der St. Michaels, aufgenommen Ende 1977, ein paar Monate bevor die Familie nach Neuseeland aufgebrochen war, und wirkte inzwischen ziemlich veraltet. Er war der dritte Junge von rechts in der mittleren Reihe, und er sah bierernst aus. Suzanne versuchte, sich an Maurice in einem anderen Zusammenhang zu erinnern, beim Weihnachtsessen oder dem gemeinsamen Familienurlaub in Essex. Es war alles schon so lange her. Das Beste, was sie zustande brachte, waren Erinnerungen an Erinnerungen, Ereignisse, die sie bereits so oft im Geiste rekapituliert hatte, dass es unmöglich war, ihnen irgendetwas Neues abzuringen.
Der nächste Ordner, den sie öffnete, enthielt Scans von Zeitungsberichten. Eine Zeit lang hatte das Verschwinden der Chamberlains große Wellen geschlagen. Nur recht kurz in den britischen Zeitungen, aber sehr viel länger in Neuseeland. In fast allen Artikeln wurde dasselbe Familienfoto abgedruckt, eins, das sie nie gemocht hatte. Man hatte sie in irgendeinem Studio sehr förmlich in Szene gesetzt. Alle hatten einen glänzenden, starren Gesichtsausdruck, als ob sie bei Madame Tussauds ausgestellt wären. Es war drei Jahre vor ihrem Verschwinden aufgenommen. Die Kinder waren zu jung: Maurice war elf, Katherine neun, Tommy gerade mal vier. Emma war noch nicht mal auf der Welt.
Erst kurz vor Mitternacht schaltete sie den Computer schließlich aus. Sie war zu schnell aufgestanden, und ihr war schwindelig. Sie hielt sich am Schreibtisch fest. Als sie die Augen schloss, sah sie wieder den ernsten Jungen aus der mittleren Reihe vor sich. Er war nicht mehr zwischen seinen Klassenkameraden eingepfercht, sondern stand auf dem Gipfel einer hohen Klippe, im Rücken Bäume. Vor ihrem geistigen Auge sah sie die weiche Kante unter seinen Füßen nachgeben; er fiel plötzlich und ungebremst, wirbelte mit wild rudernden Armen durch die nebelige Luft.
Sie öffnete die Augen, bevor er auf den Felsen aufschlug. Armer Maurice, was ist bloß mit dir passiert? Ohne Licht zu machen, ging sie nach oben ins Bett.
3
4. April 1978
Dicht aneinandergedrängt kauerten Maurice und Tommy unter einer nassen Decke am Fuße eines Baumes, nur wenige Meter vom Fluss entfernt. Das Scheinwerferlicht des Autos war so gut wie erloschen. Das Wasser dröhnte wie ein vorbeidonnernder Zug.
Katherine erschien in der Dunkelheit. »Kommt mit.«
Maurice sah langsam auf. Während seine Schwester weg gewesen war – wie lange, konnte er nicht sagen –, war er tief in sich selbst versunken. Der Regen und die Kälte und sogar der Schmerz in seinem Knöchel, der sich wie etwas Lebendiges durch sein Bein gegraben hatte, waren in angenehme Ferne gerückt.
»Was willst du?«
»Steh auf. Na los.«
»Lass mich in Ruhe.«
Typisch für Katherine, so einen Aufstand zu machen. Hier unter diesem Baum war gar kein so schlechter Ort, um die Nacht zu verbringen. Es war gut, eigentlich sogar besser als gut. Die Wurzel, die sich in seine Seite gebohrt hatte, war weg. Tommy hatte mit seinen nervtötenden Geräuschen aufgehört. Maurice war nicht einmal mehr kalt. Genau genommen war die Luft sogar ziemlich warm. Vater hätte es einen lauen Abend genannt. Er schloss die Augen.
»Steh auf, Mo!«
Ruckartig hob Maurice das Kinn von der Brust. Warum schrie Katherine ihn an? Jetzt zerrte sie auch noch an ihm herum. Sie besaß sogar die Frechheit, ihm die Decke wegzureißen. Er wälzte sich auf die Seite und rollte sich zu einer Kugel zusammen. Sollte sie die Decke doch haben. Es spielte keine Rolle. Hauptsache, sie verschwand und ließ ihn in Ruhe schlafen.
»Na los, Mo. Es muss sein. Ich habe was Trocknes gefunden.«
»Fass mich nicht an. Es geht mir gut hier.«
»Nein, du musst mitkommen.«
So wie seine Schwester an seinem Arm herumzerrte, hatte er keine andere Wahl, als sich widerwillig aufzurappeln.
»Hier, benutz das«, sagte Katherine.
»Was ist das?«
»Es wird dir beim Gehen helfen.«
Er nahm das Ding, das sie ihm hinhielt, wie er etwas annehmen würde, das man ihm im Traum gab. Es war ein abgebrochener Ast mit einer y-förmigen Gabel an dem einen Ende. Er sah ihn verständnislos an.
»Pass auf, so.« Sie half ihm, die Gabel unter den Arm zu klemmen.
Er probierte den Ast aus und stellte fest, dass er sein Gewicht zu halten vermochte. Katherine half Tommy auf die Beine. Stolpernd und taumelnd folgte Maurice seiner Schwester über den felsigen Untergrund, in ihren Rücken das schwache Licht. Jedes Mal, wenn er hinfiel, hätte er sich am liebsten an Ort und Stelle zusammengerollt und wäre eingeschlafen. Aber Katherine zog ihn immer wieder auf die Beine. Sie hörte nicht auf, ihn herumzustoßen und an ihm zu zerren. Mehr als einmal kniff sie ihn sogar. Wäre Vater hier, er hätte es ihr bestimmt nicht durchgehen lassen. Maurice würde ihm später alles ganz genau erzählen.
»Wir sind da. Hier ist es.«