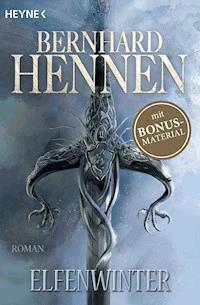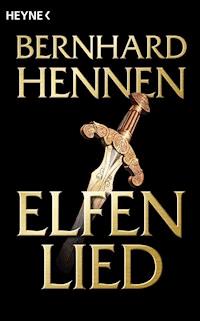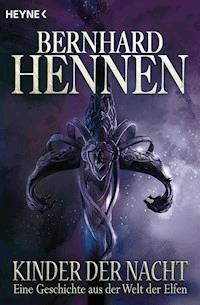
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Drachenelfe Nandalee ist auf der Flucht vor den mächtigen Himmelsschlangen. Denn seit sie eine von ihnen getötet hat, ist ihr Leben verwirkt. Doch nicht nur sie selbst, auch ihre Kinder Meliander und Emerelle schweben in höchster Gefahr. Als die Feinde immer näher kommen und sie alle in eine ausweglose Situation geraten, trifft Nandalee eine folgenschwere Entscheidung. Eine Entscheidung, die das Schicksal ihrer Tochter Emerelle für immer verändern wird.
Emerelle, die sagenumwobene Königin aus Bernhard Hennens Elfen-Saga, verkörpert wie keine zweite Figur in der Fantastik das Wesen der Elfen: Schön, mächtig und edel, riskiert sie alles, um ihr Reich vor dem Untergang zu retten. Doch wie wurde Emerelle zu der, die sie heute ist?
In seiner Kurzgeschichte Kinder der Nacht erzählt Bernhard Hennen ein atemberaubendes Abenteuer voller Magie und dunkler Geheimnisse – Emerelles allererstes Abenteuer …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 58
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Die Drachenelfe Nandalee ist auf der Flucht vor den mächtigen Himmelsschlangen. Denn seit sie eine von ihnen getötet hat, ist ihr Leben verwirkt. Doch nicht nur sie selbst schwebt in höchster Gefahr, sondern auch ihre Kinder Meliander und Emerelle. Als ihre Feinde immer näher kommen und Nandalee und die Geschwister in eine ausweglose Situation geraten, trifft Nandalee eine folgenschwere Entscheidung. Eine Entscheidung, die das Schicksal ihrer Tochter Emerelle für immer verändern wird.
Emerelle, die sagenumwobene Königin aus Bernhard Hennens Elfen-Saga, verkörpert wie keine zweite Figur in der Fantastik das Wesen der Elfen: Schön, mächtig und edel, riskiert sie alles, um ihr Reich vor dem Untergang zu retten. Doch wie wurde Emerelle zu der, die sie heute ist?
In seiner Kurzgeschichte Kinder der Nacht erzählt Bernhard Hennen ein atemberaubendes Abenteuer voller Magie und dunkler Geheimnisse – Emerelles allererstes Abenteuer …
Der Autor
Bernhard Hennen, 1966 geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Vorderasiatische Altertumskunde. Als Journalist bereiste er den Orient und Mittelamerika, bevor er sich ganz dem Schreiben fantastischer Romane widmete. Mit seinen Elfen- und Drachenelfen-Romanen stürmte er alle Bestsellerlisten und schrieb sich an die Spitze der deutschen Fantasy-Autoren. Bernhard Hennen lebt mit seiner Familie in Krefeld.
Mehr über den Autor und seine Elfen-Romane erfahren Sie auf: www.Bernhard-Hennen.de
Bernhard Hennen
KINDER
DER
NACHT
Eine Geschichte aus der Welt der Elfen
Wilhelm Heyne VerlagMünchen
Originalausgabe 09/2014
Redaktion: Martina Vogl
Copyright © 2014 by Bernhard Hennen
Copyright © 2014 dieser Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Isabelle Hirtz, Inkcraft, Augsburg
Umschlagillustration: Melanie Miklitza, Inkcraft, Wedel
Karten: Andreas Hancock
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-15236-9
www.heyne-fantastisch.de
@HeyneFantasySF
twitter.com/HeyneFantasySF
Sie hatte Angst. Emerelle blickte zum dunklen Wald, der bis fast ans Ufer des eisbedeckten Fjords reichte. Wie lang war ihre Mutter schon fort? Eine Stunde? Zwei? Fahl, wie der Rauch eines fast erstorbenen Feuers, griff die Dunkelheit über die Bergkämme am fernen Horizont. Die Nacht war nah. Eine Nacht, in der Mond und Sterne klar am Himmel stehen würden, um die Winterlandschaft in eisiges Licht zu kleiden.
»Alles wird gut«, flüsterte ihr Bruder Meliander so leise, als habe er Sorge, etwas im Wald könne sie hören. Er drückte ihre Hand. Trotz der Kälte waren seine Finger verschwitzt.
»Mir ist so kalt«, hauchte sie in sein Ohr. Der Atem stand ihnen beiden in dichten, weißen Wolken vor dem Mund. Ufer und Wald waren tief verschneit. Die Spur ihrer Mutter, die sich zwischen den dunklen Bäumen verlor, war weit und breit die einzige Fährte im Schnee. Nirgends sonst war die Schneefläche durchbrochen. Es gab keine Spuren von Hasen oder die eines Fuchses, der am Ufer entlanggeschnürt wäre. Keine Vogelkrallen, die sich wie zarte Hieroglyphen im Weiß abmalten. Nichts! Auch war kein einziger Tierlaut zu hören. Nur das Knarren der Äste unter der Last des Schnees und ab und an das dumpfe Plumpsen, wenn eine Schneewechte von weit aufgefächertem Tannengrün glitt.
Meliander hob ihre rot gefrorenen Hände an seine Lippen und hauchte seinen Atem darauf. Es half nur wenig gegen die Kälte, aber Emerelle fühlte sich weniger verloren.
»Sie wird bald wieder zurück sein. Wir sind hier in Sicherheit. Und bis sie wieder hier ist, passe ich auf dich auf.« Er sagte das so feierlich, als lege er einen Eid ab. »Ich bin fast so gefährlich wie ein Drachenelf.«
Emerelle schluckte. Sie wusste nur zu gut um seine Gabe. »Du darfst nicht …«
»Schhh, Schhh.« Sanft legte er ihr die Finger auf die Lippen. »Sag nichts! Wir werden ein bisschen frieren und uns langweilen. Und das war es. Mutter wird bald zurück sein.«
Emerelle hätte ihm zu gerne geglaubt. Ihre Mutter hatte sie schon oft allein gelassen, um auf die Jagd zu gehen. Aber dieser Ort hier war anders. Emerelle blickte zu dem schroffen Berg, der sich auf der anderen Seite des Fjords erhob. Undeutlich sah sie im ersterbenden Licht die stehenden Steine, die sich wie eine Krone auf dem schneebedeckten Felshaupt erhoben. Etwas mit der Luft schien hier anders zu sein. Sie wirkte trüber. Ja, Emerelle hatte sogar das Gefühl, dass sie anders schmeckte, wenn sie tief einatmete. Auch die Bäume wirkten irgendwie falsch. Entlang des Ufers standen bleiche Birken, rotstämmige Kiefern und knorrige Eichen. Auf den ersten Blick wirkten sie so wie die Bäume, die sie kannte. Aber wenn sie sie länger betrachtete, wurden sie, ihr fremd. Es fehlte ihnen an Anmut.
Emerelle musste lächeln. Es war dumm, dieses Wort auf Bäume anzuwenden, das wusste sie, und doch entsprach es dem, was sie empfand. Die Bäume hier schienen wilder zu wuchern als an all den anderen Orten, an denen sie bisher gewesen waren. Sie sehnte sich zurück nach dem Jadegarten. Nach der Wärme und den Blumen dort. Nach dem Gefühl, an dem Ort zu sein, an den sie gehörten. Sie waren in der Festung der Drachenelfen geboren worden. Emerelle kämpfte gegen den Kloß in ihrem Hals an. Sie verstand nicht, warum Mutter sie fortgebracht hatte, warum diese Reise kein Ende nahm. Immerzu waren sie irgendwo in der Wildnis. Mutter traute niemandem. Manchmal hatte sie das Gefühl, dass Nandalee nicht einmal ihnen beiden vertraute. Manchmal, wenn sie glaubte, dass sie beide schliefen, sah ihre Mutter sie auf eine Art an …
Emerelle rieb sich mit den Händen über die Arme und vermochte doch die Kälte nicht zu vertreiben, die sich tief in ihr Innerstes gefressen hatte. Warum sah Mutter sie so an? Was hatten sie getan? Lag es an Melianders Gabe?
Emerelle kauerte sich in den Windschatten des weißen Felsens, der sich nahe dem Ufer erhob. Ein einzelner, großer Stein, dessen Farbe ihn von allen anderen Felsbrocken unterschied, die aus dem Schnee ragten. Er sah aus, als gehöre er nicht hierher – so wie sie.
Die Nacht kam schnell an diesem sonderbaren Ort. Schon hatten die Schatten des Waldes das Ufer erreicht. Tief zwischen den Bäumen erklang der dunkle Ruf eines Uhus. Er trug weit durch den tief verschneiten Wald. Sieben, acht Mal erklang der Ruf. Alle zehn Herzschläge. Dann verstummte er. Es gab also doch etwas Lebendiges an diesem Ort, dachte Emerelle erleichtert. Es war ein ganz normaler Wald! Sie blinzelte schläfrig und wünschte sich, Mutter hätte ein Feuer gemacht, an dem sie sich nun in einer warmen Decke einrollen könnte. Der Kopf sank ihr auf die Brust. Sie schloss die Augen, als Meliander neben ihr plötzlich aufkeuchte:
»Der Himmel! Sieh nur!«
Aufgeregt deutete er auf die Steilklippe am anderen Ufer. Hoch über dem Felsen war ein seltsames, grünes Licht erschienen. Emerelle hatte so etwas nie zuvor gesehen. Wie ein Vorhang aus Licht, der in weiten Falten über den Himmel zog, sah es aus. Dort, wo bei einem Vorhang der Saum gewesen wäre, strahlte das Licht intensiver. Deutlich sah sie die Sterne dahinter am Himmel. Es war, als habe sich ein bemaltes Glas vor die Welt geschoben. Emerelle hatte Ähnliches schon einige Male erlebt. Sie sah Dinge, die niemand anderes sah.
Aber Meliander hatte sie darauf aufmerksam gemacht. Dieses Licht war wirklich!