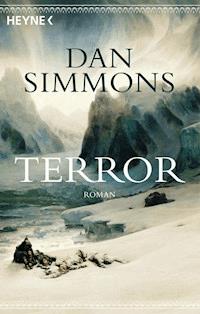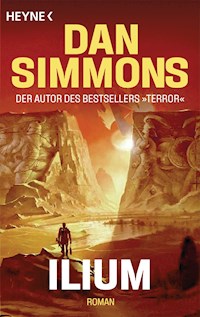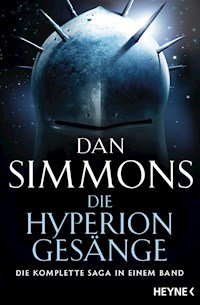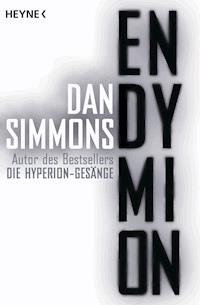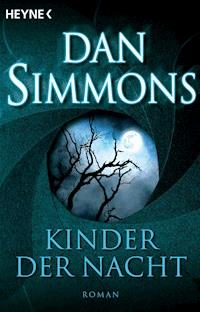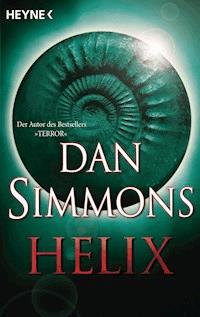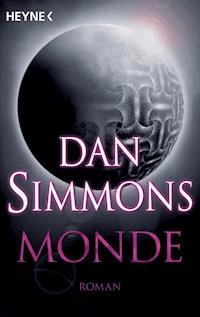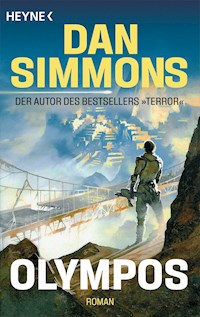
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Thomas Hockenberry, einst Professor für Philosophie an der University of Indiana, wird nach seinem Tod von den Göttern des Olymp auserwählt, um als Kriegsberichterstatter in Ilium tätig zu werden. Raffinierte High-Tech-Geräte erlauben es ihm, mitten im Kampfgetümmel zu erscheinen und in Sekundenbruchteilen wieder zu verschwinden. Doch Hockenberry kennt die »Ilias« zu genau, um nicht zu merken, dass sich zwischen dem, was er sieht, und den Versen Homers beträchtliche Diskrepanzen auftun. Schnell stellt er fest, dass er nicht auf dem griechischen Olymp wiedererweckt wurde, sondern auf dem Olympus Mons, dem höchsten Berg des Mars. Und es hat ihn nicht in die Antike, sondern in eine ferne Zukunft verschlagen. Als durch seine Intervention der Krieg eine völlig neue Wendung nimmt, geraten die Ereignisse zunehmend außer Kontrolle …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1523
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
DAS BUCH
Thomas Hockenberry, einst Professor für Philosophie an der University of Indiana, wird nach seinem Tod von den Göttern des Olymp auserwählt, um im Auftrag der Muse Kalliope als Kriegsberichterstatter in Ilium tätig zu werden. Als sogenannter Scholiker mit raffinierten High-Tech-Geräten ausgestattet, die es ihm erlauben, mitten im Kampfgetümmel zu erscheinen und in Sekundenbruchteilen wieder zu verschwinden, soll er der Muse Zeugnis geben von den Wechselfällen des Trojanischen Krieges. Doch Hockenberry kennt die »Ilias« zu genau, um nicht zu merken, dass sich zwischen dem, was er sieht, und den Versen Homers beträchtliche Diskrepanzen auftun. Hat sich der berühmte griechische Epiker in sträflicher Weise dichterische Freiheiten erlaubt, oder befindet er, Hockenberry, sich etwa im falschen Krieg? Doch die Wahrheit ist weitaus erschreckender: Hockenberry wurde nicht auf dem griechischen Olymp wiedererweckt, sondern auf dem Olympus Mons, dem höchsten Berg des Mars. Und es hat ihn nicht in die Antike, sondern in eine ferne Zukunft verschlagen.Was ist damit bezweckt? Wer steckt dahinter? Als durch seine Intervention der Krieg eine völlig neue Wendung nimmt, geraten die Ereignisse zunehmend außer Kontrolle …
Mit »Olympos« und dem Vorgängerband »Illium« legt Dan Simmons eines der größten Zukunftsepen des beginnenden 21. Jahrhunderts vor.
DER AUTOR
Dan Simmons wurde 1948 in Illinois geboren. Er schrieb bereits als Kind Erzählungen, die er seinen Mitschülern vorlas. Nach einigen Jahren als Englischlehrer machte er sich 1987 als freier Schriftsteller selbständig. Sein zuletzt erschienener Roman »Terror« über die legendäre Polarexpedition John Franklins stand monatelang auf den Bestsellerlisten. Simmons lebt mit seiner Familie in Colorado, am Rande der Rocky Mountains.
Inhaltsverzeichnis
Dieser Roman ist für Harold Bloom,der mir mit seiner Verweigerungshaltunggegenüber diesem Zeitalterdes Hasses große Freude bereitet hat.
MICYLLUS Ehe du weitergehst, sage mir doch, ging denn alles wirklich so vor Troja zu, wie’s Homer erzählt?
DER HAHN Woher hätte er’s wissen sollen, da er damals ein Kamel in Baktria war?
– LUKIAN, Der Hahn oder Der Traum des Micyllus
»Letzten Endes ist die Geschichte der Erde zweifellos die Geschichte eines wahrhaft gnadenlosen Krieges. Weder seine Mitmenschen noch seine Götter oder seine Leidenschaften lassen den Menschen jemals in Ruhe.«
– JOSEPH CONRAD, Notes on Life and Letters
»Ins große Leichenbuch der Erde Schreibt Ilions Lied nicht mehr; Der Freien Jubel nimmer werde Von Lajus Zorne schwer; Wenn eine neue Sphinx auch droht Mit tiefern Rätselsprüchen Tod.
Noch einmal soll Athen erstehen Und allerfernste Zeiten, Wie Abendrot die Bergeshöhn Mit seinem Glanz umkleiden; Und kann so Schönes nicht mehr leben, So bleibt, was Menschen fordern, Götter geben.«
– PERCY BYSSHE SHELLEY, Hellas
1. TEIL
1
Helena von Troja erwacht kurz vor Tagesanbruch vom Geheul der Luftschutzsirenen. Sie tastet über die Kissen ihres Bettes, aber ihr gegenwärtiger Liebhaber, Hockenberry, ist fort – er ist wieder in die Nacht hinausgeschlüpft, bevor ihre Dienerinnen erwachen, so wie immer nach ihren Liebesnächten, als hätte er etwas Schimpfliches getan. Zweifellos schleicht er sich jetzt gerade durch die am wenigsten vom Licht der Fackeln erhellten Gassen und Seitenstraßen nach Hause. Helena findet, dass Hockenberry ein seltsamer, trauriger Mann ist. Dann kommt die Erinnerung zurück.
Mein Gemahl ist tot.
Paris’ Tod im Zweikampf mit dem gnadenlosen Apollo ist seit neun Tagen Realität – die große Bestattungszeremonie, an der sowohl die Trojaner als auch die Achäer teilnehmen werden, beginnt in drei Stunden, sofern der Streitwagen der Götter, der jetzt über der Stadt ist, Ilium in den nächsten paar Minuten nicht vollständig zerstört – aber Helena kann immer noch nicht glauben, dass ihr Paris von ihr gegangen ist. Paris, der Sohn des Priamos, soll auf dem Schlachtfeld besiegt worden sein? Paris soll tot sein, in die dunklen Höhlen des Hades geworfen, bar der Schönheit seines Körpers und der Anmut seiner Bewegungen? Unvorstellbar. Er ist doch Paris, ihr schöner Knabe, der sie Menelaos geraubt habt, vorbei an den Wachen und auf und davon über Lakedämoniens grünen Rasen. Er ist Paris, ihr aufmerksamster Liebhaber selbst nach dieser langen Dekade des ermüdenden Krieges, Paris, den sie oft insgeheim als ihr »satt gefressenes, dahineilendes Pferd« bezeichnet hat.
Helena schlüpft aus dem Bett und geht zum Außenbalkon hinüber. Sie teilt die hauchdünnen Vorhänge und tritt in Iliums anbrechendes Morgengrauen hinaus. Es ist tiefer Winter, und der Marmor unter ihren bloßen Füßen ist kalt. Der Himmel ist immer noch so dunkel, dass sie vierzig oder fünfzig Scheinwerfer sehen kann, die auf der Suche nach dem Gott oder der Göttin und dem fliegenden Streitwagen in die Höhe stechen. Wellen gedämpfter Plasma-Explosionen laufen über das halbkuppelförmige Energiefeld des Moravecs, das die Stadt schützt. Mit einem Mal bohren sich viele kohärente Lichtstrahlen – massive lapislazuliblaue, smaragdgrüne und blutrote Schäfte – aus den Verteidigungsstellungen um Ilium herum in den Himmel. Vor Helenas Augen erschüttert eine einzige gewaltige Explosion den nördlichen Quadranten der Stadt. Ihre Schockwelle hallt über Iliums dachlosen Türmen wider und weht Helena die langen, dunklen Locken von den Schultern. In den letzten Wochen haben die Götter in zunehmendem Maße versucht, das Kraftfeld mit massiven Bomben zu durchdringen; die aus einem einzigen Molekül bestehenden Bombenmäntel bewegen sich per Quantenphasenverschiebung durch den Schutzschirm der Moravecs. So haben es ihr Hockenberry und Mahnmut, das lustige kleine Geschöpf aus Metall, jedenfalls erklärt.
Helena von Troja interessiert sich nicht die Bohne für Maschinen.
Paris ist tot. Der Gedanke ist einfach unerträglich. Helena war bereit, zusammen mit Paris an jenem Tag zu sterben, an dem die Achäer unter Führung ihres früheren Gatten, Menelaos, und seines Bruders Agamemnon endlich eine Bresche in die Mauer schlagen, jeden Mann und jeden Knaben in der Stadt töten, die Frauen schänden und als Sklavinnen auf die griechischen Inseln verschleppen würden, wie es ihre Freundin Kassandra prophezeit hat. Auf diesen Tag war Helena vorbereitet – darauf, entweder von eigener Hand oder von Menelaos’ Schwert den Tod zu erleiden –, aber irgendwie hat sie nie so recht geglaubt, dass ihr geliebter, eitler, gottgleicher Paris, ihr dahineilendes Pferd, ihr schöner Krieger-Gemahl, noch vor ihr sterben könnte. Im Verlauf der mehr als neun Jahre währenden Belagerung und des glorreichen Kampfes hat Helena stets darauf vertraut, dass die Götter ihren geliebten Paris am Leben, unversehrt und in ihrem Bett lassen würden. Und das haben sie auch getan. Doch nun haben sie ihn umgebracht.
Sie denkt an den Moment zurück, als sie ihren trojanischen Gemahl zuletzt gesehen hat, vor zehn Tagen. Da verließ er soeben die Stadt, auf dem Weg zu einem Zweikampf mit dem Gott Apollo. Paris hat nie zuversichtlicher ausgesehen, in strahlendes Erz gehüllt, mit stolzem, aufrechtem Haupt, dem langen Haar, das ihm um die Schultern wehte wie die Mähne eines Hengstes, und blitzenden weißen Zähnen, während Helena und Tausende andere ihm von den Mauern über dem skäischen Tor aus jubelnd nachblickten. Seine hurtigen Füße trugen ihn fort, »dem Jugendglanze vertrauend«, wie König Priamos’ Lieblingsdichter zu singen beliebte. Doch an diesem Tag trugen sie ihn zu seinem Tod von den Händen des wütenden Apoll.
Und nun ist er tot, und wenn die im Flüsterton weitergegebenen Gerüchte stimmen, die Helena zu Ohren gekommen sind, ist sein Körper ein verbranntes, verwüstetes Ding; seine Knochen sind gebrochen, sein vollkommenes, goldenes Gesicht ist zu einem obszön grinsenden Totenschädel verbrannt, die blauen Augen sind zu Talg geschmolzen, Fetzen gerösteter Haut ziehen sich von seinen versengten Wangenknochen nach hinten wie … wie bei den schwelenden Kadavern der Opfertiere, die zu Ehren der Götter auf den Altären verbrannt werden. Helena fröstelt im kalten Wind, der mit der Morgendämmerung aufgekommen ist, und sieht Rauch über den Dächern Trojas aufsteigen.
Aus dem Achäerlager im Süden schießen drei Luftabwehrraketen fauchend himmelwärts und setzen sich auf die Spur des flüchtenden Götter-Streitwagens – ein kurzes Aufblitzen, hell wie der Morgenstern, verfolgt von den Kondensstreifen der griechischen Raketen. Dann verschwindet der glänzende Punkt abrupt per Quantenverschiebung, und der Morgenhimmel ist wieder leer. Flieht nur zurück zum belagerten Olympus, ihr Feiglinge, denkt Helena von Troja.
Die Entwarnungssirenen beginnen zu heulen. Auf der Straße unter Helenas Gemächern in Paris’ Anwesen ganz in der Nähe von Priamos’ zerbombtem Palast wimmelt es auf einmal von Menschen, die mit Wassereimern Richtung Nordwesten laufen, wo noch immer Rauch in die Winterluft emporsteigt. Moravec-Flugmaschinen brummen über die Dächer hinweg; ihre widerhakenbewehrten Fahrwerke und hin und her schwenkenden Projektoren verleihen ihnen verblüffende Ähnlichkeit mit chitinösen schwarzen Hornissen. Wie Helena aus Erfahrung und von Hockenberrys nächtlichen Tiraden weiß, werden einige von ihnen für die Luftsicherung sorgen, wie er es nennt, während andere beim Feuerlöschen helfen. Anschließend werden Trojaner und Moravecs stundenlang verstümmelte Körper aus den Trümmern bergen. Da Helena so gut wie alle Einwohner der Stadt kennt, fragt sie sich benommen, wer von ihnen so früh an diesem Morgen in den Hades hinabgeschickt worden ist.
Am Morgen von Paris’ Bestattung. Der Bestattung meines Geliebten. Meines törichten, betrogenen Geliebten.
Helena hört, wie sich ihre Dienerinnen zu regen beginnen. Die älteste von ihnen – Aithra, die Mutter des königlichen Theseus und einstige Königin von Athen, bis sie von Helenas Brüdern zur Vergeltung für die Entführung ihrer Schwester verschleppt worden ist – steht in der Tür von Helenas Schlafgemach.
»Soll ich den Mädchen Anweisung geben, das Badewasser einzulassen, Herrin?«, fragt Aithra.
Helena nickt. Sie schaut noch einen Moment lang zu, wie der Himmel heller wird – der Rauch im Nordwesten wird erst dicker und dann schwächer, als die Feuerwehr und die fliegenden Löschmaschinen der Moravecs die Brände unter Kontrolle bringen; die Kampfhornissen der Steinvecs jagen weiter gen Osten, setzen ohne jede Aussicht auf Erfolg dem Streitwagen nach, der sich schon per Quantenteleportation in Sicherheit gebracht hat –, dann dreht sich Helena von Troja um und tappt mit ihren bloßen Füßen leise über den kalten Marmor. Sie muss sich auf Paris’ Bestattungszeremonie vorbereiten, aber auch auf ihr erstes Wiedersehen seit zehn Jahren mit ihrem gehörnten Gatten, Menelaos. Außerdem werden Hektor, Achilles, Menelaos, Helena und viele andere Achäer und Trojaner zum ersten Mal gemeinsam an einem öffentlichen Ereignis teilnehmen. Alles Mögliche könnte passieren.
Nur die Götter wissen, was dieser schreckliche Tag bringen wird, denkt Helena. Und dann muss sie trotz ihrer Trauer lächeln. In diesen Tagen werden Gebete an die Götter gewiss nicht mehr erhört. In diesen Tagen haben die Götter nichts mehr für die Sterblichen übrig – jedenfalls nichts außer Tod, Verderben und schrecklicher Zerstörung, die sie mit ihren göttlichen Händen zur Erde tragen.
Helena von Troja geht ins Haus, um zu baden und sich für die Bestattungszeremonie anzukleiden.
2
Angetan mit seiner besten Rüstung, stand der rothaarige Menelaos reglos, königlich und stolz zwischen Odysseus und Diomedes in der ersten Reihe der achäischen Delegation von Helden, die sich zum Bestattungsritual innerhalb der Mauern Iliums versammelt hatten, um seinen frauenraubenden Feind zu ehren, den Sohn des Priamos, diesen scheißefressenden Schweinehund Paris. Während er schweigend und aufrecht dort stand, sann Menelaos unablässig darüber nach, wie und wann er Helena töten würde.
Eigentlich sollte ihm das keine größeren Schwierigkeiten bereiten. Sie war keine fünfzehn Meter entfernt, gleich jenseits der breiten Gasse, gegenüber der achäischen Delegation auf dem riesigen Marktplatz von Troja, oben auf der königlichen Ehrentribüne bei dem alten Priamos. Mit etwas Glück würde er so schnell dort sein, dass niemand ihn aufhalten konnte. Und wenn er Pech hatte und die Trojaner es doch noch schafften, sich zwischen ihn und seine Gemahlin zu stellen, würde er sie wie Unkraut niedermähen.
Menelaos war kein hoch gewachsener Mann, weder ein edler Riese wie sein abwesender Bruder, Agamemnon, noch ein unedler Riese wie dieser Ameisenpimmel Achilles. Er wusste, dass es ihm niemals gelingen würde, auf den Tribünenrand zu springen, sondern dass er sich mit Ellbogen, Schultern und Schwert einen Weg durch die dicht gedrängten Trojaner auf der Treppe bahnen musste. Aber das störte ihn nicht weiter.
Helena konnte ihm nicht entkommen. Von der Zuschauertribüne an der Mauer des Zeustempels führte nur diese eine Treppe zum Marktplatz herab. Sie konnte in den Zeustempel fliehen, aber er würde ihr dorthin folgen und sie stellen. Menelaos wusste, er würde sie töten, bevor er von Dutzenden empörter Trojaner übermannt wurde – unter ihnen auch Hektor, der den gerade in Sicht kommenden Trauerzug anführte –, und dann würden die Achäer und Trojaner wieder gegeneinander kämpfen und ihren aberwitzigen Krieg gegen die Götter aufgeben. Natürlich wäre Menelaos’ Leben zweifellos verwirkt, wenn der trojanische Krieg hier und heute von neuem entbrannte – ebenso wie das von Odysseus und Diomedes, ja, vielleicht sogar das Leben des unverwundbaren Achilles –, denn an der Bestattung dieses Schweins nahmen nur dreißig Achäer teil, während sich überall auf dem Platz, auf den Mauern und erst recht zwischen den Achäern und dem skäischen Tor hinter ihnen Tausende von Trojanern drängten.
Das ist es wert.
Dieser Gedanke schoss Menelaos wie eine Lanzenspitze durch den Kopf. Das ist es wert – kein Preis wäre zu hoch, um diese treulose Hündin zu töten. Trotz des Wetters – es war ein kühler, grauer Wintertag – lief ihm der Schweiß in Strömen unter dem Helm herab, rann durch seinen kurzen, roten Bart, tropfte ihm vom Kinn und klatschte auf seinen bronzenen Brustharnisch. Dieses Klatschen von Tropfen auf Metall hatte er natürlich schon oft gehört, aber es war immer das Blut seiner Feinde gewesen, das auf ihre Rüstung troff. Menelaos’ rechte Hand, die leicht an seinem mit Silber verzierten Schwert lag, schloss sich mit ingrimmiger Wildheit um das Heft.
Jetzt?
Nicht jetzt.
Wieso nicht? Wenn nicht jetzt, wann dann?
Nicht jetzt.
Die beiden widerstreitenden Stimmen in seinem schmerzenden Schädel – beides seine eigenen Stimmen, denn die Götter sprachen ja nicht mehr mit ihm – machten Menelaos verrückt.
Warte, bis Hektor den Scheiterhaufen anzündet. Dann handle.
Menelaos blinzelte sich den Schweiß aus den Augen. Er wusste nicht, welche Stimme das war – diejenige, die ihn zum Handeln drängte, oder die feige, die ihn zur Zurückhaltung mahnte –, aber er war mit dem Vorschlag einverstanden. Der Trauerzug hatte das riesige skäische Tor passiert und brachte Paris’ verbrannten Leichnam – der nun unter einem seidenen Leichentuch verborgen lag – auf der Hauptstraße zum Marktplatz von Troja, wo zahllose Würdenträger und Helden warteten, während die Frauen – darunter Helena – von der erhöhten Mauertribüne aus zuschauten. Nur noch ein paar Minuten, dann würde der ältere Bruder des Toten, Hektor, den Scheiterhaufen entzünden, und aller Augen würden auf die Flammen gerichtet sein, die den bereits verbrannten Körper verzehrten. Genau der richtige Moment, um zu handeln – niemand wird mich bemerken, bis meine Klinge fünfundzwanzig Zentimeter tief in Helenas verräterischer Brust steckt.
Traditionell dauerten die Bestattungsfeierlichkeiten für Verblichene königlichen Geblüts wie Paris, Sohn des Priamos, einen der Prinzen von Troja, neun Tage, die großenteils von Spielen zu Ehren des Toten eingenommen wurden – darunter Wagenrennen und sportliche Wettkämpfe, an deren Ende meist ein Speerwerfen stand. Doch Menelaos wusste, dass die rituellen neun Tage, seit Apollo Paris in Holzkohle verwandelt hatte, für die lange Reise der Karren und Holzfäller zu den verbliebenen Wäldern im Ida-Gebirge, viele Kilometer entfernt im Südosten, draufgegangen waren. Man hatte die kleinen Maschinenwesen namens Moravecs gebeten, die Holzfäller mit ihren Hornissen und magischen Geräten zu begleiten und sie mit ihrem Kraftfeld vor einem etwaigen Angriff der Götter zu schützen – der natürlich erfolgt war. Aber die Holzfäller hatten ihre Arbeit getan.
Erst jetzt, am zehnten Tag, war das gesammelte Holz in Troja eingetroffen, wo es nun für den Scheiterhaufen bereitlag. Menelaos und viele seiner Freunde, darunter auch Diomedes, der jetzt im achäischen Kontingent neben ihm stand, hielten die Verbrennung von Paris’ stinkendem Kadaver auf einem Scheiterhaufen allerdings für reine Verschwendung von gutem Brennholz; sowohl in Troja als auch in den sich kilometerweit hinziehenden achäischen Lagern an der Küste gab es nämlich schon seit vielen Monaten kein Holz für Lagerfeuer mehr, weil die verkrüppelten Bäume und die Wälder in der Umgebung von Ilium nach zehn Jahren Krieg so gut wie abgeholzt waren. Auf dem Schlachtfeld wimmelte es von Baumstümpfen. Selbst die Zweige waren schon längst eingesammelt worden. Mittlerweile bereiteten die achäischen Sklaven das Essen für ihre Herren über Dungfeuern zu, was weder den Geschmack des Fleisches noch die schlechte Stimmung der achäischen Recken verbesserte.
Die Spitze des Leichenzugs bildete ein Korso einzelner trojanischer Streitwagen; die Hufe der Pferde waren mit schwarzem Filz umwickelt und erzeugten kaum ein Geräusch auf den großen Steinen der Hauptstraße und des Marktplatzes. Auf diesen Streitwagen, neben ihren Rosselenkern, standen schweigend einige der größten Helden Iliums, Kämpfer, die mehr als neun Jahre des ursprünglichen Krieges und nun auch noch acht Monate dieses noch schrecklicheren Krieges gegen die Götter überlebt hatten. Als Erster kam Polydoros, ein weiterer Sohn des Priamos, gefolgt von Paris’ anderem Halbbruder, Mestor. Der nächste Streitwagen gehörte dem trojanischen Verbündeten Ipheus, dann kam Laodokos, Antenors Sohn. Ihnen folgten jeweils in ihrem eigenen juwelengeschmückten Streitwagen der alte Antenor selbst, wie immer unten bei den Kämpfern statt oben bei den anderen Ältesten, dann der trojanische Führer Polyphetes und schließlich Sarpedons berühmter Wagenlenker Thrasymelos, der seinen Herrn vertrat, einen der Führer der Lykier, den Patroklos vor mehreren Monaten getötet hatte, als die Trojaner noch gegen die Griechen statt gegen die Götter kämpften. Als Nächster kam der edle Pylartes – natürlich nicht der Trojaner, den der große Ajax kurz vor Beginn des Krieges gegen die Götter getötet hatte, sondern der andere Pylartes, der so oft an der Seite von Elasos und Mulios kämpfte. Auch Perimos, Megas’ Sohn, sowie Epistor und Melanippos beteiligten sich an diesem Korso.
Menelaos erkannte sie alle, diese Männer, diese Helden, diese Feinde. Tausend Mal hatte er ihre verzerrten, blutbesudelten Gesichter unter den Bronzehelmen über die kleine, tödliche Distanz des Lanzenstoßes oder Schwerthiebs hinweg gesehen, die ihn von seinen beiden Zielen trennte – Ilium und Helena.
Sie ist nur fünfzehn Meter entfernt. Und niemand wird mit meinem Angriff rechnen.
Im Anschluss an die kaum hörbaren Streitwagen führten Stallburschen die potenziellen Opfertiere vorbei: zehn Pferde, die fast zu Paris’ besten gehörten, seine Jagdhunde und Scharen fetter Schafe – Letztere ein echtes Opfer, da sowohl Wolle als auch Lammfleisch unter der Belagerung der Götter knapp wurden –, dazu einige alte, schwerfällige Rinder mit krummen Hörnern. Diese Rinder waren keine stolze Opfergabe – wem sollte man schließlich opfern, wo die Götter nun Feinde waren? –, sondern ihr Fett sollte den Scheiterhaufen heller und heißer brennen lassen.
Hinter den Opfertieren kamen Tausende trojanischer Fußsoldaten, die an diesem trüben Wintertag alle ihre auf Hochglanz polierten Rüstungen trugen. Ihre Reihen erstreckten sich durchs skäische Tor bis hinaus auf die Ebene von Ilium. Mitten in dieser Menschenmasse befand sich Paris’ Totenbahre, getragen von zwölf seiner engsten Waffengefährten, Männern, die für Priamos’ zweitältesten Sohn gestorben wären und die selbst jetzt weinten, während sie die schwere Bahre mit dem Toten trugen.
Paris’ Leichnam war mit einem blauen Tuch bedeckt, das seinerseits schon unter abertausend Haarlocken begraben war – Zeichen der Trauer von Paris’ Männern und seinen entfernteren Verwandten, da Hektor und die engeren Angehörigen ihre Locken erst unmittelbar vor der Entzündung des Scheiterhaufens abschneiden würden. Die Trojaner hatten die Achäer nicht gebeten, Trauerlocken beizusteuern, aber wenn sie es getan hätten – und wenn Achilles, Hektors wichtigster Verbündeter in dieser verrückten Zeit, diese Bitte weitergegeben oder, noch schlimmer, in einen Befehl verwandelt hätte, den seine Myrmidonen durchsetzen sollten –, hätte Menelaos persönlich die Revolte angeführt.
Menelaos wünschte, sein Bruder Agamemnon wäre hier. Agamemnon schien immer zu wissen, was zu tun war. Er war der wahre Oberbefehlshaber der Argeier – nicht der Usurpator Achilles, und schon gar nicht der trojanische Mistkerl Hektor, der sich derzeit anmaßte, Argeiern, Achäern, Myrmidonen und Trojanern gleichermaßen Befehle zu erteilen. Nein, Agamemnon war der wirkliche Führer der Griechen, und wenn er heute hier wäre, würde er Menelaos entweder von diesem tollkühnen Angriff auf Helena abhalten oder sich ihm bei dessen Ausführung bis in den Tod hinein anschließen. Doch Agamemnon und fünfhundert seiner loyalen Männer waren vor sieben Wochen mit ihren schwarzen Schiffen nach Sparta und zu den griechischen Inseln heimgefahren – offiziell, um neue Soldaten für diesen Krieg gegen die Götter zu rekrutieren, insgeheim jedoch, um Verbündete für eine Revolte gegen Achilles zu finden – und wurden frühestens in einem Monat zurückerwartet.
Achilles. Da kam dieses verräterische Ungeheuer anmarschiert, nur einen Schritt hinter dem weinenden Hektor, der unmittelbar hinter der Bahre herging und den Kopf seines toten Bruders in den riesigen Händen barg.
Beim Anblick von Hektor und Paris’ Leichnam erhob sich ein großes Wehklagen unter den abertausend Trojanern, die sich auf den Mauern und dem Platz drängten. Frauen auf Dächern und auf der Mauer – Frauen minderen Geblüts, nicht die weiblichen Mitglieder von Priamos’ königlicher Familie oder Helena – stimmten ein durchdringendes Geheul an. Menelaos bekam unwillkürlich eine Gänsehaut an den Unterarmen. Das Geschrei der Klageweiber hatte immer eine solche Wirkung auf ihn.
Mein gebrochener und verdrehter Arm, dachte Menelaos und schürte seinen Zorn wie ein allmählich verlöschendes Feuer.
Achilles – dieser Halbgott, der jetzt an ihm vorbeischritt, als Paris’ Bahre feierlich am Ehrenkontingent der achäischen Truppenführer vorübergetragen wurde –, Achilles also hatte Menelaos vor acht Monaten den Arm gebrochen, am selben Tag, an dem der fußschnelle Männertöter allen Achäern erklärt hatte, Pallas Athene habe seinen Freund Patroklos getötet und den Leichnam auf den Olymp geschafft, um sie zu verhöhnen. Dann hatte Achilles verkündet, der Krieg zwischen Trojanern und Achäern sei vorbei; stattdessen würden sie von nun an gemeinsam den heiligen Berg Olympos belagern.
Agamemnon hatte sich dagegen gewehrt – hatte sich gegen alles gewehrt: gegen Achilles’ Arroganz, dagegen, dass er Agamemnons rechtmäßige Macht als König der Könige aller hier bei Troja versammelten Griechen an sich riss, gegen die Blasphemie eines Angriffs auf die Götter, ganz gleich, wessen Freund Athene ermordet hatte – sofern Achilles überhaupt die Wahrheit sagte –, und dagegen, dass die vielen zehntausend achäischen Kämpfer Achilles’ Befehl unterstellt wurden.
Achilles’ Reaktion an jenem schicksalhaften Tag war kurz und schlicht gewesen: Er werde gegen jeden Mann, jeden Griechen kämpfen, der sich seinem Führungsanspruch und seiner Kriegserklärung widersetze. Er werde zum Zweikampf gegen jeden Einzelnen von ihnen antreten oder sich mit ihnen allen zugleich messen. Sollte derjenige, der als Letzter noch auf den Beinen stand, die Achäer von diesem Morgen an führen.
Agamemnon und Menelaos, die stolzen Söhne des Atreus, hatten Achilles gemeinsam mit Lanze, Schwert und Schild angegriffen, während Hunderte achäischer Truppenführer und Tausende von Soldaten in benommenem Schweigen zusahen.
Menelaos war ein kampferprobter Veteran, obwohl er nicht zur ersten Garnitur der Helden vor Troja zählte, aber sein älterer Bruder galt als ungestümster Kämpfer aller Achäer – zumindest während der Wochen, in denen Achilles in seinem Zelt geschmollt hatte. Seine Lanzenwürfe trafen so gut wie immer ihr Ziel, sein Schwert schnitt selbst durch verstärkte feindliche Schilde wie eine Klinge durch Stoff, und er ließ nicht einmal den edelsten Feinden gegenüber Gnade walten, wenn sie um ihr Leben flehten. Agamemnon war ebenso hoch gewachsen, muskulös und gottgleich wie der blonde Achilles, aber sein Körper trug die Kampfesnarben eines zusätzlichen Jahrzehnts, und an diesem Tag loderte eine dämonische Wut in seinen Augen, während Achilles gelassen abwartete, einen beinahe geistesabwesenden Ausdruck in seinem jungenhaft-männlichen Gesicht.
Achilles hatte beide Brüder entwaffnet wie kleine Kinder. Agamemnons kraftvoll geworfene Lanze prallte von Achilles’ Haut ab, als wäre der Sohn des Peleus und der Göttin Thetis von einem der unsichtbaren Energieschilde der Moravecs umgeben. Agamemnons wild geschwungenes Schwert – ein so heftiger Hieb, hatte Menelaos damals gedacht, dass er einen Steinblock gespalten hätte – zersplitterte an Achilles’ wunderschönem Schild.
Dann hatte Achilles sie alle beide entwaffnet, hatte ihre zusätzlichen Lanzen sowie Menelaos’ Schwert ins Meer geschleudert, sie selbst in den festgestampften Sand geworfen und ihnen so mühelos, wie ein riesiger Adler Stoff von einem hilflosen Kadaver pickte, die Rüstung vom Leib gerissen. Anschließend brach der schnelle Männertöter erst Menelaos’ linken Arm – die angespannt zuschauenden Truppenführer und Soldaten, die sie im Kreis umstanden, schnappten beim Grünholzknacken des Knochens nach Luft – und dann mit einem scheinbar mühelosen Stoß mit der flachen Hand Agamemnons Nase, zertrümmerte dem König der Könige mit einem Tritt die Rippen und setzte dem stöhnenden Agamemnon die Sandale auf die Brust, während Menelaos ächzend neben seinem Bruder lag.
Erst dann hatte Achilles sein Schwert gezogen.
»Ergebt euch und schwört mir eure Treue, dann werde ich euch mit dem Respekt behandeln, der den Atriden gebührt, und euch als gleichrangige Anführer und Verbündete im bevorstehenden Krieg anerkennen«, sagte Achilles. »Doch wenn ihr auch nur eine Sekunde zögert, schicke ich eure Hundeseelen schneller in den Hades, als eure Freunde zwinkern können, und werfe eure Kadaver den wartenden Geiern vor, sodass eure Körper keine letzte Ruhestätte mehr finden.«
Der keuchende, stöhnende Agamemnon hatte beinahe die Galle ausgespien, die in ihm brodelte, aber er hatte sich Achilles ergeben und ihm den Treueschwur geleistet. Gepeinigt von den mörderischen Schmerzen eines übel zugerichteten Beins, seiner ebenfalls gebrochenen Rippen und des gebrochenen Arms, hatte Menelaos es ihm eine Sekunde später gleichgetan.
Insgesamt fünfunddreißig Führer der Achäer hatten an jenem Tag beschlossen, sich Achilles zu widersetzen. Alle waren sie binnen einer Stunde besiegt worden. Die Tapfersten von ihnen wurden enthauptet, als sie es ablehnten, sich zu ergeben, und ihre Leichen wurden den Vögeln, Fischen und Hunden vorgeworfen, genau wie Achilles es angedroht hatte. Die verbliebenen achtundzwanzig ergaben sich und gelobten, ihm zu dienen. Keiner der anderen großen achäischen Helden von Agamemnons Format – nicht Odysseus, nicht Diomedes, nicht Nestor, weder der große noch der kleine Ajax, auch Teukros nicht – hatte den fußschnellen Männertöter damals herausgefordert. Alle hatten an jenem Morgen – nachdem sie mehr darüber erfahren hatten, wie Athene erst Patroklos ermordet und dann Hektors kleinen Sohn, Skamandrios, hingeschlachtet hatte – laut geschworen, den Göttern den Krieg zu erklären.
Jetzt spürte Menelaos den Schmerz in seinem Arm – trotz der intensiven Fürsorge ihres berühmten Heilers, Asklepios, waren die gerichteten Knochen nicht richtig verheilt, und der Arm machte Menelaos an feuchten, kühlen Tagen wie diesem noch immer zu schaffen –, aber er widerstand dem Drang, die schmerzende Stelle zu reiben, während Paris’ Totenbahre und Achilles langsam die Achäerdelegation passierten.
Nun wird die mit einem Leichentuch verhüllte und mit Haarlocken übersäte Totenbahre neben dem Scheiterhaufen abgestellt, direkt unter der Ehrentribüne an der Mauer des Zeustempels. Die in Reih und Glied marschierenden Fußsoldaten im Trauerzug bleiben stehen. Das Klagen und Weinen der Frauen auf den anderen Mauern verebbt. In der plötzlichen Stille hört Menelaos das raue Atmen der Rösser und dann den Urinstrahl eines Pferdes, der auf den Stein prasselt.
Oben neben Priamos hält der alte Seher Helenos, der oberste Prophet und Berater Iliums, mit lauter Stimme eine kurze Grabrede, aber der soeben aufgekommene Wind vom Meer, der wie ein kalter, missbilligender Atemhauch der Götter heranweht, trägt seine Worte fort. Helenos reicht Priamos ein zeremonielles Messer. Obschon beinahe kahl, hat Priamos sich für solche Feierlichkeiten ein paar lange, graue Strähnen über den Ohren bewahrt. Mit der rasiermesserscharfen Klinge trennt er eine Locke dieser grauen Haare ab. Ein Sklave – viele Jahre lang Paris’ persönlicher Sklave – fängt die Locke in einer goldenen Schale auf und geht weiter zu Helena, die das Messer von Priamos entgegennimmt und es für eine lange Sekunde betrachtet, als dächte sie daran, es sich in die Brust zu stoßen – ein jäher Schrecken durchfährt Menelaos, dass sie genau das tun und ihn seiner Rache berauben könnte, die jetzt nur noch Sekunden entfernt ist –, aber dann hebt Helena das Messer und schneidet ein Stück von einer ihrer langen Schläfenlocken ab. Die brünette Locke fällt in die goldene Schale, und der Sklave geht weiter zur verrückten Kassandra, einer von Priamos’ vielen Töchtern.
Obwohl es eine mühevolle und gefährliche Angelegenheit war, das Holz aus dem Ida-Gebirge zu beschaffen, ist es ein würdiger Scheiterhaufen. Da man den Marktplatz nicht mit einem traditionellen königlichen Scheiterhaufen von dreißig Metern Länge pro Seite füllen konnte, wenn dort noch Platz für Menschen sein sollte, misst der Scheiterhaufen nun lediglich zehn Meter pro Seite, ist jedoch höher als sonst; er ragt bis zur Zuschauerplattform an der Mauer empor. Ausladende Holzstufen, selbst schon kleine Plattformen, führen zum höchsten Punkt hinauf. Dicke Bretter aus den Mauern von Paris’ Palast verleihen dem massiven Brennholzhaufen seine rechteckige Grundform und stützen ihn.
Die starken Leichenträger schleppen Paris’ Totenbahre zu der kleinen Plattform oben auf dem Scheiterhaufen hinauf. Hektor wartet unten am Fuß der breiten Treppe.
Nun werden die Tiere schnell und effizient getötet. Binnen Minuten schneiden Männer, die Fachleute sowohl im Schlachten als auch im Darbringen religiöser Opfer sind – und schließlich, denkt Menelaos, wo ist da der Unterschied? –, den Schafen und Rindern die Kehle durch, lassen ihr Blut in weitere zeremonielle Schalen laufen, häuten sie und ziehen ihnen den Speck ab. Paris’ Leichnam wird in Tierfett eingepackt wie verbranntes Fleisch in weiches Brot.
Dann werden die abgehäuteten Kadaver die Stufen hinaufgetragen und um Paris’ verhüllten Leichnam gelegt. Aus dem Zeustempel kommen Frauen – Jungfrauen in vollem zeremoniellem Ornat, mit verschleiertem Gesicht – und bringen Amphoren mit Honig und Öl. Da sie den Scheiterhaufen selbst nicht betreten dürfen, reichen sie die Gefäße Paris’ Leibwächtern, die nun als Bahrenträger fungieren. Diese bringen die Gefäße die Stufen hinauf und stellen sie mit großer Sorgfalt um die Bahre.
Paris’ Lieblingsrösser werden nach vorn geführt, und Hektor schneidet den vier besten der zehn mit dem langen Messer seines Bruders die Kehle durch – so schnell geht er von einem zum anderen, dass selbst diesen intelligenten, temperamentvollen, hervorragend trainierten Kriegstieren keine Zeit mehr für eine Reaktion bleibt.
Achilles wirft die Kadaver der vier stattlichen Hengste mit wilder Entschlossenheit und übermenschlicher Kraft der Reihe nach auf den Scheiterhaufen. Jeder landet ein Stück weiter oben auf der Pyramide aus Bauholz und Baumstämmen.
Paris’ persönlicher Sklave führt sechs der Lieblingshunde seines Herrn auf die freie Fläche beim Scheiterhaufen. Hektor geht von einem Hund zum anderen, tätschelt sie und krault sie hinter den Ohren. Dann hält er einen Moment lang sinnierend inne, als dächte er daran zurück, wie oft sein Bruder diese Hunde mit Brocken vom Tisch gefüttert und sie auf Jagdexpeditionen in die Berge oder die Sümpfe im Landesinneren mitgenommen hat.
Hektor wählt zwei der Hunde aus und befiehlt mit einer Kopfbewegung, die anderen wegzuführen. Er hält die beiden Tiere eine Minute lang liebevoll an der losen Haut im Nacken gepackt, als wollte er ihnen einen Knochen oder einen Leckerbissen anbieten, dann schneidet er jedem von ihnen so brutal den Hals durch, dass die Klinge den Kopf beinahe vom Körper trennt. Anschließend schleudert er die Kadaver der beiden Hunde eigenhändig auf den Scheiterhaufen – weit über die toten Hengste hinweg, sodass sie am Fuß der Bahre landen.
Jetzt gibt es eine Überraschung.
Zehn Trojaner und zehn achäische Lanzenträger in bronzener Rüstung geleiten einen Karren nach vorn. Auf dem Karren ist ein Käfig. In dem Käfig ist ein Gott.
3
Auf der königlichen Ehrentribüne an der Mauer des Zeustempels verfolgte Kassandra die Bestattungszeremonie für Paris mit immer unheilvolleren Vorahnungen. Als der Karren auf den Marktplatz gezogen wurde – von acht ausgewählten trojanischen Lanzenträgern, nicht von Pferden oder Ochsen –, ein Karren, dessen einzige Fracht ein todgeweihter Gott war, schwanden Kassandra beinahe die Sinne.
Helena packte sie am Ellbogen und hielt sie fest. »Was ist?«, flüsterte die Griechin, ihre Freundin, die zusammen mit Paris diese Tragödie ausgelöst und all dieses Leid über Troja gebracht hatte.
»Es ist Wahnsinn«, flüsterte Kassandra und lehnte sich an die Marmorwand, wobei sie Helena im Unklaren darüber ließ, ob sie ihren Wahnsinn, den Wahnsinn, einen Gott zu opfern, den Wahnsinn dieses ganzen, langen Krieges oder den Wahnsinn des Menelaos unten auf dem Platz meinte, einen Wahnsinn, der während der letzten Stunde an Stärke spürbar zugenommen hatte wie ein schreckliches, von Zeus gesandtes Gewitter. Kassandra selbst wusste ebenso wenig, was sie meinte.
Der gefangene Gott, der nicht nur hinter den in den Karren getriebenen Eisenstangen festgehalten wurde, sondern auch in dem durchsichtigen Ei des Moravec-Kraftfelds, dem er seine Gefangenschaft letztlich verdankte, hieß Dionysos – oder Dionysus, Sohn des Zeus und der Semele. Er war der Gott der Erfüllung im Rausch, in der körperlichen Liebe und in der Ekstase. Kassandra, deren persönlicher Gott von Kindesbeinen an der Paris-Töter Apollo gewesen war, hatte dennoch mehr als einmal intime Zwiesprache mit Dionysos gehalten. Er war die einzige Gottheit, die in diesem neuen Krieg bisher im Kampf gefangen genommen worden war – niedergerungen vom gottgleichen Achilles, von der Moravec-Magie an der Quantenteleportation gehindert, vom listenreichen Odysseus zur Kapitulation bewegt, eingeschlossen im geliehenen Moravec-Kraftfeld, das ihn jetzt wie Hitzewellen an einem Sommertag umflimmerte.
Für einen Gott machte Dionysos nicht viel her – er war von kleiner Statur, nur sechs Fuß groß, blass, selbst nach menschlichen Maßstäben pummelig, mit einem dicken Schopf goldbrauner Locken und dem spärlichen Flaum eines Jungen, der sich an seinem ersten Bart versuchte.
Der Karren blieb stehen. Hektor schloss den Käfig auf und langte durch das halb durchlässige Kraftfeld, um Dionysos auf die erste Stufe der Treppe zum Scheiterhaufen zu ziehen. Achilles legte dem kleinen Gott ebenfalls die Hand ins Genick.
»Deizid«, wisperte Kassandra. »Göttermord. Wahnsinn und Deizid.«
Helena, Priamos, Andromache und die anderen auf der Zuschauertribüne ignorierten sie. Aller Augen waren auf den hellhäutigen Gott und die beiden größeren, gebräunten Sterblichen links und rechts von ihm gerichtet.
Im Gegensatz zur dünnen Stimme des Sehers Helenos, die im kalten Wind und dem Gemurmel der Menge untergegangen war, rollten Hektors dröhnende Worte über das überfüllte Stadtzentrum hinweg und hallten von den hohen Türmen und Mauern Iliums wider; höchstwahrscheinlich waren sie noch auf den Gipfeln des Ida-Gebirges etliche Kilometer im Osten deutlich zu vernehmen.
»Paris, geliebter Bruder – wir sind hier, um dir Lebwohl zu sagen, und zwar so, dass du uns selbst dort noch hörst, wo du nun wohnst, tief unten im Haus des Todes.
Wir schicken dir süßen Honig, seltenes Öl, deine Lieblingsrösser und deine treuesten Hunde – und nun opfere ich dir diesen Gott vom Olympos, einen Sohn des Zeus. Möge sein Fett die hungrigen Flammen nähren und deine Seele rascher in den Hades führen.«
Hektor zog sein Schwert. Das Kraftfeld flackerte und erlosch, aber Dionysos blieb an Armen und Beinen in Eisen gelegt. »Darf ich etwas sagen?«, fragte der blasse kleine Gott. Seine Stimme trug nicht so weit wie die von Hektor.
Hektor zögerte.
»Lasst den Gott sprechen!«, rief der Seher Helenos von seinem Platz neben Priamos auf der Tribüne vor der Tempelmauer herab.
»Lasst den Gott sprechen!«, rief der achäische Seher Kalchas von seinem Platz neben Menelaos.
Hektor runzelte die Stirn, nickte jedoch. »Sprich deine letzten Worte, Nebensohn des Zeus. Doch selbst wenn du deinen Vater um Hilfe anflehst, wird dich das nicht retten. Nichts wird dich heute retten. Heute bist du die Ehrengabe für das Leichenfeuer meines Bruders.«
Dionysos lächelte, aber es war ein ängstliches Lächeln – schon für einen Sterblichen, geschweige denn für einen Gott.
»Trojaner und Achäer«, rief der pummelige kleine Gott mit der struppigen, spärlichen Gesichtsbehaarung. »Ihr könnt keinen der unsterblichen Götter töten. Ich bin dem Schoß des Todes entsprungen, ihr Narren. Als Zeus’ Kind und kleiner Gott habe ich mit Dingen gespielt, die der Prophezeiung zufolge die Spielsachen des neuen Weltenherrschers waren – Würfel, Ball, Kreisel, goldene Äpfel, Rassel und Wolle.
Aber die Titanen, die mein Vater bezwungen und in den Tartaros geworfen hatte, die Hölle unter der Hölle, das Albtraum-Reich unter dem Reich der Toten, in dem dein Bruder Paris jetzt schwebt wie ein vergessener Furz, färbten sich das Gesicht mit Kreide, kamen wie die Geister der Toten und fielen mit ihren bloßen weißen Händen über mich her. Sie rissen mich in sieben Stücke und warfen mich in einen Kessel, der an einem Dreifuß über einem viel heißeren Feuer hing als dieser armselige Scheiterhaufen, den ihr heute hier errichtet habt.«
»Bist du fertig?«, fragte Hektor und hob sein Schwert. »Fast«, sagte Dionysos. Seine Stimme klang jetzt froher und fester, und sie hallte kraftvoll von den fernen Mauern wider, die zuvor Hektors Stimme zurückgeworfen hatten.
»Sie kochten mich und brieten mich dann an sieben Spießen über dem Feuer, und der Geruch war so köstlich, dass er meinen Vater, Zeus, zum Festmahl der Titanen hinablockte, weil er auf eine Einladung zu dem Schmaus hoffte. Doch als er meinen Kinderschädel am Spieß sah und meine Kinderhände in der Suppe, erschlug Vater die Titanen mit einem Blitz und warf sie wieder in den Tartaros, wo sie bis zum heutigen Tag in Furcht und Elend leben.«
»Ist das alles?«, fragte Hektor.
»Fast.« Dionysos hob das Gesicht zu König Priamos und den Mitgliedern der königlichen Familie auf der Tribüne vor dem Zeustempel. Die Stimme des kleinen Gottes war jetzt ein Stiergebrüll.
»Andere sagen jedoch, dass meine gekochten Glieder in die Erde gelegt wurden, wo Demeter sie einsammelte – und so kamen die ersten Reben zum Menschen und schenkten euch Wein. Nur eine meiner kindlichen Gliedmaßen überstand das Feuer und die Erde – und Pallas Athene brachte sie Zeus, der mein kradiaios Dionysos Hipta anvertraute, wie man in Asien die Große Mutter Rhea nannte; sie sollte es auf dem Kopf tragen. Vater benutzte diesen Ausdruck, kradiaios Dionysos, als eine Art Wortspiel, wisst ihr, weil kradia in der alten Sprache ›Herz‹ bedeutet, krada dagegen ›Feigenbaum‹, und darum …«
»Genug«, rief Hektor. »Endloses Geplapper wird dein Hundeleben nicht verlängern. Finde mit zehn oder weniger Worten zum Ende, oder ich tu’s für dich.«
»Verspeist mich«, sagte Dionysos.
Hektor schwang sein großes Schwert mit beiden Händen und enthauptete den Gott mit einem Streich.
Der Menge aus Trojanern und Griechen stockte der Atem. Die dicht an dicht stehenden Menschen traten allesamt einen Schritt zurück. Dionysos’ kopfloser Körper stand etliche Sekunden schwankend, aber immer noch aufrecht auf der untersten Plattform, bis er plötzlich niedersank wie eine Marionette, deren Fäden man durchtrennt hatte. Hektor hob den heruntergefallenen Kopf, dessen Mund noch offen stand, an dem dünnen Bart in die Höhe und warf ihn hoch hinauf auf den Scheiterhaufen, sodass er zwischen den Kadavern der Pferde und Hunde landete.
Hektor, der sein Schwert nun mit gestrecktem Arm führte wie eine Axt, hieb weiter auf den Leib ein – er schnitt Dionysos erst die Arme, dann die Beine, dann die Genitalien ab und warf jedes Stück auf einen anderen Bereich des Scheiterhaufens. Er achtete jedoch darauf, sie nicht zu nah an Paris’ Totenbahre zu werfen, weil er und die anderen die Asche später sortieren mussten, um Paris’ teure Gebeine vom wertlosen Knochenmüll der Hunde, Pferde und des Gottes zu trennen. Schließlich schnitt Hektor den Rumpf in Dutzende kleiner, fleischiger Stücke und warf die meisten davon auf den Scheiterhaufen. Einige warf er jedoch auch dem Rudel von Paris’ überlebenden Hunden vor, die von den Männern, die sich seit dem Trauerzug um sie gekümmert hatten, auf dem Platz freigelassen worden waren.
Als die letzten Knochen und Knorpel in Stücke zerhackt wurden, schien aus den jämmerlichen Überresten von Dionysos’ Leichnam eine schwarze Wolke emporzusteigen – wie eine wirbelnde Masse unsichtbarer schwarzer Mücken, wie ein kleiner Zyklon aus schwarzem Rauch –, und zwar so stürmisch, dass selbst Hektor ein paar Sekunden lang in seinem grimmigen Werk innehalten und zurücktreten musste. Die Menge, einschließlich der in Reih und Glied angetretenen trojanischen Fußsoldaten und der achäischen Helden, wich ebenfalls einen weiteren Schritt zurück. Einige der Frauen auf den Mauern schrien auf und bedeckten das Gesicht mit ihren Schleiern und Händen.
Gleich darauf war die Wolke verschwunden. Hektor warf die letzten Stücke teigig-weißen und rosafarbenen Fleisches auf den Scheiterhaufen und stieß den Brustkorb samt Rückgrat mit einem Fußtritt unter die aufgehäuften Holzbündel. Dann legte er mühsam seine blutige Bronze ab und erlaubte seinen Helfern, die beschmutzte Rüstung wegzutragen. Ein Sklave brachte ihm ein Wasserbecken, und der hoch gewachsene Mann wusch sich damit das Blut von Armen, Händen und Stirn und ließ sich von einem anderen Sklaven ein sauberes Handtuch reichen.
Frisch gewaschen, nur mit Chiton und Sandalen bekleidet, hob Hektor die goldene Schale mit den soeben abgeschnittenen Trauerlocken in die Höhe, stieg die breiten Stufen zum Gipfel des Scheiterhaufens hinauf, wo die Totenbahre auf ihrem Katafalk aus harzigem Holz stand, und schüttete die Haare der geliebten Angehörigen, Freunde und Kameraden seines Bruders auf dessen Leichentuch. Ein Läufer – der schnellste bei allen Laufwettkämpfen in Trojas jüngerer Geschichte – kam mit einer großen Fackel durchs skäische Tor herein, lief durch die Menge aus Fußsoldaten und Zuschauern – eine Menge, die sich für ihn teilte – und sprang die breiten Stufen hinauf zum höchsten Punkt des Scheiterhaufens, wo Hektor bereits auf ihn wartete.
Der Läufer reichte Hektor die flackernde Fackel, verneigte sich tief und stieg rücklings die Stufen hinunter, ohne sich wieder aufzurichten.
Menelaos schaut nach oben, als eine dunkle Wolke über die Stadt hinwegzieht.
»Phöbus Apollo verhüllt den Tag«, flüstert Odysseus.
Ein kalter Westwind fährt just in dem Moment über den Platz, als Hektor die Fackel in das Fett und das harzgetränkte Holz unter der Totenbahre wirft. Das Holz qualmt, brennt jedoch nicht.
Menelaos, der im Kampf immer weitaus heißblütiger gewesen ist als sein Bruder Agamemnon und viele andere der stoischsten Schlächter und größten Helden unter den Griechen, spürt, wie sein Herz schneller schlägt, als der Moment zum Handeln naht. Es macht ihm nicht viel aus, dass er vielleicht nur noch wenige Minuten zu leben hat – Hauptsache, diese Hündin Helena fährt vor ihm kreischend in den Hades hinab. Wenn es nach Menelaos, dem Atreussohn, ginge, würde die Frau in die tiefere Hölle des Tartaros geworfen, wo die Titanen, von denen der tote Gott Dionysos gerade gesprochen hat, noch immer vor Qualen schreiend in der tosenden Düsternis umherstolpern.
Hektor macht eine Handbewegung, und Achilles bringt seinem ehemaligen Feind zwei randvolle Kelche und geht dann wieder die Stufen hinunter. Hektor hebt die Kelche.
»Winde des Westens und Nordens«, ruft Hektor mit erhobenen Kelchen, »brausender Zephyr und kaltfingriger Boreas, kommt mit einem starken Windstoß und entfacht den Scheiterhaufen zum Brand, auf dem Paris gebettet liegt, den alle Trojaner und selbst die ehrenden Argeier um ihn herum betrauern! Komm, Boreas, komm, Zephyr, helft uns mit eurem Atem, diesen Scheiterhaufen zu entzünden, und ich verspreche euch schöne Opfer und viele Spenden aus goldenem Becher!«
Auf der Tribüne über ihm flüstert Helena Andromache zu: »Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Unser geliebter Hektor erfleht die Hilfe der Götter, mit denen wir Krieg führen, um die Leiche des Gottes zu verbrennen, den er gerade niedergemetzelt hat.«
Bevor Andromache etwas erwidern kann, lacht Kassandra im Schatten laut auf, was ihr strenge Blicke von Priamos und den alten Männern um ihn herum einträgt.
Kassandra ignoriert die tadelnden Blicke und zischt Helena und Andromache zu: »Wahnsinn, gewiss. Ich habe ja gesagt, das alles ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, was Menelaos gerade plant, Helena – deinen Tod, jetzt gleich, nicht weniger blutig als der Tod des Dionysos.«
»Wovon redest du, Kassandra?«, flüstert Helena in scharfem Ton, aber sie ist sehr bleich geworden.
Kassandra lächelt. »Ich rede von deinem Tod, Frau. Schon in wenigen Minuten – nur noch etwas aufgeschoben, weil ein Scheiterhaufen nicht Feuer fangen will.«
»Menelaos?«
»Dein ehrenwerter Gemahl«, lacht Kassandra. »Dein ehemaliger ehrenwerter Gemahl. Derjenige, der nicht wie verkohlter Kompost auf einem Holzhaufen verwest. Hörst du nicht Menelaos’ stoßwei-ßes Atmen, während er sich bereitmacht, dich niederzustechen? Riechst du nicht seinen Schweiß? Hörst du nicht, wie sein schändliches Herz klopft? Ich schon.«
Andromache wendet sich von der Bestattungszeremonie ab und tritt näher an Kassandra heran, bereit, sie von der Tribüne in den Tempel zu führen, wo man sie nicht mehr sehen und hören kann.
Kassandra lacht erneut und zeigt ihr einen kurzen, aber sehr spitzen Dolch in ihrer Hand. »Wenn du mich anrührst, du Dreckstück, schlitze ich dich genauso auf wie du dieses Sklavenbaby aufgeschlitzt hast, das du als dein Kind bezeichnet hast.«
»Schweig!«, zischt Andromache. Ihre Augen sind auf einmal zorngeweitet.
Priamos und die anderen alten Männer drehen sich wieder zu ihnen um und schauen sie finster an. Halb taub, wie sie es in ihrem vorgerückten Alter sind, haben sie die Worte offenbar nicht verstanden, aber der Ton des zornigen Geflüsters und Gezischels muss für sie unmissverständlich sein.
Helenas Hände zittern. »Du hast mir doch selbst gesagt, Kassandra, dass all die Vorhersagen aus den Jahren deiner Untergangsprophezeiungen falsch waren. Troja steht noch, Monate nach dem Zeitpunkt seiner von dir vorhergesagten Zerstörung. Priamos lebt und ist nicht hier im Tempel des Zeus getötet worden, wie von dir prophezeit. Achilles und Hektor sind ebenfalls noch am Leben, obwohl du jahrelang behauptet hast, sie würden noch vor dem Fall der Stadt sterben. Keine von uns Frauen ist in die Sklaverei verschleppt worden, wie du vorhergesagt hast, weder du in Agamemnons Haus – wo Klytämnestra, wie du uns erzählt hast, diesen großen König ebenso erschlagen würde wie dich und deine kleinen Kinder – noch Andromache nach …«
Kassandra legt den Kopf in einem stummen Schrei in den Nacken. Unter ihnen bietet Hektor den Windgöttern immer noch Opfer und Honigwein dar, wenn sie nur den Scheiterhaufen seines Bruders entzünden. Gäbe es das Theater bereits, würden die Anwesenden dieses Drama fast schon für eine Farce halten.
»Das alles ist fort«, flüstert Kassandra und zieht sich die rasiermesserscharfe Klinge ihres Dolches mehrmals über den Unterarm. Blut rinnt über ihre blasse Haut und tropft auf den Marmor, aber sie schaut kein einziges Mal nach unten. Ihr Blick bleibt auf Andromache und Helena gerichtet. »Die alte Zukunft gibt es nicht mehr, Schwestern. Die Moiren haben uns verlassen. Unsere Welt und ihre Zukunft haben aufgehört zu existieren, und eine andere – ein seltsamer anderer Kosmos – ist ins Dasein getreten. Apollos Fluch des zweiten Gesichts ist jedoch nicht von mir genommen, Schwestern. Menelaos wird jeden Moment hier heraufgerannt kommen und dir sein Schwert in die hübsche Brust stoßen, Helena von Troja.« Die letzten drei Wörter speit sie mit unverhülltem Sarkasmus hervor.
Helena packt Kassandra an den Schultern. Andromache entwindet ihr das Messer. Zusammen drängen die beiden die jüngere Frau zwischen die Säulen und in den kühlen Schatten des Zeustempels zurück. Die hellsichtige junge Frau wird gegen das Marmorgeländer gedrückt, und die beiden älteren Frauen ragen wie Erinnyen über ihr auf.
Andromache hebt die Klinge an Kassandras blasse Kehle. »Wir sind seit Jahren Freundinnen, Kassandra«, zischt Hektors Gemahlin, »aber wenn du noch ein Wort sagst, du verrücktes Weibsbild, schneide ich dir die Kehle durch wie einem zum Ausbluten aufgehängten Schwein.«
Kassandra lächelt.
Helena legt eine Hand auf Andromaches Handgelenk – obwohl schwer zu erkennen ist, ob sie Hektors Gemahlin zurückhalten oder gemeinsam mit ihr das Messer führen will – und die andere auf Kassandras Schulter.
»Kommt Menelaos, um mich zu töten?«, flüstert sie der gepeinigten Seherin ins Ohr.
»Zweimal wird er dir heute zu Leibe rücken, und beide Male wird sein Vorhaben vereitelt werden«, erwidert Kassandra mit monotoner Stimme. Ihr Blick ist auf keine der beiden Frauen gerichtet. Ihr Lächeln ist verzerrt.
»Wann kommt er?«, fragt Helena. »Und wer wird sein Vorhaben vereiteln?«
»Zum ersten Mal, wenn Paris’ Scheiterhaufen brennt«, sagt Kassandra in so ausdruckslosem und desinteressiertem Ton, als läse sie aus einem alten Kindermärchen vor. »Und zum zweiten Mal, wenn Paris’ Scheiterhaufen erlischt.«
»Und wer wird sein Vorhaben vereiteln?«, wiederholt Helena.
»Beim ersten Mal wird er von Paris’ Gemahlin aufgehalten werden«, sagt Kassandra. Ihre Augen haben sich nach oben verdreht, sodass man nur noch das Weiße sieht. »Beim zweiten Mal von Agamemnon und der Möchtegern-Achilles-Töterin Penthesilea.«
»Von der Amazone Penthesilea?«, sagt Andromache überrascht. Ihre Stimme ist so laut, dass sie im Zeustempel widerhallt. »Die ist sehr weit von hier entfernt, ebenso wie Agamemnon. Wie können sie hier sein, wenn Paris’ Scheiterhaufen erlischt?«
»Pst«, zischt Helena. Sie wendet sich an Kassandra, deren Lider flattern. »Du sagst, Paris’ Gemahlin hindert Menelaos daran, mich zu ermorden, wenn der Scheiterhaufen brennt. Wie mache ich das? Wie?«
Kassandra verliert das Bewusstsein und sinkt zu Boden. Andromache lässt den Dolch in den Falten ihres Gewands verschwinden und schlägt der jüngeren Frau mehrmals hart ins Gesicht. Kassandra wacht nicht auf.
Helena verpasst der am Boden Liegenden einen Tritt. »Zum Hades mit ihr. Wie soll ich Menelaos daran hindern, mich zu töten? Es kann nur noch Minuten dauern, bis …«
Unter den Trojanern und Achäern auf dem Platz draußen vor dem Tempel erhebt sich lautes Geschrei. Die beiden Frauen hören das Fauchen und Tosen.
Die Winde sind gehorsam durchs skäische Tor hereingefahren. Der Zunder und das Holz haben Feuer gefangen. Der Scheiterhaufen brennt.
4
Menelaos sah zu, wie der Westwind die schwelende Glut von Paris’ Scheiterhaufen anfachte. Zuerst bildeten sich ein paar flackernde Feuerzungen, dann ging das ganze Gebilde schlagartig in Flammen auf. Hektor schaffte es gerade noch, die Stufen hinunterzulaufen und sich mit einem Satz in Sicherheit zu bringen.
Jetzt, dachte Menelaos.
Die geordneten Reihen der Achäer hatten sich im Gedränge aufgelöst, als die Menge vor der Hitze des Scheiterhaufens zurückwich, und Menelaos nutzte das Durcheinander, um sich heimlich davonzustehlen. Er schlüpfte an seinen argeiischen Kameraden vorbei und durch die Reihen der trojanischen Fußsoldaten, die auf die Flammen starrten. Langsam arbeitete er sich nach links vor, zum Zeustempel und der wartenden Treppe. Er stellte fest, dass die Hitze und der Funkenflug – der Wind wehte in Richtung zum Tempel – Priamos, Helena und die anderen von der Tribüne und, was noch wichtiger war, die störenden Soldaten von der Treppe vertrieben hatten, sodass der Weg frei war.
Es ist, als würden die Götter mir helfen.
Vielleicht stimmte das ja sogar, dachte Menelaos. Man hörte jeden Tag von Kontakten zwischen Argeiern oder Trojanern und ihren alten Göttern. Nur weil Sterbliche und Götter nun miteinander im Krieg lagen, hieß das nicht, dass die Bande des Blutes und der alten Gewohnheiten vollständig zerrissen waren. Menelaos kannte Dutzende seinesgleichen, die den Göttern nachts heimlich Opfer darbrachten, wie sie es immer getan hatten, obgleich sie die Götter tagsüber bekämpften. Hatte nicht Hektor selbst soeben die Götter des West- und Nordwinds – Zephyros und Boreas – angerufen, damit sie ihm halfen, den Scheiterhaufen seines Bruders in Brand zu setzen? Und hatten die Götter seine Bitte nicht erfüllt, obwohl die Knochen und Eingeweide von Dionysos, Zeus’ eigenem Sohn, auf eben jenem Scheiterhaufen verstreut worden waren wie minderwertige Brocken, die man den Hunden vorwarf?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!