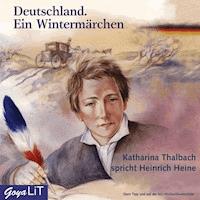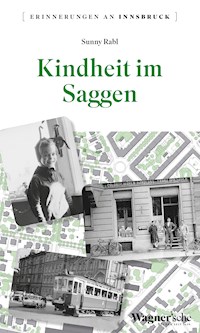
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universitätsverlag Wagner
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Erinnerungen an Innsbruck
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Eine Reise in die Vergangenheit Innsbrucks - lebendig in persönlichen Erinnerungen!Der Saggen, der "vornehmste" Stadtteil von Innsbruck, wird von Sunny Rabl mit den Augen vieler beschrieben. In das Buch sind sowohl ihre eigenen Kindheitserinnerungen aus den 1960er Jahren geflossen als auch die anderer Saggenerinnen und Saggener, deren Geschichten von den 1940er Jahren bis herauf in die Gegenwart reichen. Darüber hinaus werden die Leserinnen und Leser auf einen interessanten wie unterhaltsamen Streifzug durch die Straßen des Saggens mitgenommen - mit seinen Bauwerken und Plätzen, Geschäften und Lokalen von damals und heute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ERINNERUNGEN AN INNSBRUCK
Band 9:
Sunny Rabl
Kindheit im Saggen
EINLEITUNG
Meine Kindheit im Saggen – ja, der Saggen ist männlich! – hat vor 60 Jahren begonnen, meine Erinnerungen gehen also bis an den Anfang der sechziger Jahre zurück. Damals war das Sanatorium der Kreuzschwestern noch im Saggen, in der Kaiserjägerstraße, und dort kam ich auf die Welt, ich bin also eine „Durch-und-durch-Saggenerin“!
Eine frischgebackene Saggenerin (Sunny Rabl)
Aufgewachsen bin ich in der Beethovenstraße 1, im sogenannten „Blocksaggen“, im Gegensatz zum „Villensaggen“, und dass ich heute wieder im Saggen wohne, ist ein Glück, ist er für mich doch der schönste Stadtteil Innsbrucks. Die Beethovenstraße hat sich während meiner Lebenszeit so gut wie gar nicht verändert. Der einzige Unterschied: In dem kleinen Häuschen am Eck zur Erzherzog-Eugen-Straße war früher eine Tabaktrafik, jetzt steht es schon seit vielen Jahren leer. Der Rest ist – weil es in der Beethovenstraße nie Geschäfte gab – gleich geblieben: links der Wohnblock, rechts der schmale Grünstreifen zum Garten des Altersheims, früher Greisenasyl genannt, der von Hundebesitzern genutzt wurde und wird. Ein Unterschied fällt mir jetzt doch noch ein, auf der Beethovenstraße selbst hat sich etwas verändert: Die Kurzparkzonenmarkierung gab es natürlich früher nicht und sie war auch keine Einbahnstraße.
Ich habe für dieses Büchlein eine Reise in meine Kindheit gemacht und mich mit Menschen getroffen, die so wie ich im Saggen aufgewachsen sind oder die im Saggen ein Geschäft betrieben haben bzw. noch betreiben oder die sonst irgendeine interessante Saggen-Facette beitragen konnten. Sie haben mir von ihrer Zeit im Saggen und ihren Erinnerungen erzählt und so meine Geschichte ergänzt und angereichert. Im gemeinsamen Gespräch über früher ist uns so manches eingefallen, was bereits vergessen schien. Es waren für mich sehr spannende Stunden mit lieben Menschen. Dass auch meine Gesprächspartner etwas Positives mitnehmen konnten, hat mir Helga Schönbichler bestätigt: „Danke dir, dass ich durch dich 100 Jahre Familiengeschichte wieder nachempfinden konnte.“
Die Liste derer, die mir bei unseren Gesprächen witzige, interessante und vor allem erwähnenswerte Dinge über den Saggen erzählt haben, ist rein zufällig entstanden und erhebt keinesfalls den Anspruch, vollständig zu sein. So haben sich in der Wohnanlage, in der ich derzeit wohne, in der Tschurtschenthalerstraße, gleich drei Nachbarinnen bereit erklärt, mir aus ihrer Kindheit respektive von ihrer ehemaligen Saggenvilla zu erzählen. Meist hat sich bei einem Gespräch gleich der nächste Gesprächspartner ergeben, so nach dem Motto: „Kennst du Frau XY, die könnte dir sicherlich auch noch einiges Interessantes über den Saggen erzählen“ – und so habe ich über Wochen einige Perlen aufgenommen und sicherlich ganz viele, ebenso erwähnenswerte Geschichten, liegen lassen.
Meine Kindheitserinnerungen betreffen die 1960er/ 1970er Jahre, aber ich habe auch mit Menschen, die älter sind als ich, und mit Jüngeren gesprochen, um so einen umfassenderen Überblick geben zu können. Im Laufe meiner Recherche habe ich alte Bekannte wiedergetroffen und neue Menschen kennengelernt, beides war eine Bereicherung. Beim Durchforsten alter Bücher im Stadtarchiv habe ich so manch Spannendes über die Entstehung des Saggens erfahren und während des Schreibens meinen Stadtteil besser kennengelernt, bin mit offenen Augen durch die Straßen gegangen oder geradelt und habe mich beim genaueren Blick auf die Häuser wieder an vieles erinnert.
In diesem Buch wechseln sich Kapitel mit persönlichen und familiären Erinnerungen mit Erzählungen meiner Gesprächspartner sowie allgemeinen Informationen zum Stadtteil ab. Ich lade Sie hiermit auf eine gemeinsame Wanderung durch den Saggen ein: Folgen Sie dabei teils den Straßenzügen, teils den Erinnerungen und entdecken Sie manches wieder und manches neu.
GEOGRAPHISCHES UND GESCHICHTLICHES
Die geographische Ausdehnung des Saggens, die Südgrenze betreffend, ist nicht eindeutig zu definieren. Auf einer alten Karte wird der Saggen im Norden vom Inn, im Südosten und im Süden von der Sill und ab der Bienerstraße dann von den Viaduktbögen der Ing.-Etzel-Straße, der Kapuzinergasse, der Kaiserjägerstraße und der Karl-Kapferer-Straße begrenzt:
Alte Saggenkarte (Stadtarchiv)
Sucht man auf der Homepage der Stadt Innsbruck nach dem Saggen, kommt man auf eine Karte mit der statistischen Einteilung der Stadtteile von Innsbruck und da sieht die Sache anders aus: Rein statistisch endet der Saggen nämlich heute im Süden bei der Bahntrasse, respektive den Viaduktbögen. Der Teil südlich der Bahn bis zur Sill wird statistisch dem Stadtteil Dreiheiligen zugeordnet.
Auf meine Anfrage beim Stadtarchiv bekam ich eine ausführliche Antwort dazu, die auszugsweise lautet: Die Ortsbezeichnung Saggen und der statistische Stadtteil Saggen sind grundsätzlich nicht identisch, weil es in Innsbruck keine amtliche und einheitliche Definition der Stadtteile gibt. Es gibt für unterschiedliche Zwecke unterschiedliche Gliederungen, die nicht immer deckungsgleich sind. Das sind z. B. die Katastralgemeinden, die Schulsprengel, die Wahlsprengel oder die statistischen Stadtteile. Außerdem wird die statistische Einteilung der Stadt in statistische Bezirke und statistische Stadtteile auch immer wieder verändert.
Bei meinen Gesprächen mit den Saggenerinnen und Saggenern wurde deutlich, dass für sie alle der Saggen bei den Viaduktbögen endete, alles dahinter war „gefährliche Zone“; wer sich dorthin wagte, musste damit rechnen, eine Ohrfeige oder Schlimmeres von den Schlachthofjungs zu kassieren.
Stellt sich nun noch die Frage, woher der Name „Saggen“ kommt: Laut Wikipedia-Eintrag kommt er vom Wort „Sack“, weil das Gebiet bis zum Bau der ersten Innbrücke nach Mühlau ein „Sack“ ohne Ausweg zwischen Inn und Sill war. In Gerhard Köblers mittellateinischem Wörterbuch habe ich gefunden:
„sacco“ – Sack
„sagīnārium“ – ein Ort, an dem Tiere gemästet werden
„sagum“ – Riedgras
In alten Schriften findet sich zunächst die Bezeichnung „Saccha“, später „Saken“, damals war die Gegend noch eine versumpfte Erlenau. Erst im Laufe der Zeit wurde die Au gerodet und der Boden urbar gemacht. Die so entstandenen Wiesen wurden „Saggen“ genannt, sie gehörten damals dem Stift Wilten. Bereits im Jahre 1187 wurde zum ersten Mal erwähnt, dass die Gründe im Saggen zur Bewirtschaftung verliehen wurden. Dabei handelt es sich aber möglicherweise um eine rückdatierte Fälschung aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. 1453 erwarb die Stadt Innsbruck die Rechte am Saggen. Der Saggen gliederte sich ursprünglich in den „Feldsaggen“, in etwa der Bereich des heutigen Villensaggens, und in die „Maadstatt“, den Wiesenbereich zwischen dem Feldsaggen und der Sill, in etwa der Bereich des heutigen Blocksaggens.
Der Saggen war damals noch unverbaute Grünfläche. 1851 wurde erstmals über die Schaffung des neuen Stadtteiles beraten, 1868 eine erste Einteilung der Bauplätze vorgenommen und 1885 der Stadterweiterungsplan für das Saggengebiet beschlossen. Zwischen 1886 und 1914 entstanden die meisten der prächtigen Villen mit den großen Gärten, die den Villensaggen bilden. Im Jänner 1894 beschloss der Innsbrucker Gemeinderat die als Hauptallee geplante Straße nach dem damals amtierenden Bürgermeister, Dr. Heinrich Falk, Falkstraße zu nennen. Mit dem Blocksaggen wurde erst 1910 in der Erzherzog-Eugen-Straße mit sieben Häusern begonnen. Intensiv wurde dann ab den 1920er Jahren an den großen Wohnblocks mit den weitläufigen Innenhöfen gebaut.
Dass im Villensaggen die gutsituierten Menschen lebten, war mir immer schon klar, mir war allerdings als Kind nicht bewusst, dass auch im Blocksaggen das gehobene Bürgertum wohnte. So erzählte mir Heinz Höpperger von der Viktor-Dankl-Straße als „Prominentenstraße“, in der sehr viele Direktoren, Ärzte, Professoren, Hofräte und Chefs aus der Beamtenschaft und der Wirtschaft wohnten. Meinrad Schumacher berichtet von ehemaligen Offizieren, Beamten und Adeligen, die im Saggen wohnten, und auch im Blocksaggen lebte „der Rest aus der Monarchie“ und die „bessere Gesellschaft“.
Der Saggen führt seit 1993 ein Wappen. Dieses ist allerdings nur ein inoffizielles, denn in Tirol sind nur Gemeinden berechtigt, ein offizielles Wappen zu führen.
Saggenwappen (Stadt Innsbruck)
Das Wappen zeigt links einen goldenen Löwen auf grünem Grund, an der Brust den rot-weiß-roten Bindenschild. Rechts ist die grüne, rot umrandete Bischofsmütze auf goldenem Grund zu sehen, sie ist einmal senkrecht und viermal waagrecht unterteilt. Der habsburgische Löwe erinnert an die Bedeutung des Saggens für das Hofleben der Innsbrucker Residenz sowie an das Löwenhaus am Inn, das unter Erzherzog Ferdinand II. errichtet worden war.
Die Bischofsmütze bildet den Kern des 1886 erstellten Bebauungsplans vom Saggen und setzt sich aus folgenden Straßen zusammen: Die untere Kante wird durch die Siebererstraße gebildet, die linke Gerade durch die Kaiserjägerstraße, links zur Spitze führt die Richard-Wagner-Straße, rechts von der Spitze herunter die Conradstraße, und die Gerade rechts ist die Claudiastraße. Genau in der Mitte verläuft die Falkstraße.
Stadtplan Saggen mit Bischofsmütze: „Project zur oestlichen Stadterweiterung am Saggen. Genehmiget mit Gemeinderathbeschluss vom 29. Jänner 1886“ (Stadtarchiv)
Mir ist diese Bischofsmütze in unserem Straßensystem bisher noch nie aufgefallen, ich finde es aber sehr interessant, dass der Saggen am Reißbrett entstanden ist – wie man es von Brasiliens Hauptstadt Brasília kennt.
Aber fangen wir bei meiner Familie an …
MEINE GROSSELTERN ZIEHEN 1945 IN DEN SAGGEN
Mein Vater, Heinz Wechsler, kam 1931 auf die Welt und hat mit seinen Eltern, meinen Großeltern, Erwin und Angela Wechsler, im vierten Stock der Creditanstalt in der Maria-Theresien-Straße 36 gewohnt, da mein Opa leitender Angestellter bei der CA war. Als das Haus am 19. Dezember 1944 den Bomben zum Opfer fiel, kamen sie vorübergehend bei Bekannten in der Beethovenstraße 15, in der Villa der Familie Fleischer, unter. Herr Fleischer machte meine Großeltern darauf aufmerksam, dass die Wohnung in der Beethovenstraße 1, vierter Stock rechts – in der die Fleischers vor dem Bau ihrer Villa gewohnt hatten – unter Umständen frei wird, weil dort eine deutsche Offizierswitwe, Frau Langguth, mit ihren zwei Kindern wohnte und nach Ende des Krieges die deutschen Staatsbürger in ihre Heimat zurückmussten. Mein Großvater ging daraufhin zum Meldeamt und fragte dort an, ob er in diese 4½-Zimmer-Wohnung einziehen könne, und nach dem damals immer noch gültigen „Reichsleistungsgesetz“, kurz RLG, wurde der Familie Wechsler (die kurzerhand mit einer angeführten Untermieterin zu fünf Personen anwuchs) eine „Quartiereinweisung“ ausgestellt.
Interessanterweise hat meine Oma das Schriftstück unterzeichnet. Das passt gut ins Bild, denn mir wurde schon als Kind erzählt, dass meine Oma die „Macherin“ und mein Opa ein „Sir“ war. An ihn habe ich keine Erinnerungen mehr, denn als mein Großvater starb, war ich erst zwei Jahre alt. Im Mai 1945 übersiedelten die Wechslers also in die Beethovenstraße 1. Frau Langguth trat ein großes Zimmer und das winzige Kabinett ab und bewohnte weiterhin die restlichen drei Zimmer.
Frau Langguth war, wie mein Vater sie beschreibt, eine brennte Ostdeutsche aus Leipzig, die sich zu helfen wusste: So hat sie Tanzabende für die amerikanischen Besatzungssoldaten veranstaltet. Um diese anzulocken, stellte sie ihr Grammophon am Balkon auf und ließ anregende Tanzmusik im Hof erschallen. Als „Gastgeschenk“ brachten die tanzfreudigen Amis Lebensmittel aus ihrem Spezial-Versorgungsdepot mit. Meine Großeltern waren von diesem Treiben in der Wohnung verständlicherweise wenig begeistert. Allerdings dauerte dieser Zustand nicht sehr lange an, denn am 1. Juli 1945 wurden die Amerikaner abgezogen und die Franzosen kamen als Besatzungsmacht nach Innsbruck.
Mein Vater erinnert sich, dass die Marokkaner mit der Peitsche auf dem Garagendach standen und Wohnungen, die von nationalsozialistisch belasteten Österreichern bewohnt wurden, innerhalb von 20 Minuten räumen ließen.
In die Wohnung, in der meine Großeltern lebten, kam ein französischer Offizier, Monsieur Lemaître, der bis 1951 blieb. Frau Langguth, die „brennte Ostdeutsche“, konnte auch ihn für sich einnehmen und so musste sie nicht wie viele andere ihrer Landsleute mit nur zwei Koffern Gepäck im Zug zurück in ihre Heimat, sondern M. Lemaître organisierte für sie einen Möbelwagen und begleitete sie damit bis zur Grenze nach Kufstein. Frau Langguth ließ drei Dinge zur treuhändigen Verwaltung bei meinen Großeltern zurück: eine Briefmarkensammlung, die mein Großvater im Safe der Creditanstalt verwahrte, sowie ein Faltboot und das Grammophon, die mein damals 14-jähriger Vater aufbewahrte und benutzte. Irgendwann Anfang der 1950er Jahre hat Frau Langguth alles abgeholt.
M. Lemaître bezog zwei Zimmer und meine Großeltern bekamen ein drittes Zimmer dazu. Mme. Lemaître, eine Elsässerin, sprach fließend Deutsch. Sie und ihr damals 18-jähriger Sohn Jeanneau kamen gelegentlich zu Besuch nach Innsbruck. M. Lemaître hatte den Rang eines Hauptmanns, „Capitaine“, und war vor dem Krieg Bahnbeamter in Paris gewesen. Hier in Innsbruck wurde er der Chef der Innsbrucker Bergbahnen – also der Nordkettenbahn und der Patscherkofelbahn. Er hatte sein Büro in der „Tintenburg“, der Bundesbahndirektion, in der Claudiastraße. Mein Vater beschreibt ihn als netten, umgänglichen Mann. Meine Großeltern und die Lemaîtres begegneten sich in der gemeinsam benutzten Wohnung höflich, Freundschaft wurde aber keine daraus.
1951 wurde M. Lemaître nach Paris zurückbeordert. Er fuhr daraufhin mehrmals mit dem „Arlberg-Express“, der damals schon zwischen Wien und Paris verkehrte, mit zwei vollen Koffern nach Paris und mit leeren Koffern wieder nach Innsbruck. Dabei hat er aus der Wohnung in der Beethovenstraße alles mitgenommen, was nicht niet- und nagelfest war. Meine Großeltern mussten an einem Sonntagabend, als sie von einem Ausflug zurückkamen, feststellen, dass es kein Besteck mehr in der Wohnung gab, dass sämtliche Glühbirnen entfernt und aus dem Schrank sogar der Krawattenhalter abgeschraubt worden war. Meine Oma war sehr verärgert, mein Großvater hat sie beruhigt und ihr geraten, sich doch über den Auszug einfach zu freuen.
M. Lemaître hat meinen Großeltern aber auch eine Art Abschiedsgeschenk gemacht: Er hat ihnen nämlich verraten, dass, sobald er beim französischen Wohnungsamt die Wohnungsschlüssel zurückgeben werde, damit zu rechnen sei, dass andere Franzosen die zwei Zimmer in Anspruch nehmen würden. Aber: Beim französischen Wohnungsamt waren diese beiden Zimmer nicht näher definiert. Dort war nur bekannt, dass in der Wohnung Beethovenstraße 1, vierter Stock rechts, zwei Zimmer den Franzosen zustehen würden. Meine Großeltern übersiedelten sofort in die beiden bisher von M. Lemaître bewohnten Zimmer und als dann auch wirklich postwendend ein junges französisches Pärchen anläutete und sich die beiden Zimmer ansehen wollte, zeigten ihnen meine Großeltern neben einem großen Zimmer das winzige Kabinett als „salle à manger“, als Esszimmer, woraufhin die beiden kein Interesse mehr an der Wohnung hatten. Noch ein ganzes Jahr lang – solange die Franzosen in Innsbruck stationiert waren – erschrak meine Großmutter bei jedem unerwarteten Läuten, immer in der Sorge, es könnte jemand die beiden Zimmer besichtigen wollen, was aber nicht mehr passierte.
Mein Vater hat die Realschule am Adolf-Pichler-Platz besucht. 1944, nach den ersten Bombardierungen von Innsbruck, wurden die Buben nach Reutte verschickt, wo sie bis Ende April 1945 blieben. Als die Front näher rückte, fuhren die Schüler mit einem der letzten Züge von Garmisch-Partenkirchen nach Innsbruck. Knapp vor Kriegsende war mein Vater also wieder in Innsbruck und ab September 1945 ging er dann auch wieder am Adolf-Pichler-Platz in die Schule, wo er 1949 maturierte.
Eingekauft haben meine Großeltern zu dieser Zeit in einem Lebensmittelgeschäft in der Mozartstraße, denn dort waren sie mit ihren Lebensmittelmarken eingetragen. Die freie Wahl, dort einzukaufen, wo man wollte, hatte man damals nämlich nicht.
Wie alle anderen, die mir von den 1950er Jahren erzählt haben, kommt auch mein Vater schnell auf den Eislaufplatz und den Tennisplatz in der Falkstraße zu sprechen, dort, wo später das Freigelände der Messe war. Der IEV, der Innsbrucker Eislaufverein, war noch in der Monarchie, im Jahre 1883, gegründet worden. Im Jahre 1894 wurde das wunderschöne Vereinshaus, der „Forstpavillon“, errichtet.
Eislaufplatz Falkstraße, „Forstpavillon“ (Stadtarchiv)
Im Jahre 1900 wurde der Tennisclub gegründet und in den 1920er Jahren kam dann auch noch die Sektion Eishockey dazu. Wenn der Winter und die Kälte kamen, wurden die Tennis-Sandplätze einfach unter Wasser gesetzt und der Natureislaufplatz war fertig. Taute es, kam beim Eislaufen der rote Tennissand zum Vorschein. 1959 wurde eine Kunsteisbahn in der Messehalle errichtet, die aber bereits 1964, als die Olympiahalle für die ersten Olympischen Spiele entstand, wieder abgebaut wurde. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Anlage nicht genutzt, aber unmittelbar nach dem Krieg wurden der Eislaufplatz und die Tennisplätze wieder aufgemacht. Der Eislaufplatz war in den 1950er Jahren der