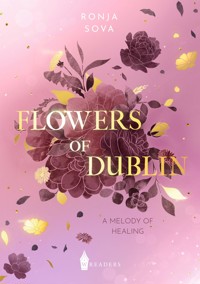Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nachdem sie versehentlich einen Dozenten in Brand gesteckt hat, flieht die junge Irin Gwyn in den Küstenort, in dem sich ihre Eltern kennenlernten. Auf der Suche nach einer neuen Aufgabe – und Kaffee – stolpert sie in das Buchcafé von Buchhändler Kilian, der sie am liebsten sofort rausschmeißen würde. Kilian Keenan braucht nur drei Dinge in seinem Leben. Seine Buchhandlung, seine Ruhe und das, was von seiner Familie übriggeblieben ist. Als er sich plötzlich der fröhlichen Gwyn gegenübersieht, regt sich in ihm das erste Mal der Wunsch, genug zu sein und trotz seiner Selbstzweifel gesehen zu werden. Und obwohl er weiß, dass manche Dinge nicht für ihn bestimmt sind, stellt er Gwyn bei sich ein. Bei der gemeinsamen Arbeit zwischen Bücherregalen und Kaffee kommen sie sich nicht nur näher, sondern entdecken auch gemeinsame Schlüsselmomente in ihrer Vergangenheit …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Content Warnung
Tod und Trauer, Amputation, Herzinfarkt, Rassismus gegen Sinti*zze
und Rom*nja, verletzte Tiere
Über die Autorin
Ronja Sova wurde 1997 in Gießen geboren. Mittlerweile lebt sie im wunderschönen Saarland, das zwar klein, aber trotzdem groß genug ist, um sich ständig zu verlaufen. Das Lehramtsstudium hat sie äußerst erfolgreich abgebrochen, weil sie mal erwähnt hat, dass ihr Opa ein Sinto war und die darauffolgenden Witze über Mensa-Essen und Schnitzel mit dieser einen Soße nicht besonders kreativ waren. Nebenbei bringt sie sich mit Google-Übersetzer und furchtbar schlechten Spanisch-Kenntnissen von Deutschland aus durch den Tierschutz-Alltag in Andalusien. Seit Jahren schreibt sie in jeder freien Minute und das an allen Orten, an denen sich schreiben lässt.
WREADERS E-BOOK
Band 293
Dieser Titel ist auch als Taschenbuch erschienen
Vollständige E-Book-Ausgabe
Copyright © 2026 by Wreaders Verlag, Sassenberg
Verlagsleitung: Lena Weinert
Bestellung und Vertrieb: epubli, Neopubli GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: Jessica Rose
Lektorat: Lektorat Zeilenwunder
Korrektorat: Lektorat Hygge
Satz: Elci J. Sagittarius
www.wreaders.de
Alle Rechte vorbehalten. Die Nutzung des Werkes für Text- und Data-Mining ist gemäß § 44b UrhG nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Rechteinhabers gestattet. Bei der Erstellung dieses Buches wurde
keine generative KI eingesetzt.
Für Catha <3
Playlist
ceilings – Lizzy McAlpine
Burn – Tom Walker
Homesick – Noah Kahan
Labyrinth – Taylor Swift
Supercut – Lorde
Little Lion Man – Mumford&Sons
The Bolter – Taylor Swift
Star Of County Down – The High Kings
Follow Me Up To Carlow – The High Kings
Stick Season – Noah Kahan
Ocean – Elsa & Emilie
Enchanted (Taylor’s Version) – Taylor Swift
1. Kapitelgwyn
Ich bin nicht die erste Studienabbrecherin der Familie. Grandma hat ihr Seniorenstudium letzte Woche geschmissen, nachdem ihr Sitznachbar und heimlicher Schwarm sich für ihre beste Freundin entschieden hatte. Jetzt werden Linda und sie sich für mindestens zwei Wochen hassen, ehe sie bei einem Sektfrühstück entscheiden, dass ihre Freundschaft über jedem Mann steht.
Ich bin auch nicht die erste Studienabbrecherin in meinem Freundeskreis. Enya hat vor zwei Semestern die Beine in die Hand genommen und besucht die Staaten statt die unterschiedlichen Labore für ihr Pharmaziestudium.
Und sicher bin ich nicht die erste Studienabbrecherin Irlands, obwohl das Land auf der ganzen Welt mit seiner niedrigen Quote wirbt.
Höchstwahrscheinlich bin ich jedoch die erste Studienabbrecherin, die fliegt, weil sie beinahe ihren Dozenten in Brand gesetzt hat. Okay, nicht bloß beinahe. Mr Lerck hat geschrien, geleuchtet und in dem Schaumberg, der aus dem Feuerlöscher geschossen kam, recht unzufrieden gewirkt.
Beim anschließenden Gespräch mit dem Dekan wurde meine nichtexistente Zukunft an der School of Arts verkündet.
Nach vier Semestern Kunst und Anthropologie musste ich die Pinsel und die verschmorte Leinwand in mein winziges Auto packen und der Universität im Rückspiegel zusehen, wie sie kleiner und kleiner wurde.
Keine Ahnung, warum ich dachte, Feuer wäre die fehlende Nuance in meinen Werken. Vermutlich hätte ich bei der goldenen Folie, die sich von den schwarzen Hintergründen wunderbar abhob, bleiben sollen. Bis auf den Sekundenkleber, der regelmäßig meine Fingerkuppen betäubte, war es eine narrensichere Geschichte und hätte mich nicht auf die einsame Straße entlang der Küste geführt.
Ohne die Augen von der Zielgeraden zu nehmen, taste ich nach meinem vibrierenden Handy und halte es mir vor die Nase. Fionas bunter Lockenkopf leuchtet auf. Seufzend drücke ich sie weg und höre im Kopf ihre Stimme, die meine Flucht inbrünstig kommentiert.
Ich schüttele den Gedanken an meine beste Freundin, die übrigens nicht von der Uni geflogen ist und in ihrem ganzen Leben auch noch nie einen Dozenten in Brand gesteckt hat, ab. Sie ist eben bei der Folie geblieben …
Vor mir tun sich die bunten Häuschen auf, die auf jeder Postkarte, die Touristen aus Cairn’s End verschicken, zu finden sind.
Mein Navi führt mich durch die engen Gassen, und an jeder Ecke frage ich mich, ob es genau hier passiert ist. Haben sie sich vor dem Blumenladen kennengelernt, der neben dem Bestattungsunternehmen irgendwie richtig und gleichzeitig vollkommen falsch wirkt? Oder war es eine Straße weiter vor dem Pub, der um diese Uhrzeit verwaist und friedlich mit den anderen Gebäuden in Einklang ruht?
Ich lenke die klapprige Kiste auf den Parkplatz des einzigen Cafés, das in diesem kleinen Nest aufzutreiben ist. Von dem weißen Schild, auf dem in schwarzer Schrift ›Büchercafé‹ steht, blättert mehr Farbe ab, als Dad Falten bekommen wird, sobald er von allem erfährt.
Mit einem beunruhigenden Stöhnen erstirbt der Motor. Das ist eindeutig eine Sache, um die sich Zukunfts-Gwyn kümmern wird.
Im angeschlagenen Rückspiegel kontrolliere ich meinen roten Lippenstift und trage Fionas teuren Concealer auf die dunklen Augenringe auf. Ein letzter Blick auf mein mitgenommenes Gesicht und ich setze das allererste Mal einen Fuß auf die Erde des kleinen Küstenorts, in dem Mum und Dad sich kennen und lieben lernten.
Der Ort, in dem Dad den Antrag machte und sie ein halbes Jahr später unter Reis und Rosenblüten aus der Kirche in den verregneten Herbst traten. Mum in dem weißen Hochzeitskleid, das ihr an den Knöcheln zu lang und an den Brüsten zu eng war. Dad in dem drei Nummern zu großen Anzug seines Großvaters, der zehn Jahre zuvor verstarb. Ein nicht passendes Brautkleid und ein zu großer, von Motten durchlöcherter Anzug später kam ich auf die Welt. In Dublin, wohin die Liebe meiner Eltern sie geführt hatte.
Doch dann starb Mum und ließ Dad und mich zurück. Zwei Seelen, die ihren Tod nie überwunden haben. Die das Loch nicht füllen konnten, das zwischen ihnen in die Erde gerissen wurde. Unser Bindeglied fehlt und seitdem schwirren wir umeinander her, ohne je echten Kontakt zu haben.
Dad vermisst seine einzige große Liebe und ich erinnere ihn an das, was er verloren hat. Meine dunklen Haare und die braunen Augen, die in wütenden Momenten nahezu schwarz wirken. Die Einssechzig, die ich ans Maßband bringe, wenn ich dicke Sohlen anziehe. Selbst meine Stimme ist für ihn zu viel Mum. Deswegen gibt es hier und da eine Nachricht, die aus dem üblichen ›Hi, wie geht’s? Gut, und dir?‹, besteht. Mehr nicht. Mehr würde bedeuten, dass da eine Beziehung entstehen könnte, und wenn ich eines sicher weiß, dann dass er sie niemals wollen würde. Es wäre eine einseitige Sache, bei der ich am Ende ohnehin verliere.
Ich presse den Gedanken an Dad in die hinterste Ecke meiner Probleme. Zwischen die neue Zukunft, über die ich mir dringend klar werden muss, und die Panikattacken, die ich nicht loswerde.
Mit müden Augen visiere ich das breite Schaufenster an, in dem zumindest das erste Versprechen des Schildes deutlich sichtbar wird.
Bücherregale säumen die Wände vom dunklen Boden bis zur nicht minder dunklen Decke. Bunte Buchrücken stehen in ordentlichen Reihen auf ihrem zugeordneten Platz und warten darauf, dass die Geschichten zwischen ihren bedruckten Seiten gefunden werden.
Aber was ist mit dem versprochenen Café, in dem ich bei einem Latte macchiato ein Stück Kuchen frühstücke, das gleichzeitig mein Mittagessen wird?
Fehlanzeige. Obwohl … Ich kneife die Augen zusammen … Doch, eindeutig. Da hinten in der Ecke steht im Halbdunkel eine einzelne Kaffeemaschine. Eine für Pads. Mein Magen knurrt anklagend.
»Das ist doch ein schlechter Witz!«, schimpfe ich vor mich hin. Wie kann dieser Laden Fünf-Sterne-Bewertungen auf allen Plattformen haben?
Das schrille Türglöckchen über meinem Kopf kündigt mich an, als ich die Tür aufdrücke und eintrete, aber bis auf die gehäckselten toten Bäume und die unbrauchbare Kaffeemaschine bin ich allein.
Gierig sauge ich den Geruch von trockenen Seiten und Koffein in meine Lungen. Wenn ich schon keinen offenbar komplizierten Latte bekomme, sollen wenigstens meine Nasenhaare wach werden.
Angesäuert sehe ich mich in dem Buchcafé um.
Wer auch immer sich um das Sortiment kümmert, hat nicht viel für Romantik übrig. Während Klassiker fünf Regale einnehmen und Krimis ganze acht, bekommen die neuesten Liebesgeschichten einen Tisch. Einen halben. Die Bücher ohne Happy End kann ich unter keinem standhaltenden Argument zu den Liebesromanen zählen. In ihnen lese ich die Geschichte meiner Eltern, und das Ende ist schuld daran, dass ich praktisch keine mehr habe. Die letzten Sätze der Geschichte haben Dad gebrochen und die letzten vier Buchstaben waren endgültig. ›Ende.‹
Ich umrunde den Tisch, beäuge die kleine Auswahl und wische die leichte Staubschicht von einem Buch, das mir nichts sagt. Auf dem Cover ranken sich Magnolien um ein Pärchen auf der Parkbank und explodieren im bunten Himmel der untergehenden Abendsonne.
Das süße Bild mit den lächelnden und offenkundig Verliebten wirkt vielversprechend für einen Abend auf der Couch mit einem Tee – oder einer heißen Schokolade, je nach dem, wie klar meine Zukunft bis dahin aussieht.
Kuschelsocken, Schokolade, Kerzen. Perfekt.
Allerdings war der Umschlag des Buches damals, in dem der Kerl am Ende stirbt, ebenfalls vielversprechend.
Mein Zeigefinger gleitet zwischen die letzten Seiten.
Ein Hoch auf die Verlage, die der Umwelt wegen auf das einzelne Einschweißen der Bücher verzichten und mir so ermöglichen, das Ende zuerst zu lesen.
Ich überblättere die Werbung weiterer Bücher, überfliege die knappe Danksagung und meine Augen finden automatisch zu den wichtigsten Buchstaben der Geschichte.
›Er küsste ihn, weil es das Einzige war, was sie no‒‹
»Was zur Hölle tun Sie da?«
Das Buch fällt mir aus der Hand und landet mit einem dumpfen Platschen auf dem Holzboden.
Er küsste ihn, weil es das Einzige war, was sie noch tun konnten, bevor das grausamste Ende der Buchgeschichte auf sie wartete?
Er küsste ihn, weil es das Einzige war, was sie noch tun mussten, ehe sie im Bett landeten und ihr lang ersehntes Happy End feierten?
Mein Blick schnellt wütend in die Höhe. Bereit, dem Störenfried die Meinung zu sagen.
Sattes Grün wie das der gesunden Weiden, die sich direkt an den schmalen Dünenstreifen schmiegen, trifft mich und mir stockt der Atem.
Der Störer sieht nicht minder wütend aus. Dunkle Wimpern umrahmen die zu Schlitzen verzogenen grünen Augen. Hatte ich erwähnt, wie intensiv dieses Grün ist? Nun ja, die rotbraunen Haare, die ordentlich an den Schläfen anliegen und in den fein getrimmten Bart übergehen, betonen es einmal mehr. Und die Stoppeln – die ziemlich sicher genau drei Tage wachsen durften – heben zusätzlich die zu einem schmalen Strich gepressten Lippen hervor.
Von der Kasse aus starrt er mich in Grund und Boden und ich stelle mir vor, wie ich den Kopf in den Nacken legen müsste, würde er direkt vor mir stehen. Aber er macht keinerlei Anstalten, auf mich zuzukommen.
Gut so. Schließlich schlägt mein Herz unangenehm stark hinter den Rippen.
Um nicht vollends den Verstand zu verlieren und mich von der Schönheit eines Mannes blenden zu lassen, wende ich mich ab, gehe in die Knie und ignoriere den altbekannten Schmerz, der mir durch den Knöchel schießt. Meine vor Nervosität zittrigen Finger finden nur mit Mühe das heruntergefallene Buch. Geradeso kann ich mich davon abhalten, ein weiteres Mal auf die letzte Seite zu blicken, um herauszufinden, ob Aidan und Thorn ihr Happy End bekommen oder nicht.
Ich lege es zurück auf den Stapel und rücke es zurecht, bis alle Ecken der Bücher eine senkrechte Linie bilden.
Mit einem Räuspern straffe ich die Schultern und richte meinen Blick erneut auf den Besitzer hinter der Kasse.
»Ich möchte einen Kaffee bestellen«, sage ich. Bemüht um eine feste Stimme.
Die Wut weicht purer Genervtheit. Er rollt mit den Augen und ich weigere mich, in ihnen die grünen Weiden zu sehen. Giftkröte. Ja, das passt eindeutig besser zu dem Kerl, der lasch auf die Kaffeemaschine auf dem einsamen Tisch in der Ecke des Raumes deutet.
»Wasser wurde heute Morgen aufgefüllt. Sie müssen Ihr Pad reinlegen und auf Start drücken.« Von einem Seufzen begleitet, mustert er mich und seine Augen bleiben an dem rosa Mickey-Mouse-Shirt hängen, das ich abwechselnd zur Uni und zum Schlafen trage. »Bekommen Sie das hin?«
Verwirrt blinzele ich dem Besitzer des ›Büchercafés‹ entgegen. »Wie bitte?«
Er stößt lautstark den Atem aus und legt den Kopf in den Nacken.
Meine Zündschnur wird spürbar kürzer. »Wenn möglich, würde ich gern ein Stück Kuchen bestellen.«
Diesmal ein leises Lachen. Warmer Bariton schießt durch die Bücherregale und hallt noch Sekunden, nachdem sein Gesicht wieder ernst geworden ist, durch meine Ohren. »Es gibt keinen Kuchen.«
»Einen Scone?«, versuche ich es und mein Magen zieht sich um die Leere zusammen.
»Auch das nicht.«
»Ein trockenes Stück Brot?«, presse ich hervor.
Wie schwer kann es schon sein, einen verdammten Kuchen für die Kundschaft zu backen? Ich bin keine Künstlerin am Herd, aber immerhin keine komplette Niete, und ich behaupte einfach mal, dass es nicht so schwer sein kann.
Seufzend zeigt mein Gegenüber wieder auf die Kaffeemaschine. »Hören Sie, Lady. Es gibt Kaffee und sonst nichts. Ich kann Ihnen einen Keks anbieten, aber ich lege keine Hand für die Haltbarkeit ins Feuer. Ich habe sie letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen und seitdem verstaubt die Dose im Büro.«
»Keksmörder«, brumme ich.
»Keksmörder?«, echot er und klingt für meinen Geschmack etwas zu amüsiert.
»Ja. Und ein Kaffeehasser. Wie können Sie das hier ›Büchercafé‹ nennen, wenn von C bis É nichts vorhanden ist?«
»Brauchen Sie Zucker für den Kaffee? Sie wirken gereizt.«
»Ich bin nicht gereizt!«, rufe ich gereizt und spüre Tränen hinter den Lidern brennen. O nein. Bebende Lippen und eine enge Kehle. Dabei sollte dieser Ausflug mich an die schönen Seiten des Lebens erinnern. Die voller Liebe. Liebe, die meine Eltern in diesem Kaff gefunden haben.
Stattdessen werde ich ausgelacht, stehe kurz vor der nächsten Panikattacke und die Synapsen graben sich gleich aus meinem Körper, um sich den Kaffee selbst intravenös zu geben.
Entschlossen stapfe ich in den beschämenden Caféteil des Ladens und öffne den Verschluss zum Sieb.
»Wo sind die Pads?«, frage ich und schaue ihn bewusst nicht an.
»Sagte ich doch«, seufzt er.
Er hält mich für die wandelnde Inkompetenz, die sich in Unwissenheit kleidet und mit bereits beantworteten Fragen glänzt. »Sie müssen sich Ihren Kaffee selbst mitbringen.«
»Wie bitte?«, knurre ich ungehalten. »Warum zur Hölle soll ich dann fünfzig Cent bezahlen?« Ich tippe auf das vergilbte Schildchen, das für diese Frechheit einer Dienstleistung Geld verlangt und es dabei nicht einmal schafft, gerade zu hängen.
»Für das Wasser.«
Mir klappt die Kinnlade runter. Wenigstens wird er mich nach diesem Anblick nicht mehr ›Lady‹ schimpfen. Dieser arrogante – und zur Hölle leider gut aussehende – Buchhändler!
Okay, Gwyn. Nicht ausflippen. Bloß nicht ausflippen.
Atmen.
Ein und aus.
Ein und aus.
Ein und –
»Lady, weinen Sie jetzt ernsthaft, weil Sie Durst haben?«
»Ich bin keine Lady!«, schreie ich und wische mir über die feuchten Wangen. »Und ich weine nicht, weil ich Durst habe, wobei das ein valider Grund für Tränen wäre. Ich weine, weil mich dieser Besuch ablenken sollte und er das genaue Gegenteil bewirkt! Ich fühle mich wie die Versagerin, die ich ganz offensichtlich bin!« In dem Kampf von frischer Luft gegen meine vom Wutweinen verstopfte Nase beweise ich, dass ich keine Lady bin, und ziehe lautstark Sauerstoff in meine Lungen. »Seht her, Gwyn hat einen Menschen in Brand gesteckt, musste aus dem Wohnheim ausziehen und wohnt in einem Auto, dem man vor jeder Fahrt die Rosette pudern muss, weil es sonst im ungünstigsten Moment den Geist aufgibt. Und ich habe keine Lust, immer mit den Wimpern zu klimpern, damit der Abschleppdienst bloß die Hälfte verlangt. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, denn ich bin pleite, erfolglos, und meine Zukunft sehe ich an den meisten Tagen nicht, weil die Wolken dick und grau und scheiß intransparent sind!« Heftig atmend balle ich die Hände an den Seiten zu Fäusten.
»Danke für die ungefragte In-Kenntnis-Setzung Ihres aktuellen Lebensstatus«, sagt er sarkastisch.
Ich. Werde. Explodieren.
Stumm fixiere ich ihn. Den Feind jedes erwachsenen Menschen, der ohne eine Dosis Koffein nicht lebensfähig ist.
Seufzend zieht er die Schublade hinter der Theke auf und im nächsten Moment fliegt ein blaues Rechteck auf mich zu. Zu spät realisiere ich, dass es eine nette Geste sein soll.
Das Päckchen Taschentücher prallt von meiner Stirn ab und plumpst auf den Boden.
»Ach kommen Sie schon«, beschwert er sich. »Das hätten Sie fangen können.«
Ich presse die Lippen zusammen, gehe erneut in die Knie, ignoriere wieder das Stechen, das diesmal bis ins Schienbein reicht, und hebe die nette Geste auf.
Die Türglocke kündigt den nächsten enttäuschten Besucher an. Außer er ist nur für die Geschichten da.
»Ian, seit wann bewirfst du deine Kunden?«
Ruckartig komme ich in den Stand und drehe mich um die eigene Achse, um den Mann mit der identischen Stimme sehen zu können.
»O nein, es gibt zwei von euch.«
Dasselbe Grün starrt mir entgegen. Es ist nur weniger ernst und dafür voller Wärme und Schalk. Rotbraunes Haar, das sich in der Länge lockt und das rasierte Gesicht einrahmt, auf dem ein ungläubiges Lächeln entsteht.
»Keine Angst, ich bewerfe neue Leute nie mit«, er stoppt und beäugt das Päckchen in meiner Hand, »Taschentüchern.«
»Sie hat geweint«, klärt ›Ian‹ ihn auf.
»Warum haben Sie geweint?«, fragt er und legt den Kopf schief. Die Lippen zu einem halben Grinsen erhoben.
»Weil der da mich nicht das Ende vom Buch hat lesen lassen und bei dem Schild gelogen hat. Außerdem muss es doch strafbar sein, sich selbst derart viele fünf Sterne Rezensionen zu geben!«
»Himmel, ich hole Ihnen ja schon ein verfluchtes Kaffeepad und die abgelaufenen Kekse. Nur für den Fall, dass Sie sich den Magen verderben: Das nächste Krankenhaus ist über eine halbe Stunde entfernt!« Er wendet sich ab und verschwindet.
Ein Pfeifen erklingt neben mir und ich drehe mich wieder der netteren Version zu.
2. Kapitelkilian
»Mein Bruder hat Sie also zum Weinen gebracht?«, höre ich Sean fragen, während ich möglichst gleichmäßig in die Küche direkt hinter dem Empfang trete.
Vorsichtig schließe ich die Tür und stoße die angehaltene Luft aus. Erleichtert stütze ich mich auf den Stock, der an der Spüle lehnt, und entlaste das schmerzende Bein, das schon protestierte, als ich nur mit dem Gedanken gespielt habe, ihn nicht mit nach vorn zu nehmen.
Albern.
Als könnte ich Frauen beeindrucken. Als hätte ich das je gewollt.
Aber als sie mit dem grässlichen T-Shirt hereinspazierte, hat es sich wie die ersten warmen Strahlen nach einer langen Regenperiode angefühlt. Die Aussicht auf Sonnenschein zwang mich, in den Laden zu treten. Ohne den Stock, den ich seit vierundzwanzig Jahren brauche. Gut, nicht ›den‹ Stock. Über die Jahre musste er mitwachsen und bei dem ständigen Gebrauch kam es zu dem ein oder anderen Bruch.
Auf jeden Fall humpelte ich unauffällig in den Laden und beobachtete sie. Wie sie die Buchrücken musterte und mit schiefgelegtem Kopf durch die Reihen schlich. Titel für Titel in sich aufnahm und gelegentlich den Kopf schüttelte. Dann blieb sie an dem Tisch hängen, den Aisling mir aufgequatscht hat. Weil Aisling in der Pubertät ist und von nicht ernstzunehmenden Versprechen und der Liebe lesen will, statt von Menschen, die diese Welt wirklich verändern.
Die Frau umrundete die Ansammlung an Schnulzen, verzog das Gesicht angesichts einiger Bücher und klammerte sich an einen blumigen Albtraum. Und da verlor sie all mein Interesse auf einmal. Indem sie das Buch auf der falschen Seite aufklappte und das Ende las. Wer tut so etwas? Diese Barbarin hat sich selbst die vom Autor sorgfältig geplanten Wendepunkte, die zu den letzten Resten schwarzer Tinte führen, gestohlen.
Empört über meinen Gast zerre ich die Blechdose aus dem Regal und werfe ein einzelnes Pad darauf.
Kurz überlege ich, erneut auf den Stock zu verzichten, aber mein pochendes Knie und das Ziehen von der Hüfte bis ins Rückenmark halten mich davon ab.
Ach, wen willst du schon beeindrucken? Meine Faust schließt sich fester als nötig um den Knauf.
Ich klemme mir die Dinge, die das Wort ›Café‹ rechtfertigen, unter den unbeschäftigten Arm und lege mir die Worte zurecht, die Granny sich heute Abend anhören wird.
In meiner Argumentation gegen Grannys Vorschlag, ein Café an die Buchhandlung anzugliedern, werde ich diesen Tag ganz nach oben auf die Liste setzen. Nicht, dass sie das beeindrucken wird und sie mich das alte Schild des Vorbesitzers endlich abnehmen lässt. Nein, sie wird darauf beharren, dass mir mehr Gesellschaft guttun würde.
Zurück im Laden sehe ich meinen Bruder mit ihr flirten. Die Augenbrauen Flynn-Ryder-mäßig verzogen und den linken Mundwinkel ein Stück höher als den rechten. Seine Grübchen ein wenig tiefer.
Er hat die Ellbogen lässig auf der Theke abgelegt und seine Statur ist leicht gebeugt, um näher an ›auf Augenhöhe‹ zu gelangen.
Schwungvoll stelle ich die Dose zwischen ihnen ab.
Meine neueste Kundin zuckt zusammen. Die geröteten Augen finden meine und wie vorhin bleibt mein Herz eine Sekunde stehen, ehe es außerhalb des Takts weiterschlägt. Beinahe bin ich versucht, sie zu trösten. Dann fällt mir ein, dass Sean dafür der bessere Ansprechpartner ist.
Zaghaft streckt sie die Finger aus, greift nach dem Pad und marschiert mit hängenden Schultern zur Kaffeemaschine.
›Was hast du getan?‹, fragt Sean lautlos.
Nichts.
Er rollt mit den Augen. ›Klar.‹
Sean ist zwar der Jüngere von uns beiden, aber eindeutig derjenige mit mehr Erfahrung in … tja, allen Bereichen.
Bezüglich Frauen, Freunden, allgemeinen sozialen Interaktionen.
»Haben Sie Hafermilch?«
»Nein«, antworte ich, während mein Bruder bejaht.
Die geschwungenen Augenbrauen kontrahieren und geben ihrem verzweifelten Ausdruck wie vorhin eine Spur Gereiztheit.
»Ja«, wiederholt Sean und umrundet die Kasse. »Warten Sie, ich bringe sie Ihnen.« Er verschwindet in der Küche und wühlt in meinem Kühlschrank.
Bis auf das tiefe Brummen der Kaffeemaschine wird es gespenstig leise im Laden.
Mein Gast wippt unruhig auf den Zehenspitzen, lugt zwischendurch immer wieder zu dem Buch, das sie vorhin in der Hand hatte, und meidet tunlichst meinen Blick. Oder eine Konversation mit mir.
Seufzend lehne ich mich mit der Hüfte gegen die Kasse, lasse den Stock dahinter verschwinden und deute mit dem Kinn in Richtung der Liebesromane. »Er küsste ihn, weil es das Einzige war, was sie noch tun mussten, um ihre Liebe zu besiegeln«, zitiere ich den letzten Satz. Was für eine schrecklich kitschige Aneinanderreihung von Worten.
Überrascht hebt sie den Kopf und sieht mir direkt in die Augen. Etwas zieht an mir. Fest und nachdrücklich und ohne Grund.
Ich presse den Kiefer aufeinander und konzentriere mich lieber darauf, dass ich sie für eine Barbarin halte.
»Sie haben es gelesen?«
Das Schnauben kann ich nicht aufhalten. Ein verletzter Ausdruck erscheint auf ihrem Gesicht und ich verfluche die Tatsache, dass es mir auffällt.
»Sicherlich nicht«, antworte ich. »Aber ich kenne jemanden, der es gelesen hat und mir wochenlang von diesem Ende vorschwärmte.«
»Ihre Frau?«
Das überraschte Lachen kann ich ebenso wenig aufhalten wie zuvor das Schnauben. Meine Filter sind deaktiviert, seit sie den Laden betreten hat. »Ich bin nicht verheiratet.«
»Oh.« Verlegen wendet sie sich ab und nimmt die Tasse mit dem durchgelaufenen Kaffee in die Hand. »Entschuldigen Sie. Das war indiskret.«
»Das Mädchen ist sechzehn und die Jungs in ihrer Schule stammen nun mal nicht aus der Feder einer Autorin. Außerdem war ich indiskret, weil ich Sie nicht das Ende habe lesen lassen.«
»Warum eigentlich nicht?«, fragt sie und tritt näher.
Ich kicke den Stock weiter unter den Tresen. »Weil bloß Barbaren so etwas tun«, antworte ich ernst.
»Ich würde sagen, bloß Barbaren lesen Bücher ohne Happy End. Die Geschichten anderer sollen mich von meinem Leben ablenken und nicht daran erinnern, dass ich nichts im Griff habe. Heiße Schokolade, Kerzen, Happy End.«
»Oder die Geschichten führen einem vor Augen, dass es schlimmer hätte kommen können. Der Protagonist hätte wie sein Liebhaber sterben können.«
»Aber dann wären beide tot«, sagt sie.
»Eben. Aber bei einem Toten hat die andere Hälfte die Chance auf ein Leben.«
Sie verzieht das Gesicht und legt die Unterarme neben meinen ab. Eine leichte Gänsehaut bildet sich auf den Stellen nackter Haut, die ihr am nächsten sind. »Ein Leben, nachdem die Liebe des Lebens gestorben ist? Kommt mir nicht sonderlich … lebenswert vor.«
»Nicht?«
»Nö.« Sie zuckt mit den Schultern und sucht endlich wieder meinen Blick. »Die ganze Zeit ist da dieser Teil, der fehlt und den man nicht mehr zurückbekommt. Egal, wie sehr man sich anstrengt. Das ist nicht fair und früher oder später zerbricht der Überlebende daran.«
Sie klingt so traurig, während sie mir ihren Standpunkt erklärt.
»Was ist mit Paaren, die schon weiter waren? Kinder, Haus und Hund haben. Sollte da nicht eine Person überleben, um für diese Seelen zu sorgen?«
»Nur, wenn sie es tun«, entgegnet sie. »Sich sorgen, meine ich.«
Ehe sie ihren Gedanken und diesen leichten Schmerz in ihrer Stimme weiter ausführen kann, werden wir von Sean unterbrochen, der mit einer frischen Packung Hafermilch aus der Küche kommt und ihre Tasse zu sich zieht.
»Darf ich?« Er mischt ihr die Milch in den Kaffee und rührt zum Schluss einen Teelöffel Zucker unter.
»Habt ihr euch schon vorgestellt?«, erkundigt sich mein Bruder und schiebt ihr die Tasse zwischen die Hände. Ihre Finger sind sich dabei so nahe, dass mir ein ungewohnter Stich durch den Körper fährt.
Genervt von meiner Reaktion, bekomme ich nur am Rande mit, wie sie mir die Hand reicht.
»Gwyn.«
Ihre Finger schweben zwischen uns. Ich mache keinerlei Anstalten, sie zu ergreifen.
Sean rollt übertrieben mit den Augen. »Das ist Ia–«
»Kilian«, unterbreche ich ihn.
Überrascht zieht er bei meinem ganzen Namen Luft in die Lungen, fängt sich aber schnell wieder.
»Was treibt dich in die Stadt, Gwyn?«, überspielt er, was gerade passiert ist.
»Urlaub.«
»Zu dieser Jahreszeit?«
Nicht zu unrecht. Die Saison für Besucher ist längst vorbei. Statt Sonne und Strand stehen Regen und Nebel auf dem Plan.
»Ließ sich nicht anders einrichten«, erklärt Gwyn knapp.
»Hat überhaupt noch eines der Hotels auf?«, richtet Sean sich an mich.
»Woher soll ich das wissen?«
»Ähm, weil du ein Bestandteil der Gemeinde bist?«
»Sicher.«
»Er ist eigentlich ganz handzahm. Also, in welchem Hotel wirst du unterkommen?«, wendet er sich wieder Gwyn zu.
»Darüber habe ich mir ehrlicherweise noch keine Gedanken gemacht.« Gwyn kratzt sich an der Schläfe und trinkt einen großen Schluck, um Zeit zu schinden. »Wie teuer sind die Hotels in der Gegend denn so?«
»Das kommt auf deine Wünsche an«, sagt mein Bruder. »Wenn ein bisschen Hundegebell dich nicht aus der Ruhe bringt, hätte ich die perfekte Idee.«
Ehe ich einschreiten und den hinterlistigen Plan unterbinden kann, werden Gwyns Augen groß.
»Es ist preiswert und liegt an einem See. Idylle, aber nicht einsam.«
Die Vorstellung von Wassermassen, die mal im Sonnen- und mal Mondlicht glänzen, scheint sie zu überzeugen. Interessiert lehnt Gwyn sich vor, die dunkle Mähne rutscht über ihre Ohrspitze und verdeckt ihr halbes Gesicht.
»Und zufällig ist unsere Granny die Vermieterin des kleinen Cottages.«
»Ein komplettes Cottage? Nicht bloß ein einzelnes Zimmer?«
»Mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Letztes Jahr hat das Dach geleckt und die Heizung funktioniert seit Monaten nur, wenn sie möchte.«
»Es gibt einen Kamin und das Dach ist längst geflickt worden. Ian, hör auf, ihr die Hütte mieszureden.«
Wie gern würde ich behaupten, nicht genau das zu beabsichtigen. Doch das tue ich. Im Gegensatz zu Sean habe ich nicht vergessen, dass wir Gwyn erst seit einer Viertelstunde kennen, sie seitdem einen Nervenzusammenbruch hatte und grundsätzlich kriminelle Züge in Bezug auf Bücher in sich trägt.
»Granny wird sich freuen, dich kennenzulernen.«
Sean reicht ihr den Arm. Zögerlich legt sie ihre zierliche Hand in seine Armbeuge und lässt sich von ihm zum Ausgang ziehen.
»Hey, du schuldest mir fünfzig Cent«, rufe ich ihnen hinterher.
Langsam dreht sie sich zu mir um, das Braun ihrer Iriden trifft mich und ihr Kopf wandert in Schieflage. Ein Lächeln verengt ihre Augen, aber diesmal umgeben von kleinen Lachfältchen.
»Und du mir ein Stück Kuchen.«
***
»Du machst deine Übungen entweder falsch oder gar nicht«, seufzt Tom und hilft mir in eine sitzende Position.
Der winzige Behandlungsraum in den Kellerräumen des Stadions, in dem vor allem Minuspunkte eingefahren werden, stinkt nach abgestandener Luft, Schweiß und Desinfektionsmittel. Gleich wird die Mischung von Zedernholz und Mandel dazukommen. Sobald ein Tropfen Öl aus dem Flaschenhals auf mein Bein tropft, wird es den Raum beherrschen und ich brauche mindestens eine halbe Stunde unter dem heißen Wasserstrahl, um den Geruch von Toms Allheilmittel auszulöschen.
»Ich mache die Übungen, sofern ich Zeit habe.«
»Was bedeutet, dass du sie nicht machst.«
»So wollte ich es nicht ausdrücken«, entgegne ich trocken.
»Ian, diese ›Hausaufgaben‹ sind wichtig. Anders wirst du …«
Das letzte bisschen Mobilität verlieren, die meinem Bein geblieben ist. Das minimale Beugen und die Kunst, für eine Weile ohne Stock zu stehen.
»Versprich mir, dass du die Trainingseinheiten machst, die ich dir zeige. Du kannst ein Stück Leben zurückgewinnen, du musst dich nur ‒«
»Wenn du mir jetzt sagst, dass ich mich nur anstrengen muss, um wie der Rest des Dorfes durch die Gegend zu hüpfen und Regenbogen zu kotzen, kündige ich dich«, unterbreche ich ihn hart.
»Wen stellst du stattdessen ein? Ich bin der einzige Physiotherapeut, den es weit und breit gibt.« Er steht auf und klopft mir auf die Schulter. »Und ich bin dein Freund, ob du es willst oder nicht.«
Ich grummele leise vor mich hin, lasse mich von ihm auf die Liege drücken und starre statt seinem Gesicht die Neonröhren an.
Wie prophezeit, hüllt uns der penetrante Waldgeruch innerhalb von Sekunden ein und ich schließe die Augen.
Tom arbeitet präzise. Ohne den Ausdruck, der sich auf jedes Gesicht schleicht, das meinen Narben ausgesetzt war.
In der Theorie weiß der gesamte Küstenort, dass diese Narben existieren. Sie alle sehen den Stock. Die Inkompetenz, einen geraden Schritt zu tun, ohne zur Seite wegzukippen und mit dem gesunden Bein das kranke ausgleichen zu wollen. Sie kennen die Geschichte, erinnern sich an das Blaulicht, die Fotos der Journalisten. Alle haben die Berichte gelesen und mich im Krankenhaus mit Blumen und Kuscheltieren überhäuft. Und trotzdem ist die Reaktion derer, die zufällig einen Blick auf das dunkle und wulstige Gewebe werfen konnten, immer gleich.
Zuerst sind sie schockiert, schlagen die Hände vors Gesicht, den Mund, aus dem ungewünschte Töne entweichen könnten, und drücken sich zu guter Letzt ein paar Tränen des Mitleids aus den Augenwinkeln, ehe sie zum angewiderten Abstand wandern.
Tom war schon bei unserer ersten Sitzung anders.
Nach Jahren mit den Physiotherapeuten im Krankenhaus habe ich die Nerven verloren und bin nicht mehr hingegangen. In dieser Zeit nahmen die Schmerzen zu und die Beweglichkeit ab.
Am Tiefpunkt traf ich auf Tom. Er sprach mich beim Einkaufen an und fragte, was mit meinem Bein sei. Ohne eine Antwort abzuwarten, ratterte er eine Liste an Übungen herunter, die mir helfen würden. Ich war bereit, ihm zu sagen, dass er sich zum Teufel scheren soll, doch er erstickte meinen Protest, weil er bereits auf dem Boden kniete und seine Hände an mein Knie gelegt hatte.
Zwanzig Minuten später konnte ich natürlich nach wie vor nicht richtig gehen, aber die Schmerzen waren weniger. Die Spannungen rund um die Kniescheibe waren vollkommen zunichtegemacht und so blieb Tom an meiner Seite.
Als Physiotherapeut und, wenn es nach ihm geht, auch als Freund.
»Wie man sich erzählt, hast du heute eine Frau mit einem Buch beworfen.«
Ich schrecke hoch, stemme mich auf die Ellbogen und sehe Toms amüsiertes Gesicht, dessen Aufmerksamkeit sich nach wie vor nicht von der Behandlung löst.
»Der Dorffunk funktioniert ja mal wieder einwandfrei. Aber es war kein Buch.« Keinem Buch würde ich die geknickten Ecken antun, die Gwyn ihrem Liebesroman angetan hat. »Es waren Taschentücher.«
»Warum beschmeißt du eine Frau mit Taschentüchern?«
»Weil Gwyn geweint hat«, antworte ich.
»Warum hat ›Gwyn‹ denn vor dir geweint? Warst du gemein zu ›Gwyn‹?«
Gwyn. Wenn das kein neues Futter für die nächsten als Weinabende verkleideten Lästereien ist.
»Wieso gehen eigentlich alle davon aus, dass ich der Grund war?« Resigniert sinke ich zurück in das Kunstleder und schirme mein Gesicht mit dem Unterarm von dem unangenehm grellen Licht ab.
»Könnte an deiner offenen Art liegen, Sonnenschein.«
»Hmm«, brumme ich.
»Sie soll recht hübsch sein«, fährt Tom fort und trifft einen verhärteten Muskel. Ich schlucke das gequälte Stöhnen runter und konzentriere mich auf seine Worte.
Gwyn ist nicht nur recht hübsch. Sie ist seit Jahren die Erste, bei der ich das dringende Bedürfnis hatte, den Stock loszuwerden. Ihn zu verbrennen und alle Übungen auszuführen, um laufen zu können.
Wie albern, was ein einziger Blick in ihr gerötetes Gesicht in mir auslöste. Eine völlig unerreichbare und bisher nie gewollte Vision eines menschlichen Wesens in meinem Leben.
»Sie wurde am Arm deines Bruders gesehen.«
»Er ist jung und darf tun und lassen, was er möchte«, spreche ich das laut aus, was mir automatisch einen Stich in die Brust versetzt. Albern, Kilian. Es ist albern.
»Für eine Rebellion ist es nie zu spät. Wann bist du jung und tust und lässt, was du möchtest?«
»Sobald ich durch die Gegend hüpfe und Regenbogen kotze.« ›Und das Ende eines Buches zuerst lese.‹
3. Kapitelgwyn
»Du bist nicht mehr in Dublin?«
»Nein«, bestätige ich zum fünften Mal.
Fiona hat es nicht gut aufgenommen, dass ich ohne ein Wort meine Sachen gepackt habe und abgehauen bin.
»Du bist in Cairn’s End. Dem Küstenort mit bunten Häusern, Fischern und keinem funktionierenden Netz?«
Zumindest den ersten und letzten Punkt zu Cairn’s End muss ich ohne Widerspruch hinnehmen. Die Häuser sind außen auffällig farbenfroh und das Netz ist angesichts meiner Position zwei Meter in der Höhe auf dem dicksten Ast der Tanne auch eher bescheiden.
»Was hast du dir nur dabei gedacht?«
»Meine Eltern haben sich hier kennengelernt«, erkläre ich. »Ich brauche einen Neustart.«
Ihre Antwort rauscht abgehackt durch den Hörer. Ich strecke den Arm über meinen Kopf. Noch höher zu klettern, kommt mir nicht wie eine kluge Idee vor. Nicht mit Höhenangst und einem bandagierten Knöchel.
»Abgesehen davon. Was ist mit deinem Studium? Und mit Emmet?«
Ich seufze leise und hoffe, dass die Verbindung nicht ausgerechnet diesen Laut zuverlässig überträgt. »Er wird über mich hinwegkommen«, sage ich.
Emmet ist ein netter Kerl. Zuvorkommend, sympathisch und lustig, aber der Funke ist nicht übergesprungen. Zumindest nicht auf mich. Bei ihm ist das eine andere Geschichte und ich habe sein Gesicht äußerst detailreich vor Augen, wie es sich verzog, als er mich küssen wollte und ich im letzten Moment den Kopf wegdrehte. Seine Lippen landeten auf meiner Wange und sein Selbstbewusstsein im Keller.
»Und das Studium abzubrechen, war nicht meine Entscheidung«, erinnere ich sie. »Ich wurde exmatrikuliert und das kurz vor dem Abschluss.«
»Ich habe dir gesagt, dass Feuer nicht dein Ding ist. Allerdings bin ich froh, dass du Mr Lerck angezündet hast und nicht dich.«
»Wie geht es ihm?« Die Reue hinterlässt einen bitteren Film auf meiner Zunge.
»Er war heute wieder da und hat gefragt, wo du bist. Er wusste nichts von dem Rausschmiss. Melde dich bei ihm. Sicher hilft er dir mit deinem Abschluss.«
»Hmm, vielleicht. Hör mal, Fi. Ich habe dich lieb, aber ich sitze auf einem Baum und die Sonne geht unter. Ich rufe morgen an und berichte dir von meinem supertollen neuen Job!«
»Warte, warum sitzt du auf einem Bau‒«
Ich lege auf und schiebe das Handy in die Hosentasche. Das mit dem Job war gelogen, das mit der untergehenden Sonne und der nahenden Dunkelheit nicht.
Vorsichtig hangle ich mich an den rutschigen Ästen zu Boden und atme erleichtert aus, als mir der leichte Schmerz durch den Knöchel jagt, kaum berühre ich die sichere Erde unter mir.
Grinsend stapfe ich auf das Cottage zu, das inmitten von Bäumen und direkt an einem See voller Frieden in die Höhe ragt.
Sean hat sein Versprechen gehalten. Er hat mich von der Buchhandlung – alle anderen Namen sind unverdient – direkt zu dem leer stehenden Cottage am Rand des riesigen Grundstücks seiner Granny gebracht. Zwischen Hundegebell und Händeschütteln trug Sean meine Sachen rein und drückte mir die Schlüssel in die Hand.
Auf die Frage, wie es mit der Bezahlung aussieht, hat er gelacht und gesagt, ich solle meinen Urlaub genießen und falls ich vorhabe, länger zu bleiben, erst einen Job suchen.
Das war’s. Er ist in seinen Pub gegangen, um ihn für die durstige Meute zu öffnen, und ließ mich mit seiner einundneunzigjährigen Granny allein.
Lore hat ungefähr so viele Hunde wie Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte. Okay, nicht ganz. Aber bei der Lautstärke, die sich selbst im Dickicht des angrenzenden Waldes nicht verliert, könnte man meinen, es seien mehr als sechsunddreißig Hunde.
Sechsunddreißig Hunde, die mal mit gutem Willen adoptiert wurden und irgendwann unerwünscht waren. Sie landeten bei Lore, die seit ihrem Eintritt in die Rente einen Gnadenhof für Hunde leitet.
Kaum zu glauben, dass Kilian mit dieser offenherzigen Person verwandt ist. Ich schüttele den Gedanken an das markante Gesicht mit dem eingehenden Grün ab und lande wieder bei der Frage, warum mich seine Augen so aus der Bahn werfen, wo Sean doch genau dieselbe Farbe inmitten der Lachfältchen ruhen hat.
Aber egal, wie sehr ich nach einer Antwort wühle, da ist bloß sein ernstes Gesicht, als er mich als Barbarin bezeichnete.
Barbarin …
Frau mit hervorragender Selbsteinschätzung würde ich es nennen.
Warme Luft empfängt mich im Cottage. Ich streife die zu großen Gummistiefel von den Füßen und schlüpfe aus dem gelben Regenmantel.
Während ich einen Topf mit Wasser auf den Herd stelle und warte, bis das Teewasser fertig ist, beobachte ich aus dem Fenster über der Spüle, wie die Sonne hinter den Wipfeln verschwindet. Kaum ist der rote Ball im dunklen Grün der Tannen verschwunden, läuft die Dunkelheit des Waldes in den Himmel. Wo eben noch wärmende Strahlen die Luft füllten, glänzen nun vereinzelt Sterne und die dünne Mondsichel wirft silbriges Licht auf die Veranda und das winzige Rasenstück, das zum See führt.
Ich gieße das heiße Wasser auf die getrockneten Minzblätter, die Lore mir vorhin gebracht hat, und schlurfe mit der Tasse in der Hand auf das bequeme Sofa vor dem offenen Kamin zu.
Darin knistert ein Feuer und ehe ich mich endgültig mit einem Buch hinsetze, werfe ich zwei Holzscheite hinein und hoffe, dass ich professioneller bin, als ich mich fühle. In Dublin mussten wir die Heizung hoch- und runterdrehen. Und nach meiner einschlägigen Erfahrung mit Mr Lerck behaupte ich, nicht sonderlich sicher mit Feuer umgehen zu können.
Ich kuschele mich unter die gestrickte Decke, die Sean mir aufs Auge gedrückt hat, ehe er zur Arbeit fuhr, und greife nach dem einzigen Buch, das es in meiner übereilten Packaktion in den Koffer geschafft hat.
Ein Liebesroman über eine Studentin, die ihr Leben in die Hand nimmt und nach Kanada auswandert, um dort festzustellen, dass sie das WG-Zimmer nicht ansatzweise für sich allein hat.
Nur merke ich nach einer Seite, dass mein Kopf nicht bereit für Ruhe ist.
Ich versuche es erneut und lese die Stelle von Regen und bunten Punkten, die an der Protagonistin vorüberziehen und sie erkennen lassen, dass sie es an einen Ort geschafft hat, von dem sie überzeugt war, ihn nie zu betreten.
Es soll mich ablenken. Aber alles, woran ich denke, ist Feuer und seine Folgen. Ich sehe Kilians strenge Augen, weil ich vorab wissen will, ob das Buch ein Happy End hat.
Was ich nicht sehe, ist Kanada. Ich nehme die Buchstaben wahr, aber die passenden Bilder wollen mich nicht entführen.
So sitze ich auch eine Stunde später vor der Überschrift, die in großen Lettern das erste Kapitel unter sich eröffnet, und blicke aus der großen Fensterfront hinaus in die Nacht.
Wenn ich die Augen zusammenkneife und mich anstrenge, erkenne ich den Nachthimmel, der sich auf dem stillen See spiegelt. Die Sterne tanzen auf der schwarzen Oberfläche und machen den Übergang zum Ufer, das wenige Meter von der Veranda entfernt liegt, sichtbar.
Von den übrigen Seiten schmiegt sich der Wald an das Gewässer und lässt am Tage die unterschiedlichsten Vögel ihre Flügel über der Idylle ausbreiten.
Ich lege den Kopf auf einem der flauschigen Kissen ab und meine Lider fallen flatternd zu.
Ein Fehler. Denn so blende ich die existierende farbige Welt um mich herum aus und tausche sie gegen die schwarz-weiße Version voller Selbstzweifel.
Mein Herzschlag beschleunigt sich. Meine Lunge pumpt schmerzhaft Sauerstoff in sich, erinnert sich daran, dass ich das zum Überleben brauche, und macht einfach weiter. Heftig, schnell und … Mir wird schwindelig. Ich stoße angestrengt die Luft in den Raum und spiele das ›Fünf-zu-Eins‹-Spiel.
Auf meiner Haut spüre ich die Wärme des Feuers, das weiche Kissen unter meiner feuchten Wange, das Salz auf den Lippen, die Decke über dem schmerzenden Knöchel und die spitzen Ecken des Buches in meinen Handballen.
Angestrengt schlucke ich und zwinge mich, die Augen wieder aufzuschlagen. Mit einem Blick auf die Uhr wäge ich innerlich ab, wie gut mir ein Besuch im Pub in meiner aktuellen Verfassung tun wird.
Sehr gut, beschließe ich und springe vom Sofa.
Mit dem altmodischen Strickpulli und den gelben Gummistiefeln sehe ich zwar deutlich nach Kaff, aber nicht ansatzweise nach einem Abend im Pub aus, weshalb ich in die Lederleggings schlüpfe und hoffe, dass sie das Outfit irgendwie rettet.
Meinen ersten Abend in Cairn’s End kann ich nicht einsam unter einer Kuscheldecke verbringen, auch wenn mir das Buch anklagend hinterherschaut. Vor allem, weil ich eine Leserille in den Rücken gekracht habe, ohne über die erste Seite hinausgekommen zu sein.
***
Seans Pub ist leicht zu finden. Zum einen, weil ich ihn heute Mittag im Hellen gesehen habe, und zum anderen, weil er die Menschen wie Motten mit dem warmen Licht anlockt, das durch die Scheiben auf den feuchten Asphalt fällt. Oh, und dem Chor, dessen Melodien durch die Straßen hallen und mich zielsicher zu dem einzigen Lebendigen leiten.
Mit einer Gruppe, die Fis Vermutung mit den Fischern bestätigt, werde ich von dem Geruch nach Bier und Hitze empfangen und steuere sofort die dunkle Theke an, auf der kleine Bierfässer stehen. Dahinter zapft Sean gerade zwei große Gläser an den goldenen Hähnen. Er schiebt sie schwungvoll dem Pärchen am äußeren Rand zu und wendet sich dann wieder an den Kellner. Sie tuscheln und er deutet in die Ecke direkt neben dem Eingang. Als seine Augen seinem Fingerzeig folgen und er mich dadurch entdeckt, erhellt sich sein Gesicht und er winkt mir.
Ich überwinde den Abstand, umrunde auf dem Weg den Chor, der ein letztes Lied ankündigt, und klettere auf den Barhocker.
»Gwyn«, begrüßt Sean mich. »Wie ich sehe, hat dich Cairn’s Ends Nachtleben auf die Straßen gelockt.«
»Du meinst das Nachtleben deines Pubs.«
Er grinst und zapft mir ebenfalls ein Bier, ehe ich ablehnen kann.
»Ein Wasser?«, frage ich lächelnd und schiebe das Bier mit Fingerspitzen zurück zu ihm.
Er nickt. Ohne einen nervigen Spruch, ich sei langweilig oder zu seriös für Alkohol. Nicht, wie meine Freunde es immer tun.
»Kommt sofort.« Er schöpft ein paar Eiswürfel aus der Kühlung und gibt sie in ein Glas. Kurz darauf landet es gefüllt mit Sprudel vor meiner Nase und Sean wirft eine Zitronenscheibe hinein. »Was führt dich in den schönsten Pub Cairn’s Ends?«
»Die Lust auf ein Wasser«, antworte ich und nippe zeitschindend an dem langweiligsten Getränk, das hier ausgeschenkt wird.
Sean stellt die Ellbogen auf der Theke ab und stützt das Kinn auf die locker gefalteten Hände. »Rede mit mir, schöne Fremde.«
Meine Augenbraue wandert in die Höhe. Die Lippen bereit, einen spitzen Kommentar abzugeben.
Aber sein Mund verzieht sich zu einem Grinsen. »Ich habe gehört, wie Ian dich Lady nannte.« Er seufzt. »Dachte, ich hätte es besser drauf, aber …«
»Bin ich weder eine Lady noch eine schöne Fremde.«
»Ersteres kann ich nicht beurteilen, das Zweite hingegen schon.« Er zwinkert mir zu und greift unter den Tresen. Als seine Hand wieder in meinem Sichtfeld auftaucht, umschließt sie eine Tafel Schokolade.
Er drückt sie mir in die Finger.
»Danke«, murmele ich und fummele an der Verpackung, bis die braune Köstlichkeit frei liegt.
»Du siehst aus, als könntest du es gebrauchen. Ist alles in Ordnung?«
Verschwunden sind der Humor und die Belustigung, die sein Gesicht weicher als das seines Bruders aussehen lassen. Wo bei Kilian kantige Züge sind, die seine Worte hart unterstreichen, ist Seans Mimik warm und offen. Argh, warum kann ich mich nicht auf den anwesenden Bruder konzentrieren?
»Hatte keine besonders tolle Zeit«, gestehe ich und fische die Zitronenscheibe aus dem Wasser. »Habe meinen Platz an der Uni verloren, nachdem ich einen Dozenten angezündet habe; dabei ist es doch auch irgendwie seine Schuld, wenn er sagt, ich solle ein neues Medium für mich entdecken, weil meine Bilder nach Asche schmecken.«
»Deine Bilder haben nach Asche geschmeckt?«
Ich nicke. »Er lebt die ›bildliche‹ Sprache. Tja, und als ich das Bild von Asche und schlecht schmeckenden Kunstwerken im Kopf hatte, dachte ich, warum nicht. Viele Künstler arbeiten mit Feuer und der Dozent wollte schließlich, dass ich meinen Horizont erweitere.« Ich beiße in die Zitrone und spüle den bitteren Geschmack mit dem restlichen Wasser herunter. »Vielleicht ist das jetzt Cairn’s Ends Aufgabe. Wer weiß?«
»Du bleibst länger?«, fragt er.
Schulterzuckend entgegne ich: »Mein Terminkalender gibt nicht gerade mit gefüllten Seiten an.«
Auf der einen Seite seines Gesichts hebt sich der Mundwinkel und ein schiefes Grinsen entsteht. Unwillkürlich drängt sich die Frage auf, ob sein Bruder zu so einem charmanten Ausdruck überhaupt in der Lage wäre.
»Kannst du einen Job gebrauchen?«
»Wenn du eine Idee hast, sage ich nicht Nein. Allerdings warne ich dich vor. Ich bin nicht sonderlich geschickt, was das Ende meiner Uni-Karriere beweist, und Kellnern könnte problematisch werden.«
»Keine Angst, ich habe im Moment mehr als genug Kellner, die ihren Job nicht ordentlich erledigen.« Wie zum Beweis richtet er sich auf, schnappt sich den triefenden Lappen aus der Spüle und wirft ihn über mich hinweg auf sein auserkorenes Ziel.
»Aisling, ich bezahle dich nicht für irgendwelche TikTok-Tänze! An die Arbeit!«
»Boah, Boss!«, quiekt eine helle Stimme und im nächsten Moment trifft mich etwas Nasses im Rücken.
»Aisling!«
»Sorry!« Ein aufgeregtes Mädchen mit blondem Lockenkopf taucht neben mir auf. Die Wangen leuchtend rot und vor den blauen Iriden schwimmen Tränen.
»Nicht schlimm«, sage ich sofort und schenke ihr ein aufmunterndes Lächeln. Was leider nur dazu führt, dass die erste Träne über verdunkelten Hintergrund läuft und am Kinn auf die nächste wartet, ehe sie gemeinsam auf das weiße Shirt fallen.
»Ehrlich, ich wollte den Boss treffen.«
»Was die Sache natürlich besser macht«, bemerkt Sean trocken und reicht Aisling ein Taschentuch. »Bin gleich wieder da.«
Kaum ist er um die nächste Ecke verschwunden, wende ich mich der jungen Kellnerin zu, die in einem ausgewachsenen Heulkrampf gefangen ist.
»Du hast einen TikTok-Kanal?« Ob ich wie ein weiblicher Boomer klinge?
Sie nickt schniefend, putzt sich im Anschluss geräuschvoll die Nase und klettert auf den freien Barhocker neben mir. »Ja, aber ich habe eben nur mit Tom gesprochen. Er war mein Physiotherapeut, nachdem ich mir das Bein gebrochen habe, und ich wollte ihm zeigen, dass ich wieder turne. Na ja, sobald wir einen neuen Trainer finden.«
Bei dem Gedanken an Bodenläufer sendet mein Knöchel eine heftige Erinnerung an mein fünfzehnjähriges Ich.
Ich lasse mir nichts anmerken und kämpfe um eine freundliche Miene. »Seit wann turnst du?«, frage ich, weil unser Gespräch sonst außer dem Lappen keinen anderen Aufhänger hat.
»Seit ich sechs bin. Ich möchte es in ein Sportstipendium schaffen, wenn ich in zwei Jahren mit der Schule fertig bin.« Sie hebt die Schultern und wischt sich die letzten Tränenreste von den Wangen. Aisling ist ein hübsches Mädchen, aber die Selbstzweifel, die sie mit sich trägt, erkennt jeder, der ihr Gesicht bloß mit dem Blick streift.
»Solltest du jemals Tipps brauchen, frag mich gern.«
Was zur Hölle, Gwyn. Wütend auf mich selbst greife ich nach dem Glas, merke zu spät, dass kein Wasser mehr drin ist, und schlucke stattdessen einen der halb geschmolzenen Eiswürfel.
»Tipps? Hast du mal geturnt?«, fragt sie aufgeregt.
Ich beiße auf das Eis und nicke.
»Cool, ich hätte eine Frage zum Arial, ich bekomme ihn nicht hin, weil ich nach der Radwend‒«
»Bekommt man hier zur Abwechslung mal was zu trinken?«, grölt eine Männerstimme weiter hinten im Pub.
Seufzend rutscht Aisling vom Hocker und fischt nach dem zerfledderten Block und dem bis auf die Mine runtergeschriebenen Bleistift. »Ich muss wieder an die Arbeit. Tut mir leid, dass ich dich getroffen habe … ähm …«
»Gwyn. Hat mich gefreut, Aisling.«
»Mich auch.« Sie winkt mir zum Abschied und hüpft auf den quengelnden Gast zu.
Ich wende mich nach vorn, das Lärmen der Bar im Rücken, und hoffe insgeheim, dass Aisling sich morgen nicht an das Angebot, ihr Tipps beim Turnen zu geben, erinnern wird. Eine Sache, die ich nie wieder in meinem Leben möchte, ist dieser Sport. Der Sport, der mal alles bedeutet hat und der mich zwei Jahre kostete, in denen ich mir eine neue Leidenschaft suchen musste.
»Hier.«
Unter Seans Stimme zucke ich zusammen.
»Es ist zwar eine Männergröße, aber es sollte dir passen.« Er reicht mir ein schwarzes T-Shirt mit dem Publogo.
»Und du hast echt keinen Job für mich?«, frage ich und ziehe mir den nassen Pulli an Ort und Stelle über den Kopf. Immerhin trage ich einen Sport-BH. In jedem Schwimmbad würde man mehr von mir sehen.
Sean beobachtet, wie ich das frische Shirt anziehe, und schüttelt leise lachend den Kopf.
»Nein, aber wir werden vielversprechenden Spaß bei deinem neuen Job haben.«
4. KapitelKilian
»Nein.«
»Stell dich nicht so an, Ian«, beschwert Sean sich und plumpst genervt aufs Sofa.
Erschrocken springt Sira auf, faucht ihn an und rollt sich anschließend auf dem Sessel direkt vor dem Kamin zusammen.
»Deine Katze mag mich nicht.«
»Wäre vermutlich anders, würdest du häufiger vorbeischauen«, gebe ich zu bedenken. Andererseits mag Sira niemanden ›wirklich‹. Mich findet sie okay. Weil ich das Geld für ihr überteuertes Futter verdiene und zweimal täglich den Dosenöffner spiele. Aber mögen? So heiß und innig? Nein. Ihr engster Freund ist die Couch, auf der Sean es sich bequem und ihr den Platz streitig macht.
Ich humpele zum freien Sessel ihm gegenüber und setze mich umständlich hin. Das Bein auf dem Schemel davor gelagert.
Die Physio macht mir zu schaffen. Mehr als üblich. Was eventuell daran liegt, dass ich zur Abwechslung Toms Befehl nachkomme und seit drei Tagen mein malträtiertes Bein mit den malträtierenden Übungen malträtiere. Und ich hasse jede einzelne Sekunde. Vor allem, wenn mir bewusst wird, ›warum‹ ich plötzlich mit Gummibändern und leichten Gewichten auf dem Boden sitze, den Zungen der Hunde ausweiche und schwitze, bis die Muskeln zittern.
Himmel, es ist so albern.
Alberner ist bloß der Vorschlag, den Sean neben einer Packung veganer Nuggets im Gepäck hatte.
»Ich arbeite, sobald du freihast, und andersherum«, verteidigt er sich.
Die dunklen Augenringe unterstützen sein Argument, dass das hier nicht ansatzweise seine Zeit ist.
»Du könntest zur Abwechslung mal in den Pub kommen und ‒«
»Und mich von meinen lieben Klassenkameraden daran erinnern lassen, dass es so gekommen ist, wie sie vermutet haben?«
»Gott, Ian. Nicht jeder wünscht dir die Hölle auf Erden.«
»Schöne Beschreibung meines Lebens.« Ich proste ihm mit dem langweiligen Minztee zu und verbrenne mir die Zunge, weil das Einschätzen von vergangenen Minuten nie meine Stärke war.
»So meinte ich das nicht, Großer«, murmelt Sean und reibt sich übers Gesicht. Jetzt, wo ich ihn näher betrachte, sind es nicht die Augenringe, die ihn müde wirken lassen. Um seine Augen hat er Falten bekommen, die zwar mit seinem Mund mitlachen, sich sonst aber voller Ernst in seine Haut gegraben haben.
Seufzend fahre ich mir durch die Haare. Da. Eine zweite Sache, die ich hasse. Ich hasse es, dass ich Sean provozieren muss. Ihn in den Frust zerre und ohne brüderliches Beisammensein wieder ausspucke. Verflucht. Er ist mein Bruder. Neben Lore die einzige Familie, die ich noch habe. Wir sind die Letzten, die übrig geblieben sind, und ich habe nichts Besseres zu tun, als ihn zu vergraulen. Den Abstand selbst zu schaffen, den der Rest sonst freiwillig wählt.
»Es tut mir leid«, gestehe ich kleinlaut. »Ich hatte eine harte Woche.«
»Ich weiß«, antwortet Sean leise. »Wie war die Physio?«
»Es wird schlimmer«, sage ich und tippe auf das Bein. »Die Behandlungsfehler machen sich langsam bemerkbar. Tom ist nicht zufrieden mit der Entwicklung.«
»Scheiße.« Bestürzt wandert sein Blick tiefer und ich habe das Bedürfnis, das steife Bein in der Mitte zu brechen und es anzuwinkeln, um wie ein ganz normaler Mensch zu sitzen.
»Es war doch klar, dass es so kommen würde«, wiegele ich ab und lenke seine Aufmerksamkeit wieder auf die obere Hälfte meines Körpers.
»Sie schulden dir mehr als das bisschen Schmerzensgeld«, flucht Sean. Cinder, einer meiner zwei Rollstuhlhunde, hebt unsicher den Kopf und Sean schaltet einen Gang runter. Gefasster fährt er fort. »Nur weil du mit einer Sache fest rechnen kannst, macht es den Inhalt nicht besser. Die Aussicht ist und bleibt scheiße, nur dass du die ganze Zeit diese dicken Wolken über dir schweben hast.«
Ja. Dass ich weiß, was passieren kann – passieren wird –, macht es nicht besser und die Fehler während der Operation weniger schlimm.