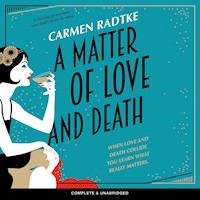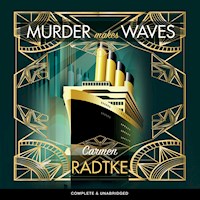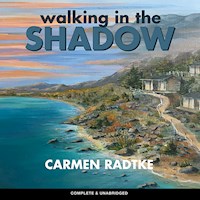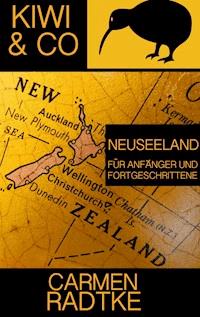
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Im Land der Kiwis, Schafe und Hobbits ticken die Uhren etwas anders. Wie kann ein Land am anderen Ende der Welt zur Heimat werden, wenn man sich eigentlich weiße Weihnachten wünscht, aber stattdessen am Strand picknickt? Die Tücken der Landpost, eingewanderter Wespen, Vergnügen mit Behörden und die Freuden des Schrubbens für den guten Zweck - die Journalistin Carmen Radtke hat sie alle erlebt und schildert sie augenzwinkernd in kurzen Episoden. Kiwis, Katzen, Kuchenbacken - Alltägliches wird zum Abenteuer, ein Buch, das den Leser mit nach Neuseeland nimmt und ihn das Land der weißen Wolke hautnah erleben lässt. Original Kiwi-Backrezepte inklusive!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Die Autorin
Auf geht es in das Land der großen weißen Wolke
So fern und doch so nah
Regeln, Gesetze und ein paar Tricks
Einfach tierisch
Integration für Anfänger, oder Die Kunst des Wartens
Postservice mit kleinen Tücken
Strandleben
Ohne Werkstatt geht es nicht
Der Lockruf des Geldes
Nur Neuankömmlinge mögen es heiß
Umzugsfieber
Gejammert wird nicht!
Gartenfreuden
Es weihnachtet kaum
Heimweh und andere Illusionen
Fernsehen ist gesundheitsschädlich
Das deutsche Netzwerk ist überall
Streicheleinheiten fürs Abendessen
Von Schafen, Schweinen und Katzen
Kunst an jeder Straßenecke
Vertrauen ist alles
Ein echtes Schönwettervolk
Reisefieber
Sport vereint die Kiwischaren
Überfluss und Mangelware
Vergnügen ist eine ernsthafte Angelegenheit
Küchenspaß auf Neuseeländisch
Von Zweibeinern und Vierbeinern
Alles hört auf mein Kommando
Jugendschutz der besonderen Art
Grün, grün, grün – mit Nebenwirkungen
Gesundheit ist ein teures Gut
Kiwis und Kiwis
Aus der Schule geplaudert
Die Erdbeben kommen
Abschied vom Land der großen weißen Wolke
Süße Rezepte aus dem Kiwi-Land
Leseprobe
The Case of the Missing Bride
A Matter of Love and Death
Danksagung
Impressum
Für meine Schwester Carola
DIE AUTORIN
Carmen Radtke ist gebürtige Hamburgerin, Journalistin und Schriftstellerin und hat mit ihrer Familie acht Jahre in Neuseeland verbracht.
Ihre Romane:
The Case of the Missing Bride
A Matter of Love and Death (unter dem Pseudonym Caron Albright)
1
AUF GEHT ES IN DAS LAND DER GROSSEN WEISSEN WOLKE
Draußen nebelt es an einem bitterkalten Februartag. Meine Mutter hat das Licht im Wohnzimmer angemacht, obwohl es erst 14 Uhr ist.
Meine Tochter malt ein Bild für Oma und ihre Tante.
Meine Mutter strahlt uns zufrieden an.
„Das sollten wir viel öfter machen, so einen Nachmittag mit der ganzen Familie. Ich sehe euch viel zu selten.”
Ich räuspere mich und wende wohlweislich meinen Blick ab. „Wir ziehen demnächst um.”
„Ah”, sagt meine Mutter. „Wohin denn? Ich habe ja immer gesagt, eine Großstadtwohnung im dritten Stock ist nichts mit Kleinkind.”
Meine Schwester sagt nichts, sondern reicht meiner Tochter einen Buntstift. Die Kleine malt eine Schnecke.
„Ins Grüne”, sage ich. „Wir ziehen ins Grüne. Und, ähm, etwas weiter weg.”
„Wohin?” fragt meine Schwester.
„Nach Neuseeland”, sage ich.
Meine Mutter verschüttet ihren Kaffee. „Ihr macht was?”
„Wir haben vor drei Wochen unser Visum bekommen. Die Wohnung ist zum Monatsende gekündigt, und die Flüge sind auch schon gebucht.”
„Ja, aber ...” Meine Mutter sieht mich flehend an. „Das könnt ihr doch nicht so plötzlich machen. Das geht doch nicht.”
Jetzt schlucke ich. „Ich wollte dich nicht aufregen, bevor wir das Visum noch nicht hatten.”
Dass wir ins Ungewisse aufbrechen, sage ich ihr nicht. Alles, worauf wir uns festgelegt haben, ist die Südinsel, vorzugsweise in oder um Christchurch, aber ich bin flexibel. Das Hotel ist für drei Nächte gebucht, danach für eine Woche ein Motel im Stadtteil Riccarton. Tochter und Enkelkind auf der anderen Seite der Welt ist schlimm genug, aber Tochter und Enkelkind obdachlos, das wäre zu viel für meine Mutter.
Meine Schwester sitzt mit weit aufgerissenen Augen da.
„Du hast doch immer gesagt, ich soll ins Ausland ziehen, damit du mich da besuchen kannst”, sage ich. „Und jetzt, wo ich nach der Elternzeit keinen Job mehr haben werde, ist die beste Gelegenheit. Vor allem, weil das Kind noch so klein ist.”
„Aber doch nicht Neuseeland”, sagt meine Schwester. „Das ist ja noch weiter weg als Australien. Ich hatte an England oder Irland gedacht, oder vielleicht Italien. Warum denn Neuseeland?”
„Warum nicht?” sage ich. „Weißt du, wie schwierig es war, die Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen?”
Zehn Monate lang mussten wir warten, um durch das Punktesystem weit genug nach vorne zu rücken und eine Einladung zum Interview in London zu bekommen. Zwei Stunden nach unserem Gespräch im New Zealand House klebten in unseren Reisepässen die begehrten Visa.
Meine Mutter stöhnt auf. „Ich werde euch nie wiedersehen, wenn ihr geht.”
„Neuseeland ist doch nicht aus der Welt”, sage ich. „Ich habe mich schon mit Leuten unterhalten, deren Eltern sogar mit 80 Jahren noch um die halbe Welt fliegen, um sie zu besuchen.”
Meine Mutter ist nie weiter als bis Österreich gekommen, aber das spreche ich nicht aus.
Überhaupt, wie soll ich das erklären? Für mich lautet die Frage nicht, warum, sondern warum nicht.
„Wir sehen uns bestimmt wieder”, sage ich. „Und es gibt ja auch Telefon.” Einen Computer hat meine Mutter nämlich auch nicht,
Meine Tochter malt eine Ente.
„Wann geht es los?” fragt meine Schwester.
„In acht Tagen”, sage ich.
Jetzt ist meiner Mutter endgültig der Appetit vergangen. Sie schiebt ihren Kuchenteller von sich.
Meine Schwester sieht mich zweifelnd an. „Wenn du dir sicher bist ...”
Ich bin mir sicher, vor allem, weil es keine endgültige Entscheidung sein muss. „Wenn es uns nicht gefällt, kommen wir wieder zurück”, sage ich bemüht fröhlich. „So einfach ist das. Und du besuchst mich.”
„Okay”, sagt meine Schwester. „Und du besuchst uns auch.”
„Klar”, sage ich. „Ihr werdet überhaupt noch eine Menge von mir erben, was ich nicht mitnehme. Und die Zeit vergeht so schnell, bis wir uns wiedersehen.”
Das Kind malt eine Maus. Mutters Unterlippe zittert, aber sie bemüht sich um ein Lächeln. „Soll ich zum Flughafen kommen?”
Ich schüttele den Kopf. „Das ist viel zu früh. Wir müssen um fünf Uhr morgens dasein.”
„Hast du denn wenigstens schon gepackt?” Sie nimmt meine Hand.
„Es ist fast alles fertig”, sage ich. „Wirklich, du musst dir keine Sorgen machen.” Ich schenke mir noch eine Tasse Kaffee ein, während ich im Geiste Abschied nehme von der Umgebung meiner Kindheit. Etwas schwer fällt es mir doch, vor allem der Abschied von den engsten Freunden, aber andererseits lockt die Fremde. Dass es schwierig und einsam werden kann, ist mir klar. Ich bin nicht naiv. Wir steuern mit offenen Augen ins neue Leben.
Meine Tochter malt eine Sonne.
2
SO FERN UND DOCH SO NAH
Das andere Ende der Welt müsste eigentlich exotischer sein. Weiter von Deutschland entfernt sind nur noch ein paar kleine Inseln. Und die Antarktis. Aber das einzige, was beweist, dass wir wirklich in Christchurch, Neuseeland, gelandet sind, um in der Fremde zu leben, sind ein paar seltsam gekleidete Männer. In Hamburg jedenfalls trifft man niemanden, der zu einem dicken Pullover und einer Wollmütze Shorts trägt und strumpflos in Sandalen herumläuft. Und auch hier, auf der Südinsel Neuseelands, scheinen diese Typen Ausnahmen zu sein. Schließlich kann sich sogar ein Vier-Millionen-Volk Exzentriker leisten.
Der Rest jedoch wirkt wie aus Westeuropa importiert – breite Fußwege und baumbestandene Alleen, Bäckereien mit hundert Sorten Körnerbrot, angeleinte Hunde, überall Blumenrabatten, die eifrig gegossen werden, ein leicht verständliches Englisch, das die Verständigung auch für nicht so Sprachbegabte relativ mühelos macht.
Vielleicht ist Neuseeland gerade deshalb seit Jahren unangefochtenes Auswanderungstraumland der Deutschen geworden, weil es gleichzeitig so fremd und so vertraut ist. Oder weil man so freundlich aufgenommen wird. Kein Achselzucken, keine hochgezogenen Augenbrauen, wenn wir sagen, dass wir länger bleiben wollen.
Im Gegenteil. „Oh, wie aufregend”, ist die Standardantwort. Und jeder nennt uns im gleichen Atemzug ein paar Deutsche, die er in Christchurch und Umgebung kennt. Damit wir kein Heimweh bekommen.
Auf unsere erste Deutsche stoßen wir dann aber per Zufall. Nach den drei Nächten im Hotel Grand Chancellor, dem höchsten kommerziellen Gebäude der Stadt und zukünftigem Erdbebenopfer, und dem Aufenthalt in einem Motel brauchen wir rasch eine dauerhafte Unterkunft. Makler rufen nicht zurück auf der (noch) deutschen Handynummer. Ich greife zur Zeitung und studiere die Kleinanzeigen.
Beim dritten Anruf habe ich Glück. Don ist am Apparat, das angebotene Haus ist noch frei, und wir können sofort vorbeikommen. Eine Stunde später sitzen wir bei Tina und Don auf der Terrasse. Tina ist etwas älter als ich und voller Enthusiasmus und Lebenshunger.
Don grinst vor sich hin. „Weißt du, woher Tina kommt?” Ich schüttele den Kopf. Definitiv nicht aus Neuseeland, das ist alles, was ich sagen kann.
„Berlin. Sie ist Berlinerin, du bist aus Hamburg, und ihr trefft euch in Christchurch.”
Das Haus ist groß, unmöbliert bis auf die für Neuseeland typischen eingebauten Schränke und wunderbar ruhig, gerade außerhalb der Stadt. Drei Tage später ziehen wir ein.
Don, der in Christchurch aufgewachsen ist, und Tina bleiben unsere guten Engel. Weil wir ein Auto brauchen und bei den Händlerpreisen kräftig schlucken, schickt uns Don zu einem Auktionator. Wagen angucken, Probefahrt machen, und am nächsten Tag das Fahrzeug ersteigern funktioniert mühelos.
Doch dann stehen wir mit fast leeren Händen da. Fahrzeugpapiere? Gibt es nicht. Ummelden? Ist ohne unser Zutun schon passiert. Das hoffen wir zumindest. Details zum Wagen? Na ja, wir kennen den Fahrzeugtyp, das Baujahr und die hiesige Abart der Fahrzeuggestellnummer. Um etwa herauszufinden, wie groß unser Geländewagen ist, damit wir nicht gleich im ersten Parkhaus hängen bleiben, müssen wir das Internet bemühen. Und zwar stundenlang.
Manchmal hat auch die deutsche Bürokratie ihre Vorteile ... Aber immerhin hat uns die komplette Autosuche ungefähr zwei Stunden gekostet.
Genauso lange dauert es, den Wagen zu versichern. Die Prozedur wird in unserem Fall für neuseeländische Verhältnisse enorm hinausgedehnt, weil wir unsere Prozente aus Deutschland anerkannt bekommen können, wenn wir dafür einen schriftlichen Nachweis haben.
„No worries”, null problemo, sagt Bryce von der Automobile Association. Und tatsächlich: Kaum haben wir die E-Mail von unserem deutschen Versicherungsmakler in der Hand, ist die Angelegenheit geregelt, und wir bekommen einen kräftigen Rabatt eingeräumt. No worries: Daran kann man sich gewöhnen. Auch wenn wir immer noch nicht wissen, wie das Autoradio ausgeschaltet wird.
3
REGELN, GESETZE UND EIN PAAR TRICKS
Nach vier Wochen als Auswanderer wird die Unstetigkeit doch etwas beschwerlich, vor allem, weil wir Tinas Haus nur sehr befristet mieten konnten – es ist bereits verkauft.
Zum Glück gibt es die Property Press. Weil die Käufer von Tinas Haus jeden Morgen zur Frühstückszeit auftauchen, um nur mal schnell ein paar Sachen in der 40 Quadratmeter großen Kombination aus Werkstatt und Garage unterzubringen und uns damit zum frühen Aufstehen zwingen, ziehen bei uns die ersten Wolken am Himmel auf.
Während mein Mann neidische Blicke auf besagte Garage wirft, werfe ich neidische Blicke auf die Immobilien in der wöchentlichen Zeitschrift rund um den Häusermarkt.
Glücklicherweise sind wir uns fast einig, was wir uns wünschen.
Ich möchte zunächst ein Haus mieten, in dem unsere Zweijährige Platz zum Spielen hat, mit Cafés, Spielplatz und Wasser in der Nähe. Mein Mann möchte ein Haus kaufen, weil die Preise seit Jahren kräftig steigen, mit möglichst keinen Nachbarn und einer großen Garage.
Also machen wir Teamarbeit. Ich kreuze Häuser an, er runzelt die Stirn, wir fahren an den Objekten vorbei, und er schüttelt den Kopf, bis er an einem Haus vorbeikommt, bei dem die Besichtigung gerade endet, die Maklerin aber gern bereit ist, uns nochmal durch das Haus zu führen. Und durch die Garage.
Danach ist sie aus unserem Leben kaum noch wegzudenken. Kaum stehe ich abends in der Küche, klingelt das Telefon. Ich komme tropfnass aus der Dusche, und es klingelt das Telefon. Ich bringe das Kind ins Bett, und es klingelt das Telefon. „Hallo, wie geht es”, ich hätte da was anzubieten, wollt ihr nicht morgen gucken kommen?”
Ich bin inzwischen zu fast jedem Kompromiss bereit, nur, um ihr zu entkommen. Also kaufen wir ein Haus in Leithfield, Nordcanterbury, eine halbe Autostunde von Christchurch entfernt. Möglich gemacht wird uns das mal wieder mit Tinas und Dons Hilfe.
Weil wir eine Hypothek aufnehmen müssen, und zwar schnell, schicken sie uns ihren Broker vorbei. „No worries”, sagt er gleich. Wahrend ich noch Kaffee koche, ist unser Fall so gut wie abgeschlossen.
Vier Wochen später können wir in unser neuseeländisches Eigenheim ziehen. Das heißt allerdings auch, dass wir erneut zwei Wochen überbrücken müssen.
„Kein Problem”, sagt Tina mit der für sie typischen Mischung aus Berliner Entschlossenheit und Kiwi-Optimismus. „Ich habe da ein paar Freunde, die eine Frühstückspension aufmachen wollen. Ich rufe gern für euch an.”
Und schon geht es zu Chris und Lin, die vor drei Jahren aus England gekommen sind, um näher bei den Enkelkindern zu sein.
Jetzt wohnen sie auf einem sogenannten Lifestyle-Block, einer Farm im Kleinformat. Vier Hektar Land genügen ihnen, um eine kleine Schafherde und drei Lamas zu halten – ein himmelweiter Unterschied zum britischen Stadtleben.
Eingewöhnt haben sie sich schon längst, auch wenn sie so machen Kulturschock erlebt haben. Der erste steht uns nun bevor, als zukünftigen Eigenheimbesitzern. War bisher alles fast unverschämt einfach, sollten wir uns nicht darauf verlassen, dass es alles so weitergeht.
Bürokratie gibt es nämlich auch in Neuseeland, und in immer stärkerem Maße.
Vor allem, was das Wohnen anbelangt, sind dem Erlaubten strenge Grenzen gesetzt. „Permit”, offizielle Erlaubnis, heißt das Zauberwort. Chris und Lin haben damit so ihre Erfahrungen gemacht, als sie ein Haus aus den 70er Jahren kauften. Vier Schlafzimmer, aber nur eine Toilette erschienen ihnen ein wenig verbesserungsbedürftig. Doch einfach ein Klo einbauen? Nicht ohne Genehmigung durch die örtliche Verwaltung. Die gab es dafür zwar fast problemlos für ein paar Dollar, doch merkwürdig erschien es Lin und Chris schon.
Jetzt möchten sie in eine Wand ein großes Fenster einsetzen.
„Ist das genehmigungspflichtig?” frage ich.
Chris zuckt die Achseln. „Vermutlich ja. Da muss ich halt erst bei der Verwaltung fragen.”
Die macht glücklicherweise vieles möglich. Und notfalls findet ein echter Kiwi (niemand, aber auch niemand außer Zugezogenen würde hier je von Neuseeländern sprechen) immer einen Weg. Natürlich streng innerhalb der Grenzen des Erlaubten.
Zum Beispiel der nette Techniker, der kurz nach unserem Einzug ins eigene Heim am Sonntag dafür sorgt, dass wir weiterhin als nette, saubere deutsche Familie gelten. Er taucht eine Stunde, nachdem ich unseren Stromversorger über eine tote Leitung zum Heißwassertank informiert habe, auf und winkt fröhlich mit seinem Stromprüfer. Der Fehler, ein defektes Relais, ist schnell gefunden.
Allerdings hat die Sache einen Haken: Das Relais liegt direkt hinter dem Hausanschluss. „Tut mir leid”, sagt er. „Aber da darf ich nichts reparieren. Gesetzliche Vorschriften. Das darf nur ein Elektriker.”
Ich fange an, wild mit den Augen zu rollen. Zwei Tage ohne heißes Wasser (so lange hatten wir selbst nach dem Fehler gesucht) können selbst den härtesten Pioniergeist auf die Probe stellen.
Er überlegt: „Wenn ich jetzt den Elektriker rufe, müssen Sie ihn bezahlen, weil Sonntag ist.” Ich schlucke.
„Oder ich probier mal etwas.” Er geht wieder zu dem ominösen Hausanschluss, holt sein Mobiltelefon heraus und unterhält sich kurz. Dann kommt er zurück. Fragen Sie mich nicht, was er genau gemacht hat, jedenfalls: Das Relais ist immer noch defekt, aber so kurz geschlossen, dass wir wieder heißes Wasser bekommen – perfekt für mich, gerade noch im Rahmen des Erlaubten für ihn, und ein Kinderspiel für den Elektriker, der uns durch Geräusche am Haus am Montag weckt.
Der hat sich nämlich ohne Umstände oder gar ein aufdringliches Klopfen an unserer Tür an die Arbeit gemacht und ein heiles Relais eingesetzt – keine Unterschrift, keine Erklärungen, gar nichts ist notwendig. Schließlich haben wir für den Heißwassertank ja eine offizielle Erlaubnis.
Ob der Rest für uns genauso leicht wird wie für Chris und Lin, müssen wir allerdings noch herausfinden. Wir wohnen nämlich inzwischen in einem Haus mit vier Schlafzimmern, aber nur einer Toilette, und hätten gern eine zweite dazu.
Aber wie gesagt, ohne Genehmigung läuft hier kein Umbau, Einbau und schon gar nichts, was mit Abwassern verbunden ist. Und ich möchte nicht mit Schimpf und Schande und in Handschellen ausgewiesen werden, weil ich illegal gespült habe.
4
EINFACH TIERISCH
Wie naiv kann man sein? Manchmal ist der unerschütterliche Optimismus meiner neuen Nachbarn schwer zu verstehen, genau wie das Vertrauen in liebgewordene Mythen.
Ich spaziere friedlich mit Tina durch ihren Garten. Sie plant bereits, welche von ihren Rosenstauden mit umziehen sollen und welche zurückbleiben. Don sitzt unter einem Apfelbaum. Bienen summen, Vögel zwitschern, und eine Wespe steuert auf mich zu. Ich zucke zusammen.
„Was ist?” fragt Don.
„Eine Wespe. Ich bin allergisch gegen Wespenstiche.”
Er lacht; ein überlegenes, tief aus dem Zwerchfell kommendes Lachen. „Du bist nicht mehr in Deutschland, Carmen.”
Vielen Dank, denke ich, das wäre mir gar nicht aufgefallen.
„Als ich mit Tina in Berlin war, wimmelte es von Wespen, aber das waren deutsche. Unsere Wespen sind viel harmloser. Sie stechen nicht, und selbst wenn sie stechen würden, sind sie nicht giftig.”
Zwei Minuten später betrachtet er mit ratloser Miene meinen rasch anschwellenden Oberarm. „Das verstehe ich nicht. Unsere Wespen stechen wirklich nicht.”
Tina kommt mit einer halbierten Zwiebel angerannt. „Das sollte helfen” sagt sie, als sie die Zwiebel über die Einstichstelle reibt. „Aber Don hat Recht, neuseeländische Wespen stechen nicht.” Inzwischen ist mein Arm extrem schmerzhaft, und ich kann ihn kaum beugen.
„Vielleicht solltest du doch in die Apotheke gehen?” sagt sie.
Der Angestellte in der Apotheke ist jung, hilfsbereit und mit meinem Fall überfordert. „Es sieht nach einer allergischen Reaktion aus”, sagt er nach einem Blick auf die kinderfaustgroße Schwellung. „Aber eigentlich kann das nicht sein. Neuseeländische Wespen stechen nicht. Und selbst wenn sie stechen sollten, sind sie nicht giftig.”
Ich nicke schwach.
Er kramt in den Antihistaminen herum. „Diese Salbe könnte helfen”, sagt er unschlüssig. „Aber eigentlich weiß ich nicht so recht. Unsere Wespen sind wirklich nicht giftig.”
„Möglicherweise ist sie per Schiff aus Australien gekommmen”, sage ich, mehr aus dem selbstsüchtigen Grund, ihn dazu zu bringen, mir die Salbe endlich zu geben, als um ihn zu beruhigen. Obwohl er sehr grüblerisch aussieht.
Seine Miene hellt sich auf. „Natürlich”, sagt er und öffnet schwungvoll die Kasse. „Giftige, aggressive Tiere. Typisch für Australien, so etwas.”
Er schüttelt sich leicht, als ich bezahle. „Zum Glück stechen unsere einheimischen Wespen nicht, und giftig sind sie auch nicht.”
Als ich mit immer noch geschwollenem Arm zu Tina zurückkehre und ihr die Geschichte erzähle, grinst sie.
Don hingegen nickt nur. „Darauf hätte ich selbst kommen müssen.” Er steht auf, um sich ein Glas Wasser aus der Küche zu holen.
Tina seufzt. „Das werde ich im nächsten Haus vermissen. Das Wasser ist überall in Neuseeland wunderbar, aber hier aus dieser Leitung kommt das beste Wasser der Welt. Ich wünschte, ich könnte es mitnehmen.”
„So gut?”
„Natürlich. Guck dich doch um, wie sauber und klar Flüsse und Seen sind, und erst die Gletscher am Milford Sund ...”
Ich korrigiere sie ungern, aber ich habe in der Zeitung etwas anderes gelesen. „Für Cheviot in Nordcanterbury haben sie die Anweisung verlängert, Trinkwasser abzukochen.”
„Ein Einzelfall”, sagt Don. „Nicht der Rede wert, und überhaupt stellen sich die Behörden bei so etwas immer übervorsichtig an.”
Ich denke an die Abwasserrohre, die an manchen Stellen ins Meer führen, an Schlachthöfe, deren flüssige Rückstände mit Sondergenehmigung direkt in den Fluss geleitet werden ... Auch in Neuseeland geht es um Geld und Sparmaßnahmen.
„Das ist alles nicht so schädlich, wie ihr Europäer immer denkt”, sagt Don. „Wirklich. Wir haben das sauberste Wasser der Welt, die intakteste Umwelt ...”
„Und ungiftige Wespen.”
„Genau. Du hast ja selbst festgestellt, dass das Tier, das dich gestochen hat, aus Australien gekommen sein muss. Die Wespe kam mir auch gleich ein bisschen groß vor.”
Ich gebe auf. Was erwarte ich auch von einem Mann, der mit dem felsenfesten Glauben an die Überlegenheit Neuseelands im Vergleich zum lauten, reichen und nach gängiger Meinung so viel gefährlicheren Australien aufgewachsen ist.
Verstehen kann ich das schon. Das giftigste Tier Neuseelands ist die White Tail Spider, eine kleine Spinne mit weißem Fleck auf dem Hinterleib, und auch ihr Biss ist nicht tödlich.
Während es in Australien von Giftspinnen, gefährlichen Schlangen und tödlichen Fischen wimmelt, sind die Kiwis stolz auf ihre fluglosen Vögel und die Insektenvielfalt. Das berühmteste Insekt ist die uralte Wespenabart Weta, nach der das durch Peter Jacksons Filme bekannt gewordene Animationsstudio in Wellington benannt ist. Die Biester sind riesig, aggressiv und relativ selten (obwohl mein Freund James, als er in der Badewanne saß und eine Weta vor sich sah, so laut geschrieen hat, dass er drei Tage vor lauter Heiserkeit fast stimmlos war – problematisch für einen Unidozenten).
Damit hat es sich aber auch. Säugetiere sind erst mit den Menschen nach Aotearoa, dem Land der großen weißen Wolke, gekommen. Wenn sich inzwischen auch einige, wie Possums, Kaninchen und Schweine, unkontrolliert vermehrt haben (25.000 frei lebende Schweine soll es inzwischen geben, und Schweinejagden sind beliebte Freizeitveranstaltungen), so sind sie doch verhältnismäßig harmlos.
Damit es so bleibt und nicht ungebetene Gäste das Land überfallen, sind die Biosicherheits-Maßnahmen auf dem Flughafen und auch in den Häfen rigoros. Obwohl, selbst bei der strengsten Überprüfung und gezieltem Einsatz von Chemikalien kann eine Wespe durchs Sicherheitsnetz fliegen. Eine andere Erklärung für meinen Arm, der erst nach zwei Wochen komplett abschwillt, gibt es nicht.
Das bestätigen mir auch ein halbes Dutzend Nachbarinnen im Playcentre, nachdem sie meine einhändigen Bemühungen beim Fußboden Wischen bemitleidet haben. Neuseeländische Wespen, sagen sie mir alle, stechen nicht, und wenn doch, sind sie sowieso nicht giftig.
5
INTEGRATION FÜR ANFÄNGER, ODER DIE KUNST DES WARTENS
Frei, das heißt allein – zumindest in der Anfangszeit. Nach sechs Wochen als Neu-Kiwis beschränkt sich mein soziales Umfeld noch immer auf Tina, den dunkelhaarigen Wirbelwind aus Berlin, ihren tatkräftigen Partner, der sich gerade als Handyman selbstständig macht, und Chris und Lin. Es wird Zeit für die Integration. Am besten geht das als Hundebesitzer (nicht umsonst gelten Vierbeiner als Flirthilfe im Park) oder, wenn man wie ich keinen Hund hat, mit Hilfe eines Kindes.
Direkt um die Ecke ist ein Playcentre, eine von Eltern geleitete offizielle Spielgruppe. Willkommen ist jeder, der bereit ist, mit