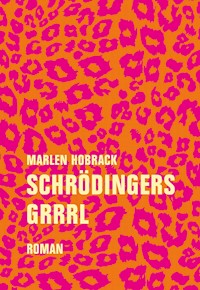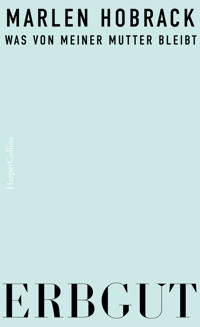6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclam 100 Seiten
- Sprache: Deutsch
Das Debattenthema unserer Gegenwart »Klassismus hat für die Mittelklasse eine Funktion, ist Mittel zum Zweck: Klassistische Erzählungen von der Faulheit und Dummheit der Armen legitimieren deren schlechte Behandlung.« Die Herkunft unserer Eltern hat in Deutschland immer noch viel zu großen Einfluss darauf, auf welche Schule wir gehen und wie viel Geld wir verdienen. Wie kann es sein, dass Klassismus ausgerechnet im Heimatland von Karl Marx eine so große Rolle spielt? Und wie könnte eine gerechtere Gesellschaft aussehen? Die Journalistin und Schriftstellerin Marlen Hobrack geht diesen schwierigen Fragen mit Verve und Humor auf den Grund.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Marlen Hobrack
Klassismus. 100 Seiten
Reclam
Für mehr Informationen zur 100-Seiten-Reihe:
reclam.de/100Seiten
2024 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH nach einem Konzept von zero-media.net
Infografik: annodare GmbH, Agentur für Marketing
Bildnachweis: siehe Anhang; Autorinnenfoto: © Marcus Engler
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962233-0
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020714-7
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Wrestling und Eistorte
Welche Klasse darf’s denn sein?
Klassismus ohne Klassenkampf?
Check your Habitus
Von den ›Anderen‹ erzählen
Klassismus, aber anders
Schluss – und Ausblick
Lektüretipps
Bildnachweis
Zur Autorin
Über dieses Buch
Leseprobe aus Feminismus. 100 Seiten
Wrestling und Eistorte
»Gib’s ihm, gib’s ihm, hau drauf!« Meine Mutter ist in Rage. Sie ist nun kurz davor, vom Sofa aufzuspringen, ihr ganzer Körper wirkt angespannt. So wütend habe ich sie selten gesehen. Ich starre gebannt auf den Fernseher; die Wut meiner Mutter teile ich nicht, dafür die Faszination für das Spektakel der sich prügelnden Männer. Wir schauen Wrestling, es ist unser gemeinsames abendliches Ritual.
Ich stecke ein großes Stück Eistorte in den Mund, lasse den cremig-zarten Geschmack des mit Schokolade ummantelten Vanillekerns auf meiner Zunge zergehen. Eigentlich müsste ich längst im Bett sein. Ich bin Grundschülerin, es ist schon nach 10 Uhr.
Wie ein klassistisches Klischee wirkt diese Szene vor dem heimischen Fernseher: Das mit Süßigkeiten vollgestopfte Kind schaut fern, statt zu schlafen, um an nächsten Tag in der Schule konzentriert lernen zu können. Was für Eltern betrachten ein Gewaltspektakel mit ihren Kindern? Da muss man sich doch nicht wundern, wenn nichts aus diesen Kindern wird! Doch was heißt eigentlich ›Klassismus‹ oder ›klassistisch‹? Seit ein paar Jahren geistert der Begriff durch Beiträge oder Kommentarspalten und ziert immer häufiger Buchtitel.
Klassismus ist die Benachteiligung oder Abwertung einer Person aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit, so lautet die einfachste Definition des Begriffes, die man sogleich erklären und ausführen muss. Denn die Benachteiligung kann in Form von Ausgrenzung, Beleidigung, abwertenden Kommentaren oder abschätzigen Blicken in Erscheinung treten. Sie kann äußere Merkmale wie Kleidung, Frisur, sogar den Namen einer Person betreffen. Sie kann von Einzelnen ausgehen und sich gegen Einzelne richten sowie strukturell bedingt sein und systematisch erfolgen. Klassismus lässt sich in diesem Sinne analog zu den Begriffen ›Sexismus‹ und ›Rassismus‹ deuten: Auch dabei geht die Benachteiligung von wahrgenommenen äußerlichen Merkmalen aus – in diesem Fall Geschlecht und Hautfarbe.
Ausgrenzendes Verhalten kann in Form von kleinen Nadelstichen erfolgen – ein abschätziges Lächeln, wenn sich eine Frau im Meeting zu Wort meldet, ein besorgter Blick, wenn ein Schwarzer Mann einen Laden betrifft. Die Diskriminierung kann jedoch in einen größeren systemischen Zusammenhang eingebettet und mit massiven Gewalterfahrungen verbunden sein: Etwa, wenn man einem weiblichen Vergewaltigungsopfer keinen Glauben schenkt, weil man es für geldgierig oder rachsüchtig hält, oder wenn ein Schwarzer Mann eine Polizeikontrolle auf offener Straße nicht überlebt. Sie kann zudem rechtlich verankert sein: Das schlimmste Beispiel von Rassismus, der gesetzlich legitimiert wurde, ist die Sklaverei. Manche Aktivisten beschreiben Sklaverei zudem als extreme Form des Klassismus.
Ob man nun über Klassismus, Rassismus oder Sexismus spricht: Es geht nie nur um eine einzelne Beleidigung, eine einzelne Handlung, einen schiefen Blick oder – im schlimmsten Fall – einen Gewaltakt. Wer diese ›Ismen‹ anspricht und analysiert, wird solche Handlungen stets als Ausdruck einer Ideologie betrachten: Sie geschehen ja nicht zufällig, sondern sind Teil einer großen Erzählung, die etwas rechtfertigt. Frauen dürfen benachteiligt werden, so die sexistische Erzählung, weil sie grundsätzlich anders sind als Männer. Schwarze unterscheiden sich grundsätzlich von Weißen, so die Ideologie, die über Jahrhunderte Entrechtung und Versklavung rechtfertigte. Und Arbeiter und Arme sind schlicht weniger klug und weniger leistungsfähig, weswegen es okay ist, wenn sie prekär leben oder eine geringere Lebenserwartung haben.
Die allerwenigsten würden all das so offen aussprechen und benennen. Viele würden diesen Thesen sogar vehement widersprechen, weil sie sich falsch anfühlen oder beim Nachdenken als unmoralisch erscheinen. Und trotzdem hegen wir alle – und ich bin da keine Ausnahme – auf die eine oder andere Art klassistische, rassistische oder sexistische Vorurteile. Als Ideologie oder Narrativ darüber, wie Menschen (angeblich) sind, haben sie sich uns von Kindesbeinen an eingeprägt, man muss sie sozusagen bewusst verlernen. Dafür wird auch in deutschsprachigen Texten der Begriff ›Unlearning‹ verwendet. Er besagt, dass man sich bestimmter Ideologien bewusstwerden muss, um sie zu überwinden, aber selbst dann noch werden Vorurteile immer wieder unsere spontanen Entscheidungen beeinflussen. Es handelt sich um einen Prozess, in dem man sich selbst befragen muss, permanent.
Viele antiklassistische Autoren suggerieren, es gäbe eine Seite der Guten – jene also, die in jedem Fall antiklassistisch denken und agieren –, und eine Seite der Bösen – jene, die Klassismus bewusst instrumentalisieren oder einfach hemmungslos ausleben. Ich glaube, die Sache ist komplexer. Selbst Menschen, die feministisch denken und handeln wollen, verfallen in Klassismen, wenn sie über Frauen der Arbeiterklasse sprechen. Auch Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sind bisweilen blind für ihren Klassismus gegen weiße Männer der Arbeiterklasse, weil sie diese nur als »privilegierte Subjekte« lesen können. Klassismus ist nicht einfach das, was die anderen, womöglich »die da oben«, erzeugen oder für ihre Zwecke nutzen. Er steckt vielmehr in uns allen.
Wissen ist nicht neutral, es wird produziert. Das Wissen darüber, wie die Welt beschaffen ist und warum sie so beschaffen ist, wird nicht im luftleeren oder ideologiefreien Raum erzeugt. Da wir immer in eine bestimmte Gesellschaftsform, eine Klasse oder ein Milieu hineingeboren werden, übernehmen wir zunächst unbewusst deren ›Wissen‹ über die Wirklichkeit. Wissen wird auch ausgehandelt, korrigiert, neu interpretiert. Und das ist der Kern der Klassismuskritik und der Arbeit am Begriff: Ich muss zunächst einmal eine Definition oder ein Bild davon haben, was Klassismus ist – dann kann ich mein Wissen und meine Erfahrung damit abgleichen. Hoffentlich kann ich danach mein Weltwissen erweitern und eine neue Perspektive auf Dinge erlangen. Im besten Fall verstehe ich dann, dass es nicht nur darum geht, den Angehörigen einer anderen Klasse gegenüber nicht unhöflich zu sein – darum geht es sogar am wenigsten. Vielmehr gilt es, über Ideologie zu sprechen. Doch ich greife vor.
Obwohl das Wort Klassismus zur selben Zeit entstand wie jener des Sexismus, dauerte es insbesondere in Deutschland sehr lange, bis er an Bedeutung gewann. So neu ist der Begriff hierzulande, dass er erst seit Kurzem im Duden zu finden ist und von meinem Schreibprogramm permanent rot markiert wird. Ob ich vielleicht Klassizismus meine? (Klassismus ist keine Kunstepoche – so lautet der Name des antiklassistischen Kollektivs KIKK.)
Die zögerliche Durchsetzung des Begriffs mag damit zusammenhängen, dass zwar in den USA wegweisende feministische Autorinnen seit den 1970ern und 1980ern auf den Zusammenhang von Rassismus, Klassismus und Sexismus aufmerksam machten, die drei Vokabeln also stets im Verbund auftauchten, jedoch in Deutschland (und nicht nur hier) der Feminismus der Zweiten Welle ein Mittelschichtsphänomen war, weshalb die Bewegung Klassenfragen eher ignorierte. Das mag mit der Eigenwahrnehmung der Bundesrepublik als »nivellierte Mittelstandsgesellschaft« (Helmut Schelsky) zusammenhängen, in der man den Klassenaufstieg und -übertritt spätestens seit den 70er Jahren für möglich und die Klassenschranken für durchlässiger hielt. Obendrein ist die Wahrnehmung von Sexismus oder Rassismus in gewisser Weise »einfacher«. Die allermeisten haben einmal miterlebt, dass Menschen auf Basis ihrer Hautfarbe beleidigt wurden oder dass Frauen mit sexistischen Witzchen und Anzüglichkeiten konfrontiert wurden. Wir lesen von rassistischen Gewaltakten, und Frauen berichten von strukturellem Sexismus.
Der Klassenkonflikt scheint hingegen insbesondere in Deutschland mit seinem sozialen Sicherheitsnetz gut verborgen; man könnte auch sagen: Es wird besonders hart daran gearbeitet, ihn zu überdecken. Strukturelle Benachteiligung auf Basis der Klassenzugehörigkeit wird konsequent geleugnet im Mythos von der Leistungsbereitschaft, die sich lohnen wird. Wer sich anstrengt, wird es schaffen, heißt es dann, was wiederum impliziert, dass ein Arbeiter bei der Müllabfuhr oder eine Kassiererin sich schlicht nicht anstrengt? Höhere Bildung, die im Ausland oft sehr kostspielig ist, darf man in Deutschland weitgehend kostenfrei in Anspruch nehmen. Wer will da schon von Klassengesellschaft sprechen?
Doch der Klassenantagonismus codiert alle anderen Benachteiligungsformen über. Dass er im 21. Jahrhundert in anderer Form erscheint als im 19. oder 20. Jahrhundert heißt eben nicht, dass es ihn nicht mehr gibt. Man kann sich durchaus einen Kapitalismus denken, in dem es keinen Sexismus gibt, aber eben keinen, in dem es keine Klassen von Menschen gibt – es braucht die einen, die arbeiten, und die anderen, die Kapital besitzen und für sich arbeiten lassen können. Erneut greifeich vor.
Im Grunde ist Klassismus exakt so sichtbar wie Rassismus oder Sexismus, doch fehlte lange Zeit eben ein Terminus, um etwas, das man womöglich unbewusst wahrnimmt, konkret zu beschreiben, zur Sprache zu bringen. Das ist es, was die Afroamerikanerin bell hooks in ihrem Buch Die Bedeutung von Klasse (Where We Stand: Class Matters, 2000) schildert, wenn sie sagt, ihre Familie habe zwar von Rassismus gesprochen, aber Klasse als diskriminierenden Faktor übersehen. Bemerkenswert erscheint, dass hooks selbst in ihrem Buch den Begriff Klassismus praktisch nicht verwendet, dafür aber umso deutlicher die Benachteiligungsstrukturen illustriert. Gleichwohl bewegte sie sich in einem feministischen, aktivistischen Umfeld, in dem Klassismus und seine Effekte diskutiert wurden.
In Pierre Bourdieus Studie Die feinen Unterschiede (La distinction. Critique sociale du jugement, 1979), in der er die französische Klassengesellschaft beleuchtet, glänzt der Begriff Klassismus ebenfalls durch Abwesenheit. Bourdieu muss stattdessen auf die wenig elegante Begriffsbildung »Klassen-Rassismus« zurückgreifen. Doch zeugt die Analogiebildung des französischen Soziologen immerhin von der Bedeutung, die er der Abwertung anhand von Klasse zuschreibt. Sie ist Ausgrenzung und Gewalt, sie ist Teil einer Ideologie.
Wer aufmerksam beobachtet, zuhört und liest, kann überall Beispiele für Klassismus entdecken. In Fernsehsendungen ebenso wie in Feuilletontexten. In Filmen wie in Universitätsseminaren. Insofern gibt es kein Problem der Sichtbarkeit, wohl aber eines des Bewusstseins. Während sich heute die akademisch gebildete Mittelschicht gerade darüber definiert, dass sie Rassismus und Sexismus ablehnt (was keineswegs heißt, dass sie nie rassistisch oder sexistisch handelt und denkt), scheint ein Teil derselben in diesem Land geradezu stolz zu sein auf ihre klassistischen Klischees, die sie unter keinen Umständen hinterfragt sehen will.
Das illustriert eine Kolumne Jan Fleischhauers mit dem Titel »Wer diesen Satz lesen kann, hat gute Eltern«. In der Kolumne soll es um die »neue Klassengesellschaft« gehen, um die Bildungsungerechtigkeit im deutschen Schulsystem. Ausgangspunkt ist eine Studie, wonach ein Fünftel der Grundschüler am Ende der vierten Klasse nicht ausreichend gut lesen kann. Fleischhauer nimmt diesen Befund nicht zum Anlass, über strukturelle Benachteiligung, die Güte des deutschen Schulsystems oder die Frage der frühkindlichen Förderung in Kitas nachzudenken. Stattdessen liefert er ein Bilderbuchbeispiel für klassistische Beleidigungen:
»Dass der Arme manchmal vielleicht auch deshalb arm ist, weil er faul ist oder vom Alkohol verblödet, ist ein Gedanke, der in unserer auf sozialen Ausgleich bedachten Gesellschaft als so anstößig gilt, dass er nicht zugelassen werden darf.«
Arm, faul, verblödet – so sieht es eben aus in der deutschen »Unterschicht«, der »Armutsklasse«, und es braucht schon einen aufrechten Journalisten, um der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten, der die Wahrheit zeigt: dass die faulen, verblödeten Armen nicht zu retten sind, weder durch Geld noch durch bessere Schulen. Wer das Gegenteil behauptet, ist ein romantisierender Träumer.
Das Bemerkenswerte an dem Satz ist, dass er vorgibt, eine verschwiegene Wahrheit zu formulieren, sich also ehrlich zu machen, tatsächlich aber mit ideologischen Verschleierungen arbeitet. Dieser Satz offenbart eine Vielzahl von klischeebehafteten Annahmen und Vorstellungen, konstruiert »Wahrheiten« und »Zusammenhänge«, die keine sind. Was bedeutet etwa »faul«? Ist eine Alleinerziehende, die drei Kinder versorgt, arbeitet und ergänzend Bürgergeld bezieht, faul? Ist ein Arbeiter, der in einer strukturschwachen Region lebt und keinen Job mehr findet, faul? Und selbst wenn es Arme gibt, die faul sind: Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Faulheit der Armen und dem Lesenlernen der Kinder in der Schule?
Mag sein, dass Alkoholkonsum »verblödet«, aber tut er das bei Angehörigen der Mittelschicht nicht ebenso? Studien zufolge wird in den Mittelschichten Europas mehr Alkohol konsumiert als in der von Fleischhauer geschmähten Armutsklasse. Wenn Alkoholkonsum – auf welcher Basis auch immer – die Lesefähigkeit von Kindern beeinflusst, so müsste dies umso stärker für die Mittelschichten gelten.
An Fleischhauers Satz ist also nichts faktisch wahr, trotzdem glaube ich, dass viele Leser nach der Lektüre fröhlich nicken: Endlich hat es einer gewagt, die Wahrheit zu benennen! Auf solche »Wahrheiten«, die der Mittelklasse ein gutes Gefühl bereiten, werde ich in diesem Buch häufig zurückkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Text, der in ähnlicher Offenheit rassistisch oder sexistisch gewesen wäre, die Qualitätskontrolle beim SPIEGEL passiert hätte. Das gehört sich nicht, das gehört nicht zum guten Ton. Doch mit den Armen kann man es machen.
Klassismus hat für die Mittelklasse eine Funktion, ist Mittel zum Zweck: Klassistische Erzählungen von der Faulheit und Dummheit der Armen legitimieren deren schlechte Behandlung. Wenn den Armen ohnehin nicht zu helfen ist, muss man gar nichts mehr umverteilen und die hart arbeitenden Mittelklassen »schröpfen«. Man muss nicht einmal mehr Mitleid mit den Armen haben, denn ihre Klassenzugehörigkeit ist beinahe naturgegeben. Man hat schließlich auch kein Mitleid mit Nashörnern, weil sie nicht fliegen können.
Mit anderen Worten: Erzählungen über Arme, über »Asoziale«, über einfache, ungelernte Arbeiter und prekär Beschäftigte, die diesen jeweils die Schuld an der eigenen Misere geben, stabilisieren das System. Sie haben eine Rechtfertigungsfunktion. Sie erklären die großen, himmelschreienden Unterschiede. Sie entlasten die Mittelklasse und jene Klasse der Reichen, die von der Armut unmittelbar profitieren. Man muss sich nicht schuldig fühlen – oder gar als Profiteur eines ungerechten Systems. Man muss sich nicht einmal schämen, weil man andere beleidigt und abwertet – schließlich ist man nur ehrlich.
Das ist nun harter Tobak. Geradezu Selbstkasteiung, wo ich doch der Mittelklasse angehöre. Es ist auch Kritik an meinen Peers, an meiner Filterblase. Kritik etwa an den Lehrern in meinem Umfeld, die die Kevins in ihrer Klasse für unbeschulbar halten, weil Kevin eben kein Name sei, sondern ein Syndrom. Selbst wer es nicht so laut und prominent ausspricht wie Fleischhauer, ist empfänglich für das Bild von der verblödeten, faulen »Unterklasse«.
Wussten Sie, dass es an der Universität Leipzig eine Namensberatungsstelle gibt? Eltern können sich in einer telefonischen Sprechstunde nicht nur über die Herkunft des ausgewählten Kindernamens beraten lassen; die Wissenschaftler versorgen die Eltern auch mit Daten zur Wahrnehmung der Namen durch andere.
Gabriele Rodríguez, die am Namenkundlichen Zentrum der Uni Leipzig arbeitet, hat ein Buch darüber geschrieben: Namen machen Leute: Wie Namen unser Leben beeinflussen. Im Klappentext dazu heißt es: »Namen wecken automatisch Assoziationen in uns, die wir mit einem Attribut verknüpfen – bewusst oder unbewusst. Das geht sogar so weit, dass Lehrer Kevin und Justin nicht nur weniger zutrauen als Alexander oder Maximilian, sie benoten sie mitunter auch schlechter. Und das bei gleicher Leistung. Aber woran liegt es, dass wir Menschen anhand ihres Namens beurteilen?« Womöglich lautet die Antwort: Klassismus. »Klara« klingt nach der hübschen Tochter eines Akademikerpaares. Welcher Schicht ordnen wir dagegen »Chantal« zu?