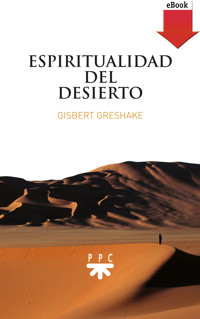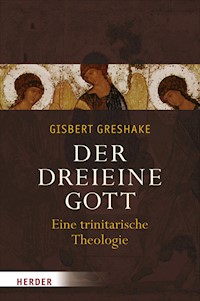Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Sechs unbekleidete Leichen mit zu formlosem Brei zertrümmerten Köpfen, ermordet durch eine Giftspritze - eine rätselhafte Abfolge der Tathergänge, und alle Spuren führen in den Vatikan. Vordergründig scheint es dabei um Kindesmissbrauch zu gehen. Doch dann eröffnen sich weitere Abgründe der menschlichen Seele. Und die Reaktion der kirchlichen Hierarchie: vertuschen und verheimlichen um des "Ansehens" der Kirche willen. Ein spannender Kirchenkrimi, zugleich ein Plädoyer für eine neue Form von Kirche jenseits von "ein Haus voll Glorie" weit über den Niederungen der Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gisbert Greshake
Kleine Fuge in g-moll
Ein Kirchenkrimi aus dem Vatikan
Gisbert Greshake
Kleine Fuge in g-moll
Ein Kirchenkrimi aus dem Vatikan
echter
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.
1. Auflage 2019
© 2019 Echter Verlag GmbH, Würzburg
Umschlag: wunderlichundweigand.de (Foto: © Stefano Termani-ni / shutterstock.com und © Fer Gregory / shutterstock.com)
Satz: Crossmediabureau
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
ISBN
978-3-429-05354-3
978-3-429-05025-2 (PDF)
978-3-429-06435-8 (ePub)
Vorbemerkung
Der vorliegende „Kirchenkrimi“ wurde schon vor mehr als zehn Jahren geschrieben und später unter dem Autoren-Pseudonym Roman Carus veröffentlicht, bisher aber nur an einige wenige Leser weitergegeben.
Angesichts der gegenwärtig wieder in die Öffentlichkeit getretenen Missbrauchsfälle in der Katholischen Kirche erhält der Roman eine ganz neue Aktualität. Er zeigt nämlich, dass die verbreitete Reaktion der kirchlichen Hierarchie auf diese Fälle, nämlich Vertuschen und Verheimlichen um des „Ansehens“ der Kirche willen, bereits vor mehr als einem Jahrzehnt von mir exakt so vorausgesehen wurde (siehe S. 36 f, 68 f). Deshalb erscheint der Roman nun unter meinem wirklichen Namen, um so auch persönlich dafür einzustehen, dass es mit der Ideologie von der Kirche „als Haus voll Glorie“, das „weit über alle Land“, sprich: weit über den Niederungen der Welt, steht, ein Ende haben muss und eine neue, auf S. 69ff angedeutete Sicht und Form der Kirche unbedingt erforderlich ist.
Inhalt
Vorspiel
Erstes KapitelIm Vatikan brennt’s
Zweites KapitelNichts passt hier zusammen
Drittes Kapitel –„Da waren’s jetzt schon sechs!“
Viertes KapitelMusik wird jählings abgebrochen
Fünftes KapitelEine kleine Fuge kommt groß heraus
Hinweise
Vorspiel
Samstag, 9. Oktober
„Und du bist ganz sicher, ganz, ganz sicher, dass da niemand im Haus ist und dass die Sicherheitsanlage wirklich nicht funktioniert?“ Die Frage war so leise geflüstert, dass Chicco sie trotz der nächtlichen Stille kaum verstand. Denn obwohl es soeben aus der Ferne von einigen Kirchtürmen zwei Uhr geschlagen hatte, konnte von einem „Schweigen der Nacht“ keine Rede sein. In Rom gab es ohnehin als ständige akustische Hintergrundkulisse das Rauschen einer nie abbrechenden Verkehrslawine. Hinzu kamen die typischen Nachtgeräusche einer Großstadt: Zuschlagen von Autotüren und Hochdrehen anfahrender Motoren, Geschimpfe und Geschreie von Streithähnen, Gekreische und Gestöhne von liebestrunkenen Paaren, gelegentlich auch einige Takte Musik, wenn Türen von Nachtclubs oder Diskos kurz geöffnet wurden.
„Was hast du gesagt?“, fragte Chicco zurück. Aber Pepe wiederholte die Frage nicht. Ihm war bewusst geworden, dass er sie schon oft, viel zu oft gestellt hatte und sein Spezi immer wütender darauf reagierte. Der empfand das ständige sorgenvolle Nachfragen als Kritik an seinen „strategischen Fähigkeiten“. Schließlich war er es, der alles gründlichst recherchiert und vorbereitet hatte; schließlich hatte er die Luxusvilla ausgemacht, die zwar keine völlig einsame Position hatte – wie sollte das in der Ewigen Stadt möglich sein? –, die aber doch durch ein paar Grünstreifen ringsherum und durch ihre Lage in einer Sackgasse äußerst isoliert war. Schließlich hatte er herausgebracht, dass sie nur von einem einzigen Mann bewohnt war, der vorgestern für ein paar Tage einen Urlaub angetreten hatte. Und das wusste Chicco nicht nur von Palli, einem ehemaligen Klassenkameraden, er hatte selbst aus gebührendem Abstand die Abfahrt des Villenbesitzers im vollbepackten Range Rover beobachtet. Von seinem früheren Schulfreund hatte er auch in Erfahrung gebracht, dass es im Haus keinen eigenen Hausmeister gab, denn diesen Job erledigte der gleiche Palli neben seiner Stelle am Institut sozusagen „mit der linken Hand“ mit. Auch das übrige Personal wohnte nicht im Haus, sondern kam stundenweise von außerhalb und verließ spätestens am Abend die Villa. All diese und andere Informationen hatte er über einen längeren Zeitraum so ganz „nebenher“ von Palli, den er regelmäßig „in der Szene“ traf, erfahren, ohne dass der auch nur im entferntesten ahnte, dass Chicco damit etwas anfangen wollte und dunkle Pläne schmiedete.
Alles in allem also: Ideale Verhältnisse! Natürlich wurde die Villa nachts regelmäßig von einer Wachfirma kontrolliert, und überdies war sie vom Keller bis zum Dach extrem alarmgesichert: Da gab es eine Unmenge von Bewegungsmeldern rings um das Haus. Alle Türen und Fenster hatten Sensoren, die durch eine Standleitung mit der größten Wachdienst-Firma Roms verbunden waren; diese konnte sich auch über verschiedene Nachtsichtkameras jederzeit über die momentane Sicherheitslage im Außenbereich der Villa informieren. Schließlich war der Besitzer ja nicht „irgendwer“.
Aber gerade in Sachen Sicherheit kannte Chicco sich hervorragend aus. Er hatte vor seinen ersten Straftaten – einigen Betrügereien und einem mittelschweren Einbruch – bei einer Wachdienst-Firma gearbeitet und sich dabei entsprechende Kenntnisse angeeignet, die er dann bei seinen Zellennachbarn im Knast, einem ausgesprochenen Sicherheitsfachmann, noch vertieft hatte. Im übrigen war er ein begeisterter Computer-Freak, der sich regelmäßig in Zeitschriften aus dem IT-Bereich über neuere Entwicklungen kundig machte. Vor nunmehr drei Tagen hatte er mit angeklebtem Oberlippenbart und leicht getönter Brille an der Villa vorgesprochen, an seinem schwarzen Wams das Logo der früheren Wachfirma, in der Hand einen Ausweis, eine überaus echt erscheinende Fotokopie seines früheren Dokuments. So legitimiert; erklärte er der Hausdame, er müsse kurz die Anschlüsse der Kameras überprüfen, da einige von ihnen keine brauchbaren Bilder mehr abgäben. Unter den kritischen Blicken dieser Dame machte er sich an der Zentrale des Sicherheitssystems zu schaffen, schaltete dieses aber beileibe nicht ab – das wäre ja spätestens am Abend aufgefallen –, sondern baute eine vorher präparierte Miniatur-Zeituhr ein, die in dieser Nacht ab 2 Uhr das ganze System abstellte.
Jetzt also war es so weit. Die Bewegungsmelder blieben tatsächlich ohne jede Reaktion, als sie den Vorgarten durchschritten. Das Öffnen der Tür war reine Routine. Nun hieß es, konzentriert zu arbeiten. Chicco hatte von Palli gehört und bei seinem kurzen „Besuch“ auch selbst bestätigt gefunden, dass die Villa äußerst luxuriös eingerichtet und mit Kunstwerken, kostbaren Teppichen und Möbeln aus dem Sei- und Settecento vollgestopft war. Aber weder er noch Pepe standen auf größere Gemälde, Holz- und Metallplastiken, Teppiche oder Mobiliar. Deren Transport war viel zu gefährlich, und bei den Verhandlungen mit dubiosen Kunsthändlern zog man immer den Kürzeren. Denn die wussten genau, dass Diebe bei Unzufriedenheit mit dem angebotenen Preis die einmal vorgeführten Sachen schon allein wegen ihrer Größe und ihres gefährlichen Transports normalerweise nicht wieder mitnahmen, um sie einem anderen Hehler zu präsentieren. Deswegen waren Chicco und Pepe nur an kleineren Pretiosen und Schmuckstücken, an Münz- oder Briefmarkensammlungen, an hochwertigen Kameras und – natürlich! – an Geld interessiert. Palli hatte einmal erzählt, in der Villa gäbe es einen Tresor von solchem Ausmaß, wie er ihn noch nirgendwo sonst gesehen hätte außer in Kriminalfilmen, wenn da gelegentlich große Tresorräume von Banken gezeigt würden. Chicco hatte nicht weiter gefragt, um keinen Verdacht zu erregen. Wenn der Tresor wirklich so groß war, würde man ihn auch finden, und irgendwas Brauchbares würde sicher drin sein.
Aber man fand ihn nicht, so sehr man auch suchte. Sie inspizierten alle Räume, öffneten Schränke und schoben sie beiseite, brachen die Holzverkleidung einiger Wände auf, schauten hinter riesige Wandgobelins und große Gemälde und hebelten sogar den elektrischen Schaltschrank weg. Alles vergebens!
Pepe griemelte hämisch: „Na, wo bleibt denn dein großer strategischer Wurf?“
„Chiudi il becco! (Halt dein Maul!)“, brüllte Chicco. „Porco Giuda! (Verdammte Scheiße!). Das Ding muss es doch geben. Schauen wir noch in den Keller. Wenn wir auch da nichts finden, brech’ ich dem Palli alle Rippen im Leib. Wir nehmen dann halt ein paar andere Kleinigkeiten mit.“
Doch siehe da! Neben der Kellertür befand sich eine weitere Tür, der innere Zugang zur Garage, der weit offen stand. Und durch diesen hindurch fiel der Blick auf die Seitenwand eines Tresors von wahrhaft gigantischen Ausmaßen: Er reichte vom Boden bis zur Decke, war über 1,50 m breit und ragte mindestens 80 Zentimeter aus der Wand, in die er hineingemauert war, heraus, so dass er insgesamt auch eine beträchtliche Tiefe haben musste. Jagdfieber ergriff die beiden Ganoven. In diesem Tresor musste doch wohl einiges zu holen sein! Und das Öffnen sollte dabei eigentlich keine allzu großen Schwierigkeiten machen.
Die Zeiten waren vorbei, in denen man mit Schweißbrennern arbeitete. Das machte zu viel Lärm und dauerte bei Tresoren dieser Größe, deren Stahlwände und -türen normalerweise auch eine außergewöhnliche Dicke aufwiesen, viel zu lange. Auch das Knacken der Schlösser mit Nachschlüsseln, Werkzeug und Stethoskop gehörte der Vergangenheit an, jedenfalls was die neuesten Tresore anging. Im Allgemeinen hatten die nämlich ein digitales Code-Schloss, d.h. sie waren durch die Eingabe eines fünf- oder sechsstelligen, jederzeit zu variierenden Codes zu öffnen, wobei die Eingabe am Tresor-Schloss selbst oder/und mithilfe einer Art „Fernbedienung“ zu geschehen hatte. Damit man aber den Code nicht durch systematisches Durchprobieren aller nur denkbaren Möglichkeiten herausfinden konnte (was bei einem sechsstelligen kombinierten Zahlen- und Buchstaben-Code die Zahl 366, eine elfstellige Ziffer, ergab, sodass das Durchprobieren ohnehin nur mithilfe eines Computers durchgeführt werden konnte), waren Zeitsperren eingebaut. Nach drei Fehlversuchen konnte man erst nach einigen Stunden oder sogar Tagen einen neuen Versuch machen. Doch seit einigen Monaten gab es ein neues, in Amerika entwickeltes und unter kleinen und großen Ganoven sogleich weltweit verbreitetes Software-Programm, das solche Sperren überwinden konnte, indem es dem programmierten Tresorschloss nach jeweils drei Fehlversuchen den Ablauf einer langen Zeitspanne „vorgaukelte“. Man brauchte jetzt also nur noch mittels Notebook, das mit einem kleinen Sender versehen war, die 366 Möglichkeiten mit einem kleinen Verzug nach je drei Versuchen automatisch durchgehen. Das dauerte etwa zwei Stunden, und schon war der Tresor geöffnet. Sollte allerdings der Code nicht nur aus Zahlen und Buchstaben, sondern auch aus Sonderzeichen bestehen oder sollte der Code gar achtstellig sein (was vermutlich jetzt noch nicht der Fall war, womit man aber in Zukunft nach weiterer Entwicklung des besagten neuen Software-Programms sicher zu rechnen hatte), konnte bei dann gegebenen 458 Möglichkeiten, d. h. einer vierzigstelligen Zahl der ganze Vorgang dann vielleicht auch Tage in Anspruch nehmen.
Pepe startete seinen Laptop. Beide machten sich auf eine längere Wartezeit gefasst. Doch bereits nach ungefähr 20 Minuten gab es einen leisen Knacks; der Computer hatte den richtigen Code offenbar schon erwischt. Mehr gierig als nur neugierig öffneten sie die Tür und wollten mit einer Taschenlampe den riesigen Stahlschrank ausleuchten, doch halt! … sie strauchelten beide wie auf Kommando zurück. Vor ihnen standen, an die Rückwand des Tresors gelehnt, zwei leblose menschliche Gestalten ohne Kopf, genauer: an Stelle der Köpfe sah man, in einer Art durchsichtiger Plastiktüte eingewickelt, einen absolut formlosen Brei aus Blut, Haut, Gehirnmasse, Knorpeln und Knochen. Ein grauenhafter Anblick, der bei beiden sofort einen grellen Schrei auslöste! In was war man da hineingeraten?
„Nichts wie weg!“, schrie Pepe. Aber ehe die zwei sich zur Flucht auch nur umwenden konnten, spürten sie als Letztes, bevor sie ihr Bewusstsein verloren, einen betäubenden Geruch …
Erstes KapitelIm Vatikan brennt’s
Sonntag, 17. Oktober bis Mittwoch, 20. Oktober
Vicequestore Dr. Teofrasto Bustamante (den Vornamen kannte allerdings kaum jemand, da seine Freunde ihn nur mit „Bu-Bu“ oder, wenn sie ein wenig witzeln wollten, mit „Vice“ anredeten) war ein gern gesehener Gast in jenen zahlreichen wissenschaftlichen Zirkeln und Clubs, kulturbeflissenen „Salons“ und politischen Konventikeln, die es in Rom in Unmengen gibt. Man schätzte ihn nicht nur wegen seiner außergewöhnlich hohen Bildung – immerhin hatte er ein komplettes Philosophie-, Theologie- und Jurastudium mit Auszeichnung absolviert –, sondern auch aufgrund seiner exponierten, einflussreichen Stellung. Er war Behördenleiter der Kontaktstelle zwischen Vatikanstaat und italienischer Justiz und als solcher mit allen sich zwischen Kirche und Staat überschneidenden rechtlichen Fragen und kriminellen Angelegenheiten befasst. Er unterstand direkt dem italienischen Justiz- bzw. – in bestimmten Fragen – auch dem Innenministerium. Im obersten Stockwerk des „Palazzo della Giustizia“ besaß er ein eigenes selbstständiges Ufficio (Dienststelle) mit herrlichem Blick über Rom. Eine Reihe von Angestellten und Beamten waren ihm zugeordnet. „Vicequestore“ war nur sein amtlicher Titel, der ihn vom „Questore“, dem Polizeipräsidenten von Rom, mit dem er nur gelegentlich zu tun hatte, unterschied. Im offiziellen Umgang wurde er als Onorevole Signor Questore angeredet.
Aber nicht nur hohe Bildung und vielseitige Kontakte zeichneten ihn aus, sondern auch das angenehme, gutmütige, ja geradezu „gemütliche Wesen“ eines typischen Pyknikers. Klein von Gestalt und wohlgenährt, wies er alle äußeren Merkmale auf, die Vertrauen einflößen: onkelhafte Manieren, warmherzige Stimme, ein wenig schmuddelige Kleidung, Fliege, Glatze, Oberlippenbart. Von dem her konnte man auf den ersten Blick den Eindruck von Harmlosigkeit und von eher unterentwickelten intellektuellen Fähigkeiten gewinnen. Aber dies war eine gewaltige Täuschung, auf die schon viele hereingefallen waren. Tatsächlich war Bustamante hochgescheit, ein ebenso tiefschürfender wie nüchterner Analytiker, der sowohl komplizierteste Rechtsprobleme wie auch schwierigste Kriminalfälle zu lösen verstand. Aber gerade weil er diese Fähigkeiten völlig zu verstecken wusste und stattdessen den Typ eines freundlich-mitfühlenden guten Nachbarn oder auch Stammtischkumpanen hervorkehrte, sah man ihn gern bei gesellschaftlichen Ereignissen, Veranstaltungen und „Salons“ als Gast.
Heute, am Sonntagabend, war er zu einem Clubabend bei Professor Ivan Pacelli, einem weitläufigen Verwandten (Urgroßneffen) des Pacelli-Papstes Pius‘ XII. und Lehrstuhlinhaber am Institut für Gerichtsmedizin des römischen Klinikums, eingeladen. Mit ihm hatte der Questore schon oft zusammengearbeitet, sehr erfolgreich sogar, auch wenn man den Professore genau so wie Bu-Bu ständig unterschätzte. Denn Pacelli war von fast zwergwüchsiger Gestalt mit einem viel zu langgezogenen Kopf, dessen Übermaß noch von riesigen, weit abstehenden Ohren und einem gewaltigen Backenbart unterstrichen wurde; dazu kam ein struppiger Haarwuchs, den ein in seinem Verlauf unklarer Poposcheitel auch nicht recht bändigen konnte. Kurz: Man war geneigt, Professor Pacelli eher für einen Komiker oder Clown als für einen hochkarätigen, auch international äußerst angesehenen Wissenschaftler zu halten.
Er lebte mit seiner Frau zusammen, die ein fast ebenso exzentrisches Aussehen hatte wie er selbst. Sie überragte ihn um anderthalb Kopflängen. Ihr bereits schlohweißes Haar war hinten zu einer „Glaubensfrucht“ zusammengebunden (so nannten man den vor allem bei deutschen Pietisten verbreiteten, überaus „sittsam“ wirkenden Nackenknoten). Sie war stets mit einer hochgeschlossenen weißen Bluse, über der irgendetwas „Fummeliges“, ein bunter Schal oder eine riesige Kette, hing, bekleidet; aber unter dem bis weit über die Knie hinabreichenden altmodischen Faltenrock ragte völlig stilwidrig eine speckige Jeanshose heraus, die in zwei unsäglich abgetragene Pantinen überging. Dazu trug sie zwei blechern aussehende Ohrringe, die fast bis auf die Schultern herabhingen und dadurch ihr Hörorgan nur auf andere Weise unterstrichen als die zum steten Lauschangriff ausgefahrenen Ohrmuscheln ihres Gatten. Vor ihrer Heirat war sie eine bekannte Atomphysikerin gewesen. Da sie aber Kinder haben wollten, gab sie ihren Beruf auf und kehrte auch dann nicht dahin zurück, als ihnen Kinder versagt blieben.
Vor einigen Jahren hatten Herr und Frau Pacelli einen „Club“ von Akademikern gegründet, der ursprünglich den Namen „Novità professioni accademiche“ (deutsch etwa „Neues aus Akademikerberufen“) trug, dann aber nur noch kurz als „Club novità“ bezeichnet wurde. Es gehörten dazu 20 bis 30 Akademiker aus unterschiedlichen Berufen, die sich in unregelmäßigen Abständen, im Schnitt aber monatlich und je abwechselnd in ihren Privatwohnungen trafen. Dort informierte dann jeweils ein Klubmitglied über die neuesten Entwicklungen in seinem Beruf, und nach einem kleinen Imbiss diskutierte man über das Gehörte.
Heute also waren Professor Pacelli und seine Frau Gastgeber. Obwohl Bustamante kein festes Mitglied weder dieses Clubs noch einer anderen ähnlichen Vereinigung war, nahm er nicht selten an derartigen Treffen teil, falls man ihn einlud und das Thema ihn interessierte. Und dies war heute wahrlich der Fall, da er in seinem Beruf immer wieder mit der Gerichtsmedizin zu tun hatte. Außer ihm waren noch gut zwölf andere Gäste gekommen. Einige davon waren ihm bekannt, von anderen hat er bisher nur gehört, so z. B. vom Philosophen Geraldo Monte, der sich an der „Sapienza“, der ersten römischen Universität, ganz auf der Linie der letzten Päpste gegen alle postmodernen Gedankenspielereien für die Grundlegung einer neuen Metaphysik einsetzte, während seine gleichfalls mitgekommene Frau führende Politikerin der Grünen und radikale Feministin war. Erstmalige Bekanntschaft machte Bu-Bu auch mit dem gegenwärtigen Star am Medizinerhimmel, mit Professor Andrea Fisichella, einem international führenden Neurochirurgen und Hirnforscher, der an der Gemelli-Klinik, einer römischen Dependance der Katholischen Universität von Mailand, arbeitete. Er war schon mehrfach für den Nobelpreis vorgeschlagen worden und fühlte sich, an seinem etwas arroganten Auftreten gemessen, wohl auch ziemlich sicher, ihn eines Tages zu bekommen. Er war unverheiratet und kam jetzt in Begleitung mit seinem Assistenten Dr. Davide Bonanni, einem noch relativ jungen Mann mit zelotenhaft stechendem Blick. Auch der Bu-Bu bisher noch nicht persönlich bekannte Soziologe Alberto Martinelli und Frau waren, allerdings mit reichlicher Verspätung, eingetroffen, so dass sie ihm vor dem bereits begonnenen Referat nicht mehr vorgestellt werden konnten. Martinelli sorgte bei den Soziologen für einige Furore, da er mit seiner normativen Gesellschaftstheorie gegen alle strukturalistischen und phänomenologischen Ansätzen polemisierte, aber auch zu der von Geraldo Monte konzipierten Metaphysik völlig quer stand.
„Eine äußerst bunte Gesellschaft!“, dachte Bustamante bei sich, vor allem, wenn man dazu noch die ihm bereits bekannten Club-Mitglieder aus dem theologisch-religionswissenschaftlichen, politischen, juristischen und technologischen Bereich in Betracht zog.
Sein Interesse an Professor Pacellis Referat hielt sich zunächst in Grenzen. Denn inhaltlich waren ihm die neuen Schwerpunkte und Herausforderungen der Gerichtsmedizin, die Pacelli behandelte, mehr oder minder bekannt.
Deshalb musterte er ein wenig gelangweilt die Gastgeberwohnung, die genau so exzentrisch war wie das Erscheinungsbild des Ehepaars Pacelli: Bald fühlte man sich angesichts der vielen Möbel aus Urgroßvaterzeiten in die Welt um 1910 zurückversetzt, bald wurde man an geschmacklos eingerichtete Wartezimmer moderner Zahnarztpraxen erinnert: schreckliche Neonleuchten als Lampen, billige Kunststoffsessel, unpraktische Glastische, Teppiche vom Wühltisch eines „UPIM“-Kaufhauses zur Zeit des Sommerschlussverkaufs.
Auch die Art und Weise, wie der Professore seinen Stoff darbot, gab Gelegenheit zur Ablenkung: Mit ausgefallenen Vergleichen und überraschenden bildhaften Wendungen sowie in einer durch und durch altmodischen Sprachform zeigte er minutiös auf, wie sich infolge der DNA-Analyse und präziserer Diagnose-Instrumentarien für die Gerichtsmedizin neue fruchtbare Möglichkeiten eröffneten, aber auch wie es wegen moderner, zunehmend raffinierter werdender Designer-Drogen und -gifte immer schwieriger wurde, verlässliche Auskünfte über Todesursache und -zeit zu geben.
„Der Witz des göttlichen Geschöpfes Mensch, ein anderes Geschöpf gleich edlen Ranges von hinnen ins Dannen der Ewigkeit befördern zu können und dies auch in die Tat umzusetzen, nimmt – Gott sei es geklagt! – immer mehr zu. Und dem kann die Gerichtsmedizin nur mit größerem Witz begegnen, mit ‚Aberwitz‘ sozusagen.“
Wie hätte mein Gymnasiallehrer für italienische Literatur wohl auf solche Formulierungen in einem Aufsatz von mir reagiert?, fragte sich der Questore. Aber dann wurde sein Interesse plötzlich hellwach. Denn Pacelli wollte jetzt gegen Schluss offensichtlich an zwei Fällen das bisher Ausgeführte konkretisieren. Diese beiden Fälle lagen zwar schon mehr als drei Jahre zurück, waren aber in den letzten Tagen wieder hochaktuell geworden.
Vor drei Jahren, als Pacelli noch am Gerichtsmedizinischen Institut des Klinikums in Mailand tätig war, entdeckte man im Naviglio Grande, einem der mittelalterlichen Kanäle, die sich durch die Hauptstadt der Lombardei ziehen – und zwar dort, wo dieser auf den Naviglio Pavese trifft, unweit des alten Hafenbeckens, der Darsena – zwei unbekleidete, grässlich zugerichtete männliche Leichen. Ihre Köpfe, bzw. das, was einmal Köpfe waren, steckten in einem durchsichtigen Plastikbeutel. Doch was sich in Wirklichkeit in diesen Beuteln befand, waren keine Köpfe mehr, sondern nur eine breiige Matsche von Blut, zerquetschter Gehirnmasse und total zerkleinerten Knorpeln und Knochenfragmenten. Es gab keinerlei feste Masse mehr. Um einen Kopf derart herzurichten, reichte es wohl kaum aus, ihn mit einem Vorschlaghammer oder sonst einem schweren Gegenstand zu bearbeiten, es musste eine Art überschweren Mörsers oder eine Dampfwalze oder eine Presse, wie man sie etwa zum Zerquetschen von Altautos benutzte, am Werk gewesen sein, so dass nichts, aber auch gar nichts mehr von der Gestalt eines Kopfes übrig geblieben war.
Zunächst fanden sich keinerlei Hinweise, die zur Identifizierung der Leichen hätten führen können. Da von deren Fingerkuppen die Haut und oberste Fleischschicht abgeschnitten waren, gab es nicht einmal die Chancen, über Fingerabdrücke herauszufinden, wer die Ermordeten waren. Und weil der Tod mindestens 36 Stunden zurücklag und weder in dieser Zeit noch in den folgenden zwei Wochen eine passende Vermisstenanzeige aufgegeben wurde, begnügte sich der gerichtsmedizinische Dienst der Squadra omicida (Mordkommission) von Mailand damit, die eigentliche Todesursache festzustellen. Und die war offensichtlich eine tödliche Dosis intravenös gespritzten Kaliumchlorids, wie sie auch in einigen Staaten der USA zum Vollzug der Todesstrafe angewandt wird. Man wollte schon die Leichen zur Beerdigung freigeben, da hörte Professor Pacelli von diesem Fall.
„ ‚Aufgeben gilt nicht!‘ Mit diesem Wort, das wir als Kinder immer hinausgejubelt haben, ermutigten wir uns stets aufs Neue zum Weitermachen. Und dieses kindprophetische Wort leuchtete auch mir jetzt auf dem Weg voran!,“ mit dieser verrückt-ausgefallenen Formulierung leitete er seine jetzt folgenden Schlussausführungen ein, bei denen er wie so oft mit den Armen mächtig herumschlackerte, so dass man den Eindruck gewann, dass deren Bewegungen mit der übrigen Körpermotorik nicht recht koordiniert waren.
Er berichtete, dass er der Mailänder Polizei angeboten habe, neue Untersuchungen anzustellen. Dafür scheute er sich nicht, den grässlichen Brei der zerschmetterten Köpfe Kubikzentimeter für Kubikzentimeter durchzugehen und fand auf diese Weise bei einem der Ermordeten Bruchteile einer aus einer Goldlegierung bestehenden Zahnbrücke. Solche Brücken werden normalerweise von den zahntechnischen Labors punziert, um damit Edelmetallanteil und Hersteller kenntlich zu machen. Mit einem entsprechenden Mikroskop fand Pacelli das stark lädierte Punz-Zeichen des Dentallabors und konnte es deutlich sichtbar machen. Der Rest war kriminalistische Routinearbeit.
Im zweiten Fall wiederholte sich natürlich der Glücksfall eines Zahnbrückenfundes nicht. Aber hier kam dem Gerichtsmediziner die damals relativ neue Methode der DNA-Analyse zupass. Zwar hatte diese schon seit 1988 ihre forensische Legitimation erhalten, aber bis dahin diente sie fast ausschließlich als „genetischer Fingerabdruck“, mit dessen Hilfe man eine ganze Reihe von Tätern entlarven konnte. Dieser Mailänder Fall war nun der erste in Italien, bei dem Pacelli die Identität des Opfers durch Vergleich mit den damals noch erst wenigen gespeicherten Proben in den Gen-Dateien nachweisen konnte.
Bei beiden Ermordeten ließ sich überdies zeigen, dass ihnen vor der tödlichen Spritze mit Kaliumchlorid starke Barbiturate verabreicht worden waren, und zwar vermutlich nicht auf einmal, sondern in verschiedenen „Portionen“.
All diese neuen Erkenntnisse Pacellis führten zwar nicht zum Mörder und dessen Tatmotiv, wohl aber zur Identifizierung der Ermordeten. Das Opfer mit der Zahnbrücke war ein kleiner alleinstehender und alleinarbeitender Ganove, der gerade aus mehrjähriger Haft entlassen worden war. Er hatte Mitglieder der High Society bei ihren Seitensprüngen heimlich verfolgt, Skandalfotos von ihnen geschossen und sie damit erpresst. Da sich bis zum Zeitpunkt, da sich einer der Erpressten zur Anzeige entschloss, wenigstens zwei Selbstmorde von Betroffenen ereignet hatten, erhielt er vom Gericht die Höchststrafe von fünf Jahren. Natürlich ging die Mailänder Kriminalpolizei davon aus, dass der Mörder im Kreis der Erpressten zu suchen sei, konnte aber niemandem auch nur das Geringste nachweisen.
Ähnlich verhielt es sich mit dem anderen, durch DNA-Analyse identifizierten Opfer: Es handelte sich um einen alleinstehenden, gleichfalls gerade aus langjähriger Haft entlassenen, mehrfach rückfällig gewordenen pädophilen Kinderschänder, der Kleinkinder zum Teil brutalst bis hin zum Tode missbraucht hatte. Auch hier recherchierte die Polizei im Familienkreis der betroffenen Kinder, fand aber trotz gründlichster Nachforschungen nicht den geringsten Anhaltspunkt für einen Täter.
„So hat“, schloss Pacelli seine Ausführungen, „die Gerichtsmedizin ihre Hausaufgaben ‚summa cum laude‘ erledigt. Ach, wäre es, – utinam!, würde der Lateiner sagen – mit der polizeilichen Aufklärungsarbeit ähnlich bestellt! Aber jetzt laden meine Frau und ich Sie alle zum kleinen Imbiss ein!“
Bevor jedoch der Applaus für das Referat beendet war und sich alle von den Plätzen erhoben, rief Professore Fisichella „Ohé, ohé!“ durch den Raum. „Ivan, wart‘ einen Moment! Wir waren ja vor drei Jahren in Mailand am gleichen Klinikum