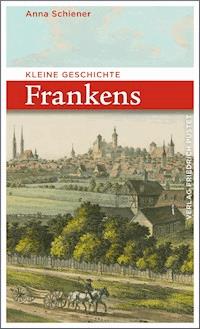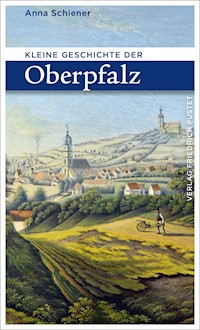
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Friedrich Pustet
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Bayerische Geschichte
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Spannend ist sie, die Geschichte der Oberpfalz, dieses Verbindungslandes zwischen Franken und Böhmen, mal Brücke, mal Endstation, je nach politischer Großwetterlage. Dies war Chance in guten und Bürde in schlechten Zeiten. Die höchst wechselvolle Geschichte des Landes um Donau, Naab und Regen hat viele historische Spuren hinterlassen. Burgen und Schlösser – nicht ohne Grund spricht man vom Burgenland Bayerns –, Kirchen und Klöster erzählen von den vielen Macht- und Herrschaftsträgern, von einem Mosaik verschiedener Territorien unterschiedlichster Größe in diesem oft umkämpften Grenz- und Durchgangsland.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Schiener
Kleine Geschichte der Oberpfalz
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
3., aktualisierte Auflage 2021© 2011 Verlag Friedrich Pustet, RegensburgGutenbergstraße 8 | 93051 RegensburgTel. 0941/920220 | [email protected]
ISBN 978-3-7917-3173-5Reihen-/Umschlaggestaltung und Layout: Martin Veicht, RegensburgSatz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. DonauDruck und Bindung: Friedrich Pustet, RegensburgPrinted in Germany 2021
eISBN 978-3-7917-6182-4 (epub)
Unser gesamtes Programm finden Sie im Webshop unterwww.verlag-pustet.de
Inhalt
Vorwort
Topografisches
Vulkane, Riffe, Alte Gebirge und ein märchenhafter Fluss
Verhinderte Vulkane: Rauher Kulm und Parkstein
Die Oberpfalz in prähistorischer Zeit
Jäger, Sammler, Ackerbauern
Die Feuersteinstraße
Der neue Werkstoff Bronze
Eine neue Epoche: Die Eisenzeit
Die Kelten
Das lange Mittelalter
Römer und Germanen
Massaker in Harting
Leute aus Böhmen
Ein geheimnisvoller Stamm: Die Bajuwaren
Die Agilolfinger
Frühes Christentum
Der Heilige Emmeram
Bistumsgründung und Klosterfrühling
Bayern und Slawen in der Oberpfalz
Die Oberpfalz wird fränkisch
Luitpoldinger und Schweinfurter
Schrazellöcher
Burgen, Grafen, Klöster
Eine Sulzbacherin in Konstantinopel
Die Wittelsbacher in der Oberpfalz
Der Weg zur Reichsstadt: Regensburg
Pons optimus, pons gloriosus: Die Steinerne Brücke
Ludwig der Bayer und Regensburg
Der Hausvertrag von Pavia
Vom bambergischen Dorf zur Hauptstadt der „heroberen Pfalz“: Amberg
Des Kaisers Land in Bayern: Karl IV. und Neuböhmen
Die Goldene Straße
Das „Ruhrgebiet“ des Mittelalters
Die „Große Hammereinung“ 1387
Amberg, Sulzbach und der Falzberg
Das Herzogtum Pfalz-Neumarkt
Pfalzgraf Johann und die Hussiten
Die Schlacht von Hiltersried
Otto I. und Otto „Mathematicus“
Der Landshuter Erbfolgekrieg und die „Junge Pfalz“
Zwischen Neumarkt und Amberg: Pfalzgraf Friedrich
Papst, Luther oder Calvin
Für Luther
Pfalzgraf Ottheinrich und die Reformation
Die Geliebte des Kaisers
Luther, Calvin oder „cuius regio, eius religio“
Das konfessionelle Verwirrspiel geht weiter
Die Calvinisierung der Oberen Pfalz
Von „fantasei“ und „aberglauben“ – Hexenverfolgung in der Oberpfalz
Die Erben Pfalz-Neuburgs
Die Obere Pfalz wird bayerisch …
Der Kanonier von Weidlwang
… und katholisch
Bücherverbrennung
Gegenreformation in Sulzbach
Auf dem Weg zur Souveränität
„Eine Heimstätte des freien Geistes“ – Der Sulzbacher Hof unter Christian August
Ein Absolutist in Sulzbach: Theodor Eustach
Der kurze Traum von der Macht
Der Weg ins neue Bayern
Ein ferner Landesherr: Karl Theodor
Das Armenhaus Bayerns
Noch einmal pfälzisch
„Kurier’ die Leut’ nach meiner Art“
Die „Provinz Oberpfalz“
Die Stammmutter der bayerischen Könige: Franziska Dorothea von Pfalz-Sulzbach
Arrondierung und Neugliederung
Carl von Dalberg und das Fürstentum Regensburg
Die Fürsten Thurn und Taxis
Regensburg wird bayerisch
Gegen „die tiefe Erniedrigung Deutschlands“
Die Säkularisation in der Oberpfalz
Die Aufhebung des Klosters Speinshart
Das schwierige 19. Jahrhundert
„Mach dich auf den Weg“: Auswanderung aus der Oberpfalz
Im „Land der Wölfe und der Wilden“: Die Gründung der Maxhütte
Eisenbahn und Ludwigskanal
Glas und Porzellan
Vom Bauchladen zum Großversand: „Witt Weiden“
Die Oberpfalz im Nationalsozialismus
Der erfolglose Kampf der NSDAP
Dietrich Eckart
Vernichtung durch Arbeit: Das Konzentrationslager Flossenbürg
Terror …
… und Widerstand
Krieg und Zusammenbruch
Es geht aufwärts
Von „Zigeunern“ zu „Entwicklungshelfern“: Vertriebene in der Oberpfalz
Wirtschaftswunder?
Elvis in der Oberpfalz
Ohne Fördermittel geht es nicht
Gebietsreform
Universität und OTH
Der Weg in den WAA-hnsinn
Das Aus für die Maxhütte
Die Kontinentale Tiefbohrung bei Windischeschenbach
Chancen und neue Wege
Zwischen Tourismus und HighTech
Zeittafel
Bezirkstagspräsidenten
Regierungspräsidenten
Literatur in Auswahl
Internetadressen
Register
– Personen
– Orte
Bildnachweis
Vorwort
Georg Christoph Gack schrieb in seiner 1847 erschienenen „Geschichte des Herzogthums Sulzbach“: „Schwer ist’s, die Verwirrung in den [oberpfälzischen Gebieten] zu schlichten und ihre Grenzen genau zu ziehen. Denn von Zeit zu Zeit verschlang ein Gebiet das andere.“
Dem kann die Verfasserin nur zustimmen: Schwer ist es, sich der wechselvollen Geschichte der Oberpfalz zu nähern. Fast glaubt man, den Überblick zu verlieren. Denn nicht nur „verschlang von Zeit zu Zeit ein Gebiet das andere“, nein, Verträge und Erbteilungen schufen immer wieder neue Herrschaftsgebiete, die die ohnehin vorhandene territoriale Vielfalt noch vergrößerten. Doch genau diese Vielfalt ist es, die sie spannend macht, die Geschichte der Oberpfalz, dieses Verbindungslandes zwischen Franken und Böhmen, mal Brücke, mal Endstation, je nach politischer Großwetterlage.
Hier zu leben war nicht einfach. Die Menschen mussten mit wechselnden Dynastien und wechselnden Konfessionen, mit fürchterlichen Kriegen, mit Ausbeutung und echter Not zurechtkommen. Fast immer waren sie arm, vor allem als sich Bayern ihrer bemächtigte. So sind den Oberpfälzern über die Jahrhunderte hinweg die großen Worte und spektakulären Gesten abhanden gekommen. Bescheiden seien sie und bodenständig, bedächtig und konservativ, zurückhaltend und gewiss nicht prahlerisch, sagen die Oberpfälzer von sich selbst. Und sie sind stolz auf ihren Dialekt, zu dem Fremde nur mit Mühe Zugang finden. Sie lieben ihre Heimat und sind so zufrieden mit ihr, wie kein anderer bayerischer Volksstamm mit seiner Heimat zufrieden ist. „Die Oberpfalz, die frisst sich in dein Herz hinein“, sagte ein Oberpfälzer in einem Fernsehinterview. Er erzählte von der Schönheit der Landschaft zwischen Waldsassen (Lkr. Tirschenreuth) und Schierling (Lkr. Regensburg), Pyrbaum (Lkr. Neumarkt) und Lohberg (Lkr. Cham), von Bergen und Hügeln mit herrlichen Mischwäldern, idyllischen Seen, Teichen und Flussläufen, von Burgen und romantischen Burgruinen, von Schlössern, Kirchen und Klöstern und von der Kraft, die die Menschen hier besitzen.
Teichwirtschaft und Fischerei spielen in der Oberpfalz seit dem Mittelalter eine bedeutende Rolle. Die Tirschenreuther Teichpfanne ist eines der größten zusammenhängenden Fischzuchtgebiete Deutschlands.
’S mou geih – es muss gehen: Das war und ist die Devise der Oberpfälzer. Gustl Lang, bayerischer Wirtschaftsminister und gebürtiger Oberpfälzer, brachte es auf den Punkt: „Es gibt keinen Regierungsbezirk unseres Landes, der in so kurzer Zeit so viele Belastungen zu ertragen hatte, wie unsere Oberpfalz. Dennoch sind wir an unserer Last nicht in die Knie gegangen, nicht zerbrochen. Wo liegt denn das Geheimnis? Wer die Geschichte unseres Landes kennt, der weiß, dass die Schicksalsschläge in Jahrhunderten diese Oberpfälzer prägten, die nie aufgaben und nie aufgeben, immer wieder von vorne beginnen, es immer wieder schaffen mit Tüchtigkeit und Zuversicht.“
Topografisches
Vulkane, Riffe, Alte Gebirge und ein märchenhafter Fluss
Geologisch und tektonisch ist die Oberpfalz ein ungemein spannender Raum, in dem Erdaltertum (Paläozoikum), -mittelalter (Mesozoikum) und -neuzeit (Känozoikum) aufeinandertreffen. Im Norden, Osten und Süden liegen die alten Rumpfgebirge Steinwald, Oberpfälzer und Bayerischer Wald, die durch die Waldnaab-Wondreb-Senke und die Cham-Further Senke voneinander getrennt werden. Die Gebirge entstanden vor 400 bis 250 Millionen Jahren als Faltengebirge und wurden im Laufe des Erdmittelalters durch Verwitterung und Abtragung stark eingeebnet. Immer wieder überfluteten Meere die Gebirgsrümpfe, bis sie in der Kreidezeit, als die Hebung der Alpen begann, erneut in Bewegung gerieten, an Bruchlinien aufstiegen und sich wieder senkten.
In eine dieser Bruchlinien des Bayerischen Waldes drangen im Perm hydrothermale Wässer ein, aus denen sich Quarz auskristallisierte. Durch Hebungs- und Verwitterungsvorgänge ist das weniger resistente Begleitgestein abgeräumt und der harte Quarzgang herauspräpariert worden. Der als „Pfahl“ bezeichnete langgestreckte Höhenrücken, der bei Nabburg-Schwarzenfeld (Lkr. Schwandorf) beginnt, ist eines der faszinierendsten Naturschauspiele Ostbayerns.
Begrenzt werden die heute stark erodierten, überwiegend aus Granit und Gneis bestehenden alten Rumpfgebirge durch eine markante, von Nordwest nach Südost verlaufende Störung, die Fränkische Linie, die bis in die Weidener Bucht reicht und in der bei Regensburg auftretenden Keilbergstörung ihre Fortsetzung findet. An dieser Verwerfung – sie durchdringt die Erdkruste bis in eine Tiefe von über 30 km – wurden die Grundgebirge während der Entstehung der Alpen auf das westlich angrenzende, dem Erdmittelalter zugeordnete Vorland aufgeschoben. Über mehrere Millionen Jahre begleiteten heftigste Erdbeben das Geschehen.
Durch die tektonischen Bewegungen entstand zwischen dem im Westen liegenden Schichtstufenland und den nordostbayerischen Grundgebirgen eine „Knautschzone“: das Oberpfälzer Bruchschollenland. Es besteht aus einer Vielzahl von Brüchen und Störungen mit unterschiedlichsten Gesteinsarten: Kalke aus dem Jura, Sande und Tone aus Paläogen und Neogen oder Schotter aus dem Quartär. Durch die Brüche, Verbiegungen und Faltungen konnten in das Sedimentgestein basische Magmatite (Basalt) eindringen, die in Schloten aufstiegen, jedoch erstarrten, als sie die Erdkruste durchdrangen. Zu Oberflächenvulkanismus kam es deshalb hier nicht.
Verhinderte Vulkane: Rauher Kulm und Parkstein
„Im Mittelpunkt Deutschlands steht er, alle Berge weit und breit überragend, gewissermaßen ein Weltwunder … nur in Arabien, im Sinai und Horeb“ sei seinesgleichen zu finden, schrieb der in Leiden lehrende Universalhistoriker Georg Horn 1667 über den Rauhen Kulm.
Ein Weltwunder ist er natürlich nicht, der Basaltkegel des Rauhen Kulm (682 m), wie der vielleicht heimwehgeplagte Horn meinte – er stammte aus dem nahe gelegenen Kemnath (Lkr. Tirschenreuth) –, aber er ist sicher neben dem Parkstein (594 m) bei Weiden die markanteste Erhebung in der nördlichen Oberpfalz.
Rauher Kulm und Parkstein, den Alexander von Humboldt als einen der schönsten Basaltkegel Europas bezeichnete, sind durch Verwitterung und Abtragung freigelegte vulkanische Förderschlote, in denen die glutflüssige Magma steckenblieb oder kaum an der Oberfläche angelangt erstarrte. Sie sind Teil einer Vulkankette, die bis nach Nordböhmen reicht. Die Region ist noch heute eine der seismisch aktivsten in Europa. Im Oktober 2008 registrierten die Seismographen des Geo-Zentrums in Windischeschenbach (Lkr. Tirschenreuth) immerhin Erdstöße der Stärke 4,0. Das Dorf Hatzenreuth (Stadt Waldsassen, Lkr. Tirschenreuth) lag dabei im Epizentrum der Beben.
Seit 2003 gehört der Parkstein zu den schönsten Geotopen Bayerns und seit 2006 zu den bedeutendsten Geotopen Deutschlands.
Die westliche Begrenzung der Oberpfalz bildet der Oberpfälzer Jura, Teil der Fränkischen Alb, die zur Schichtstufenlandschaft Nordbayerns gehört. Sie besteht aus einem gänzlich anderen geologischen Substrat als die östlichen Grundgebirge, nämlich aus Kalken. Vor rund 200 Millionen Jahren bedeckte ein warmes Flachmeer die Gegend, das immer wieder austrocknete und sich neu bildete. In einem Zeitraum von etwa 60 Millionen Jahren setzten sich am Grund des Meeres Sedimente ab, die von kalkbildenden Organismen stammten. Während der Trockenphasen verkarstete der zu Festland gewordene Meeresboden und es entstanden die ausgedehnten Höhlensysteme, Dolinen und Grotten, die wir heute aus dem Jura kennen. Zu ihnen gehört die nur 450 m lange König-Otto-Höhle bei Velburg (Lkr. Neumarkt), die als eine der schönsten Tropfsteinhöhlen Deutschlands gilt.
Neben Ammoniten und Saurierreste führenden Kalken und Mergeln wuchsen am Grund der flachen und warmen Schelfmeere riesige Schwamm- und Korallenriffe, deren Riffkalke zum Teil durch Zufuhr von Magnesium in Dolomit umgewandelt wurden. Die charakteristische Kuppenlandschaft der Alb ist auf diese Riffdolomite zurückzuführen.
Weißer Jura (Malm) bestimmt die Karstgebiete des Oberpfälzer Jura. Im Juravorland, das im Westen des Regierungsbezirks eine breite Übergangszone zum flachen mittelfränkischen Keuper-Lias-Land bildet, treten dann die älteren Schichten des schwarzen (Lias) und des braunen Jura (Dogger) zutage.
An der Bruchkante zwischen Jura und Vorland lassen Zeugenberge, wie der 595 m hohe Dillberg, erkennen, dass die Schichtstufenlandschaft deutlich weiter nach Westen reichte. Erosionsvorgänge arbeiteten in Jahrmillionen die Berge heraus und trennten sie von den Jura-Schichtstufen.
Ganz im Süden der Oberpfalz schließen der Westzipfel der Donauebene und ein Randstreifen des tertiären Hügellandes den Regierungsbezirk vom benachbarten Niederbayern ab.
An der Donau hat die Oberpfalz nur wenig Anteil. Ihr zentraler Fluss ist die Naab, deren Einzugsgebiet mit allen Quell- und Zuflüssen immerhin 5225 km2 umfasst. „Die Naab ist eine echte Oberpfälzerin“, schreibt Franz X. Bogner und hat damit völlig Recht, denn sie ist der einzige Fluss, der den gesamten Regierungsbezirk von der Nordgrenze bis zur Mündung bei Regensburg durchzieht. Allerdings sind zwei ihrer Quellflüsse „geborene“ Fränkinnen, nämlich Fichtelnaab und Heidenaab. Über die Länge des Flusses ließe sich streiten. Nimmt man den längsten Quellfluss, die Waldnaab (100 km Länge), und rechnet dazu 98 km ab der Vereinigung von Waldnaab und Heidenaab bei Oberwildenau (Markt Luhe-Wildenau, Lkr. Neustadt) – erst ab hier wird der Fluss als Naab bezeichnet –, ergibt sich eine Länge von 198 km.
Die Naab – hier bei Kallmünz – ist der zentrale Fluss der Oberpfalz.
Die Urnaab stand in enger Verbindung zum zweiten wichtigen Fluss in der Oberpfalz, dem Regen. Er floss durch die Bodenwöhrer Bucht und vereinigte sich mit der Urnaab bei Schwandorf zu einem weitverzweigten Fluss-Seen-System. Durch Geländehebungen und -senkungen bei der Entstehung der Alpen kam es im Unterlauf zur Trennung der beiden Flüsse. Der Regen knickte westlich von Nittenau (Lkr. Schwandorf) nach Süden ab und nutzte nun das ursprüngliche Tal der Naab bis zur Mündung in die Donau.
Beinahe alle Flüsse der Oberpfalz fließen in die Donau. Die Wondreb macht eine Ausnahme. Obwohl sie im Einzugsgebiet der Naabquellflüsse entspringt, orientiert sie sich nach Osten und mündet in die Eger. Wir befinden uns hier im Bereich der Europäischen Hauptwasserscheide. Der Main mit seinen beiden Quellflüssen wendet sich nach Westen dem Rhein zu, die Eger mit ihren Zuflüssen mündet in die Elbe und die Naab entwässert Nordostbayern zur Donau hin.
Die Naab bildet ein einzigartiges Biotop, wie es in Mitteleuropa kaum noch zu finden ist. Hier leben Eisvögel und Milane, seltene Flussperlmuscheln, Edelkrebse und ein Fisch „halb Karpfen halb Hecht mit goldenen Schuppen“. Sollte es Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, gelingen, dieses Tieres habhaft zu werden, dann werden Sie den Schlüssel zu einer Schatztruhe finden, die an der Naab zwischen Pfreimd und Nabburg verborgen liegt. Versuchen Sie es! Es lohnt sich! Denn einen Schatz – nicht unbedingt materieller Natur – werden Sie hier in jedem Fall finden.
Die Oberpfalz in prähistorischer Zeit
Jäger, Sammler, Ackerbauern
Zu den bevorzugten Lebensräumen altpaläolithischer Menschen gehörte das Gebiet der heutigen Oberpfalz wohl nicht, obwohl es im Gürtel der eisfreien Zone zwischen nördlicher und südlicher Vergletscherung lag und Felsschutzdächer (Abri), Grotten und Höhlen der Fränkischen Alb Schutz vor schlechtem Wetter und Unterschlupf bei den Jagdzügen durch die eiszeitlichen Tundren und Steppen bieten konnten. Erst am Ende des Altpaläolithikums (500 000 bis 100 000 v. Chr.), in der Warmzeit zwischen Riss- und Würmeiszeit, scheinen Menschen, die zur Gruppe der Neandertaler gerechnet werden, hier aufgetaucht zu sein. Ein Faustkeil, angefertigt von den nomadisierend herumstreifenden Jägern und Sammlern, belegt die Begehung der wichtigsten regionalen Verbindung in den böhmischen Raum, der Cham-Further Senke, vor mehr als 100 000 Jahren. Man fand das Werkzeug 1961 bei Erdaushubarbeiten 1 km östlich der Ortschaft Pösing (Lkr. Cham).
Flusstäler, wie das untere Regen- und das Altmühltal, zogen prähistorische Menschen besonders an. Eine altsteinzeitliche Klinge, die beim Bau eines Hauses in Diesenbach (Lkr. Regensburg) zu Tage kam, und Relikte, die in der Fischleitenhöhle bei Mühlbach (Gem. Dietfurt, Lkr. Neumarkt) gefunden wurden, belegen die Anwesenheit durchziehender Trupps von Neandertalern spätestens in der Würmeiszeit. Und auch im Tal der Donau fanden sich Zeugnisse der Frühmenschen. In der Gegend um Oberisling (Stadt Regensburg) hinterließen sie an Jagdrastplätzen Abschläge von Hornstein, Schaber, Faustkeile und andere Artefakte.
Im Laufe der letzten Eiszeit scheinen sich vermehrt Familienclans der Wildbeuter im Süden der Oberpfalz, in den Tälern von Donau, Naab und unterer Altmühl aufgehalten zu haben. Gegen Ende der Würmeiszeit belegten sie schließlich weiter nördlich liegende Höhlen des Jura, wie die Bettelküche bei Troßalter (Lkr. Amberg-Sulzbach) westlich von Sulzbach-Rosenberg. Auch der Osten der Oberpfalz blieb nicht menschenleer. Im mittleren Schwarzachtal fand man Gerätschaften, deren Alter auf über 12 000 Jahre geschätzt wird.
Zum Ende des Paläolithikums (8000 v. Chr.) wagten sich die Jägerhorden von der Donau kommend vilsaufwärts und erreichten wohl die Gegend von Ensdorf (Lkr. Amberg-Sulzbach) südlich von Amberg. Dass selbst der unwirtliche Nordosten der Oberpfalz nicht gänzlich gemieden wurde, wie man lange Zeit vermutete, zeigen die bei Moosbach südlich von Pleystein (Lkr. Neustadt/Waldnaab) gefundenen Artefakte, die einer endpaläolithischen Jägergruppe zugeordnet werden.
Um das 8. Jahrtausend v. Chr. setzte eine entscheidende Klimaänderung ein. Wegen der fortschreitenden Erwärmung zogen sich Tundren- und Steppenvegetation zurück; an deren Stelle traten ausgedehnte Wälder. Die Großtiere der Eiszeit wanderten ab oder starben aus. Wisente, Auerochsen und Riesenhirsche wurden nun zu Beutetieren der mittelsteinzeitlichen Menschen, die, noch immer nicht sesshaft, weiter als Jäger und Sammler die Gegend durchstreiften. Höhlen suchten sie jetzt bevorzugt für kultische Zwecke auf, kaum mehr als Wohnplätze. Zeltlager – über einem Gerüst aus Holz- oder Geweihstangen spannte man Tierfelle – dienten als Unterkünfte, die durch die verbesserten Lebensbedingungen weniger häufig gewechselt werden mussten. Im Laufe der Mittelsteinzeit (Mesolithikum), die etwa um 5500 v. Chr. endete, dehnten die Jägerhorden ihre Beutezüge bis in die nördliche und östliche Oberpfalz aus. Das Gebiet der Cham-Further Senke wurde, wie zahlreiche Lesefunde belegen, auch im Mesolithikum regelmäßig begangen.
Die Jungsteinzeit (Neolithikum) brachte schließlich den entscheidenden Wandel: Die Jäger und Sammler gaben ihr nomadisches Leben auf und wurden sesshaft. Feldbau und Viehhaltung, Vorratswirtschaft und Hausbau bestimmten nun das Leben der Menschen, die sich ganz neue handwerkliche Fertigkeiten aneignen mussten, um als Bauern zu überleben. Die Kenntnisse agrarischer Wirtschaftsformen hatten sich im Vorderen Orient bereits um 8000 v. Chr. herausgebildet und sickerten allmählich in Europa ein. Zuwanderer aus Pannonien brachten schließlich vor etwa 7000 Jahren als Erste Saatgut, Haustiere und das notwendige Wissen in den süddeutschen Raum. Sie siedelten sich auf den ertragreichen Lösslehmböden der Flusstäler an und integrierten in kurzer Zeit die heimischen, noch nomadisch lebenden Jäger. Wälder wurden gerodet, Dörfer und Felder angelegt. Die nun einigermaßen sichere Nahrungsversorgung führte sehr schnell zu einem bedeutenden Bevölkerungswachstum, sodass sich die Menschen dieser ersten Bauernkultur, nach den Verzierungen auf ihren Tongefäßen als Linearbandkeramiker bezeichnet, über ganz Mitteleuropa ausbreiten konnten.
In der Oberpfalz ließen sich die frühen Siedler im Süden auf den fruchtbaren Böden des Donautals nieder. Das Dorf von Regensburg-Harting aus dem 5. Jahrtausend v. Chr. belegt, mit welch hohem Material- und Arbeitseinsatz die Menschen, wohl Stichbandkeramiker, arbeiteten, um die großen 25 m langen und 6 m breiten strohgedeckten Wohn-, Arbeits- und Speicherhäuser zu errichten.
Nördlich der Donau wird die überkommene nomadische Lebensweise noch einige Zeit fortgedauert haben, bis sich schließlich auch hier die Neuerungen durchsetzen konnten.
Die Feuersteinstraße
Feuerstein war der wichtigste Rohstoff der Jungsteinzeit. Wegen seiner beträchtlichen Härte und guten Spaltbarkeit wurde ein großer Teil der Werkzeuge und Waffen aus diesem Quarzmineral hergestellt. Nahe der Ortschaft Arnhofen bei Abensberg (Lkr. Kelheim/Ndb.) wurde in den 1980er-Jahren ein neolithisches Bergwerk entdeckt, in dem zwischen 5000 und 4000 v. Chr. Feuerstein abgebaut wurde. Das gewonnene Material transportierte man auf der „Feuersteinstraße“ quer durch die heutige Oberpfalz auf den Flüssen Donau, Regen, Naab und Schwarzach, die vermutlich mit Einbäumen befahren wurden, über die wichtige Verbindung der Cham-Further Senke und den Pass von Waldmünchen durch Böhmen bis in die Gegend des heutigen Prag.
Etwa mit der beginnenden mittleren Jungsteinzeit (ab ca. 4900 v. Chr.) bildeten sich unterschiedliche regionale Kulturgruppen aus, deren Verbreitung in der Oberpfalz vorrangig im Süden lag. Die Gruppe Oberlauterbach (bis etwa 4600 v. Chr.) lässt sich durch Funde aus Piesenkofen (Lkr. Regensburg) nachweisen. Ihre Siedlungen aus Langhäusern legten die Oberlauterbacher bevorzugt in Spornlagen an und umgaben sie mit Gräben.
Die Menschen der nachfolgenden Münchshöfener Kultur (bis etwa 3800 v. Chr.) ersetzten das Langhaus durch eine dreieckige Bauweise. Innerhalb ihrer Siedlungen fand man Bestattungen, die auf Menschenopfer hinweisen. Diese Kultur wurde stark aus dem südosteuropäischen Raum beeinflusst, wie die bei Aukofen (Lkr. Regensburg) gefundenen Keramiken zeigen.
Die Altheimer Gruppe (bis ca. 3200 v. Chr.) folgte in ihrer Keramik der allgemeinen jungsteinzeitlichen Tendenz, schlichte grobwandige Schüsseln und Trichtertöpfe mit einfachen Randverzierungen zu fertigen. Die Menschen der Altheimer Kultur eroberten sich neues Siedlungsterrain, nämlich Feuchtböden. Ihre Häuser haben deshalb kaum Spuren hinterlassen. Bei Sengkofen (Lkr. Regensburg) kam eine Grubenhütte zu Tage, die wohl als Vorratslager diente. Bemerkenswert ist, dass die Altheimer als Erste in Süddeutschland Kupfer verarbeiteten.
Nahe Piesenkofen (Lkr. Regensburg) und weiter westlich bei Griesstetten (Stadt Dietfurt, Lkr. Neumarkt) an der Altmühl wurden Siedlungen der Chamer Kultur (bis ca. 2200 v. Chr.) entdeckt. Die jungsteinzeitliche Siedlung im unteren Altmühltal lag geschützt zwischen Wasserläufen und bestand etwa 200 Jahre. Ihre mit Feuerstellen versehenen Häuser legten die Menschen annähernd quadratisch an und errichteten sie in Blockbauweise. Tierknochenfunde zeigen, dass sie Rinder, Schweine und Schafe als Haustiere hielten, vielleicht auch schon Pferde.
Die Kultur der Schnurkeramiker, die kaum über Siedlungsplätze nachgewiesen werden kann, ist im Altmühltal bei Dietfurt durch mehrere Gräber dokumentiert. Zu den Grabbeigaben zählen Gefäße mit Schnurverzierung, Äxte und Beile aus Stein, Dolche aus Feuerstein und Knochengeräte.
Um 2000/1800 v. Chr. ging die Jungsteinzeit mit der Glockenbecherkultur, die rund 200 Jahre West- und Mitteleuropa prägte, zu Ende. Glockenbecherleute hatten sich an der Donau und ihren Zuflüssen, wie an der Altmühl bei Dietfurt, und damit an wichtigen Handelsstraßen angesiedelt. In Regensburg-Barbing wurde Mitte 2010 das Grab eines mit Waffen, Keramik und einem Goldring ausgestatteten jungen Kriegers gefunden – ein ganz außergewöhnlicher Fund auch insofern, als in Bayern bisher aus dieser Epoche nur vier weitere Gräber mit Goldbeigaben entdeckt wurden.
Im Grab des „Kriegers von Barbing“ fanden Archäologen den bislang ältesten Nachweis von Gold in Bayern und die weltweit älteste bemalte Keramik.
Die Zuwanderer aus dem Westen, die auf der Suche nach Metallen in Europa ausschwärmten, waren allein schon durch ihre metallurgischen Kenntnisse den einheimischen Kulturen überlegen und leiteten zum nächsten kulturhistorisch einschneidenden Wandel über.
Der neue Werkstoff Bronze
In der späten Jungsteinzeit tauchte zum ersten Mal das Metall Kupfer in Mitteleuropa auf. Zur Werkzeug- und Waffenproduktion war das weiche Metall allerdings kaum geeignet. Erst die Legierung von Kupfer und Zinn brachte einen geeigneten Werkstoff hervor: Bronze. Natürlich löste er nicht sofort und überall die Stein- und Knochengeräte ab. Die Übergänge waren fließend.
Existenzbasis blieb auch nach dem „Metallschock“ die Siedlung mit Ackerbau und Viehhaltung, die, ursprünglich völlig auf Selbstversorgung ausgerichtet, nun wegen des Metallbedarfs aus ihrer Isolierung heraustreten musste. Ein funktionierender Fernhandel wurde notwendig, um an die begehrten Rohstoffe zu kommen – Kupfer aus dem Salzburger Land und aus Tirol, Zinn aus Böhmen –, und sowohl Rohstoffgewinnung als auch Bronzeguss erforderten spezialisierte Handwerker. Damit begann eine weitreichende Umstrukturierung der Gesellschaft. Hierarchien bildeten sich aus und Abhängigkeiten entstanden.
Voraussetzung für das Aufkommen einer „Oberschicht“ waren die Gewinnung der Herrschaft über den Zugang zu den Rohstoffquellen und die überschießende Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse, um im Tausch die begehrten Metalle zu erwerben.
Die neue Wirtschaftsordnung konnte nur funktionieren, wenn eine straffe „politische“ Organisation hinter allem stand. Sie ging von den die wichtigen Verkehrswege beherrschenden Burgen aus. Die hier „residierende“ neu entstandene Führungsschicht konnte sich die Kontrolle über die Kupfer- und Zinnhandelswege sichern und setzte sich damit von den übrigen Mitgliedern der Sippe ab. Eine Art „Adel“ bildete sich aus.
In der Frühphase der Bronzezeit blieb die Besiedlung der Oberpfalz im Wesentlichen auf das Donautal beschränkt, in der mittleren und späten Bronzezeit erlebte dann die gesamte westliche Oberpfalz eine kulturelle Blüte. Der östliche Teil blieb eher dünn besiedelt.
Mit dem Beginn der Urnenfelderzeit (1200 bis 800 v. Chr.), eine Periode, die in eine trocken-warme Klimaphase fiel, vollzog sich ein neuerlicher tiefgreifender sozialer und kultureller Wandel. Die Oberschicht entwickelte sich zum Kriegeradel, der in großen befestigten Höhensiedlungen saß. Hier konzentrierte sich die politische und wirtschaftliche Macht. Der Schlossberg bei Kallmünz (Lkr. Regensburg), an strategisch perfekter Stelle im Mündungsdreieck Naab – Vils und nahe der Handelsdrehscheibe vor der Bodenwöhrer Bucht gelegen, trug eine dieser fast stadtähnlichen Siedlungen. Eine weitere Anlage befand sich auf dem Johannisberg bei Amberg. Die Siedlungen des Flachlandes blieben, wie das urnenfeldzeitliche Dorf von Plankstetten (Stadt Berching, Lkr. Neumarkt), unbefestigt.
Der kulturelle Wandel tritt deutlich in den veränderten Bestattungssitten hervor, die wohl auf neue religiöse Vorstellungen zurückgehen. Die seit Jahrtausenden übliche Körperbestattung wurde aufgegeben. Man verbrannte nun die Toten, füllte die Asche in Urnen und setzte sie in einer kleinen Grabgrube bei. Die Urnengräber wurden in beträchtlicher Anzahl zu großen Friedhöfen aneinandergereiht – zu den namengebenden Urnenfeldern.
Bronze blieb weiterhin der Rohstoff zur Herstellung von Waffen, Schmuck und Gerätschaften. Zum Ende der Urnenfelderzeit tauchte dann vereinzelt Eisen auf – in den Hochkulturen des Vorderen Orients längst ein wichtiger Werkstoff. Wegen seiner außerordentlichen Kostbarkeit wurde das neue Material in unserem Raum jedoch zunächst nur als Zierrat verwendet.
Eine neue Epoche: Die Eisenzeit
Die Kenntnisse der Eisenverarbeitung gelangten durch Zuwanderer über Griechenland und Italien oder Südosteuropa in den mitteleuropäischen Raum. Mit den Neusiedlern kam es zu ethnischen Umschichtungen. Sie überlagerten die urnenfelderzeitlichen Gesellschaften, ohne dass ein Bevölkerungswechsel erfolgte. Die so genannte Hallstattkultur (800/700 bis 500/450 v. Chr.) entstand.
Vollständig verdrängen konnte der neue Werkstoff die Bronze nicht, doch Waffen, Werkzeug und Geräte fertigte man nun wegen der größeren Härte aus Eisen, dessen natürliche Vorkommen im Unterschied zu Kupfer und Zinn viel weiter verbreitet waren. Zudem war Eisenerz leichter zu gewinnen und konnte an Ort und Stelle verhüttet werden. Damit wurde Eisen deutlich „billiger“ als Bronze. Die wirtschaftlichen Veränderungen führten zu einem neuerlichen gesellschaftlichen Wandel.
Das bronzezeitliche Kontrollsystem über die Fernhandelswege für Kupfer und Zinn und damit die Vormachtstellung der alten Elite brach zusammen. Durch die qualitativ besseren und billigen Eisengeräte nahm nun die landwirtschaftliche Produktion einen beträchtlichen Aufschwung, sodass sich jetzt eine breite Schicht wohlhabender Bauern und eine Art ländlicher Adel herausbilden konnten. Prachtvolle „Fürstensitze“ wie in anderen Gebieten Süddeutschlands gab es in der Oberpfalz, die kaum vom Fernhandel mit dem reichen Südwesten profitierte und sich nach Osten in den böhmisch-ungarischen Raum orientierte, jedoch nicht. Dass die Oberschicht dennoch keineswegs „arm“ war, beweist das große Gräberfeld von Schirndorf nahe Kallmünz aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. Die Menschen waren wieder dazu übergegangen, ihre Toten unter Hügeln zu bestatten, und versahen sie mit reichen Beigaben, die den hohen Stand des Handwerks belegen.
Nur die westliche Oberpfalz war während der Hallstattzeit intensiv besiedelt, der Kernbereich lag zwischen Altmühl und Vils. Aus der näheren Umgebung Ambergs gibt es zahlreiche Grabfunde, die eine dichte Aufsiedlung bezeugen. Doch auch die östliche Oberpfalz blieb nicht völlig siedlungsleer, wie die Grabanlage von Lohma, südlich von Pleystein, beweist.
Welcher ethnischen Gruppe die Bevölkerung der Hallstattzeit zuzurechnen ist – ob sie vielleicht schon keltisch war –, konnte die Wissenschaft bisher nicht sicher ermitteln.
Die Kelten
Durch den lebhaften Güteraustausch der frühfeudalen Hallstattkulturen mit den im Mittelmeerraum ansässigen Völkern wandelte sich die Gesellschaft allmählich, bis um die Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. eine neue Kulturepoche fassbar wird, die als Latènezeit (5. Jh. v. Chr. bis zur Zeitenwende) bezeichnet wird.
Trotz des Aufkommens völlig neuer Stile und Sachformen in Kunst und Kunsthandwerk stellt sich der Übergang bruchlos dar. Es kam zu Bevölkerungsverschiebungen, jedoch nicht zu einem Bevölkerungsaustausch, was darauf hindeuten könnte, dass schon die Menschen der Späthallstattzeit Kelten waren.
Die keltische Gesellschaft gliederte sich in verschiedene Stämme, getragen von einer einheitlichen Kultur, die im Westen bis an die Seine und im Osten bis an die Moldau reichte. Weit gespannte Handelsverbindungen vor allem zum Mittelmeerraum wurden nun intensiviert und entwickelten sich zu Trägern geistiger und kultureller Einflüsse.
Der oberpfälzische Raum stellt sich zu Beginn der Latènezeit geradezu als „Innovationsregion“ dar. Die hier produzierten Töpferwaren und Metallgeräte, wie die großartige Parsberger Fibel und die Matzhausener Flasche, waren von hervorragender Qualität. Die Menschen, die sie produzierten, lebten in befestigten Bergsiedlungen, wie dem Buchberg bei Neumarkt oder dem Wolfsberg bei Dietfurt, und in offenen Siedlungen des Flachlandes. Dass sie Kontakte zu den in Nord- und Mittelitalien ansässigen Etruskern pflegten, lässt sich durch Bronzebecken, die in einem Grab im Samsbacher Forst (Lkr. Schwandorf) gefundenen wurden, belegen.
Dieser wirtschaftlichen und kulturellen Blütezeit folgte im 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. ein Einbruch – die großen keltischen Wanderungen hatten begonnen. An deren Ende besiedelten die Kelten fast ganz Europa. 276 v. Chr. überschritten sie den Hellespont und ließen sich auch in Kleinasien nieder. Antike Schriftsteller machten Abenteuerlust, Beutegier, aber auch Überbevölkerung und innere Unruhen für die Expansionswelle verantwortlich. Hinzu kam, dass sich das Klima nördlich der Alpen deutlich verschlechterte und damit die Lebensgrundlagen bedroht waren.
In der Oberpfalz fanden diese unruhigen Zeiten einen deutlichen Niederschlag. Siedlungen wurden verlassen oder zerstört, Begräbnisplätze aufgelassen. Ganze Landstriche waren entvölkert. Die Menschen ließen sich nicht mehr an festen Plätzen nieder, sie zogen umher.
Die Umwälzungen lassen sich auch an den Begräbnissitten festmachen. Die Toten wurden nicht mehr in Hügel-, sondern in Flachgräbern bestattet. Aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. sind in Nordbayern nur wenige Grabfunde bekannt. Ihr vereinzeltes Vorkommen bezeugt den eher unsteten Charakter der Besiedlung. Kleinere Gruppen haben sich nur vorübergehend in günstigen Landstrichen niedergelassen, wie ein Trupp aus Böhmen, der bei Riekofen in der Nähe von Regensburg ansässig wurde.
Die Linsenflasche von Matzhausen, ein außergewöhnliches Zeugnis keltischer Kunst, zeigt einen umlaufenden Tierfries.
Erst im Laufe des 2. Jahrhunderts kam es zu einer erneuten Aufsiedlung. Die Zeit der weit ausgreifenden Expansion keltischer Stämme war nun vorüber. Überall – auf dem Balkan, in Italien, Spanien und auch im Norden – waren Gegner aufgetreten, die die Eroberer zurückdrängten. Ein Rückstrom aus Italien führte zu einem Wiederaufleben der Latènekultur in unserem Raum. Sie trug nun deutlich mediterrane Züge. Altbekannte Technologien wurden verfeinert, Metall-, Töpfer- und Glashandwerk erlebten eine neue Blüte.
Charakteristisch für diese Phase sind die von Caesar als oppida bezeichneten stadtartigen Befestigungen mit hoch spezialisierten Handwerksbetrieben. Hier konzentrierten sich Verwaltung, Produktion, Handel, Warenumschlag und nicht zu vergessen das neu aufgekommene Münzwesen. Der Goldmünzschatz von Großbissendorf (Gem. Hohenfels, Lkr. Neumarkt) zeigt, dass Handel und Warenaustausch keineswegs auf die befestigten Großsiedlungen beschränkt blieben, denn diese fehlen in der Oberpfalz. Die Menschen lebten hier in bescheideneren Anlagen, wie in der Eisen gewinnenden und verarbeitenden Siedlung von Berching-Pollanten (Lkr. Neumarkt), in unbefestigten Mittelpunktsiedlungen, wie die von Egglfing (Gem. Köfering, Lkr. Regensburg), sowie in Einzelgehöften, Weilern und Kleinsiedlungen, die besonders in den Flusstälern in dichterem Abstand zueinander lagen. Zu ihnen könnte „Radaspona“ gehört haben, eine kleine keltische Ansiedlung, am Donaubogen gelegen, im späteren Regensburger Becken. Vielleicht meint „Radaspona“ aber auch nur eine vielbegangene Furt im Sinn einer Donaulände.
Die Spuren latènezeitlicher Bevölkerung lassen sich nicht nur im Westen der Oberpfalz nachweisen. So genannte Viereckschanzen, Gutshöfe oder auch Kultanlagen mit viereckigen Einfriedungen, wurden bei Lauterhofen (Lkr. Neumarkt) und auch bei Nößwartling (Lkr. Cham) südlich von Furth im Wald gefunden.
Seit dem späten 2. Jahrhundert v. Chr. trieb die keltische Welt allmählich ihrem Untergang entgegen. Innere Streitigkeiten und das nach Vorherrschaft strebende Rom spalteten die Stämme. Der Druck aus dem Süden nahm zu, aber auch der aus dem Norden: Die Furcht vor den Kimbern und Teutonen erschütterte Europa, spätestens um 112 v. Chr. dürften sie Süddeutschland erreicht haben.
Die Germaneneinfälle leiteten den Niedergang der keltischen Kultur ein. Das hoch entwickelte Wirtschaftssystem mit seinen Handels- und Handwerkstraditionen wurde so empfindlich gestört, dass es sich nicht wieder erholen konnte. Schließlich wanderten, folgt man den antiken Berichten des Poseidonios und des Ptolemaios, in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. keltische Stämme aus Süddeutschland ab. Mancher Stammes- oder vielleicht auch Tempelschatz wurde in diesen unruhigen Zeiten in der trügerischen Hoffnung der Erde anvertraut, ihn nach ausgestandener Gefahr wieder bergen zu können. Das gilt wohl auch für den bei Großbissendorf gefundenen Goldhort. Zurückkehren konnte jedoch niemand mehr, um den immerhin zwei Kilogramm wiegenden Schatz – den drittgrößten Fund keltischer Goldmünzen in Bayern – auszugraben. Der großflächige Abzug der keltischen Stämme war endgültig.
Trotzdem war die Oberpfalz nicht völlig menschenleer. Germanen rückten in das weitgehend verlassene Gebiet nach. Keramik aus Mitteldeutschland taucht im Donautal auf und die Bauweise der Siedlungen verändert sich: kleine rechteckige, in den Boden eingetiefte Hütten, wie sie aus dem thüringischen, aber auch aus dem böhmischen Raum bekannt sind. Archäologen vermuten, dass sich Restkelten aus Böhmen und Germanen aus Thüringen hier ansiedelten. Und es muss Splittergruppen verbliebener einheimisch-keltischer Bevölkerung gegeben haben, denn nur so lässt sich erklären, dass Gewässernamen wie die der Flüsse Naab, Sulz, Chamb oder Laber überliefert werden konnten.
Insgesamt sind aus der Oberpfalz keine archäologischen Funde bekannt, die auf eine umfangreiche germanische Aufsiedlung schließen lassen. Die Gruppen waren eher von den schwierigen Zeiten in Bewegung gehaltene Durchzügler, die nur kurzzeitig an einem Platz verblieben. Der Raum nördlich der Donau wird zur Zeit der Eroberung Südbayerns durch die Legionen des Drusus und Tiberius wohl nur spärlich besiedelt gewesen sein.
Das lange Mittelalter
Römer und Germanen
Im Sommer des Jahres 15 v. Chr. eroberten die Römer unter Führung von Drusus und Tiberius, den Stiefsöhnen des Kaisers Augustus, das Alpenvorland. Unter Kaiser Claudius entstand hier um 40 n. Chr. die Provinz Rätien, deren Grenze zunächst die Donau bildete. Der südliche Teil der Oberpfalz geriet damit unter unmittelbaren römischen Einfluss, der Norden dagegen gehörte zum Freien Germanien. Gegen Ende des 1. Jahrhunderts überschritten die Römer die Donau und errichteten den Limes als befestigte Grenzlinie mit zahlreichen Kastellen und Wachtürmen. Ohne große Störungen konnte sich in der römischen Provinz nun ein friedliches und blühendes Leben entwickeln, das gut 100 Jahre andauerte.