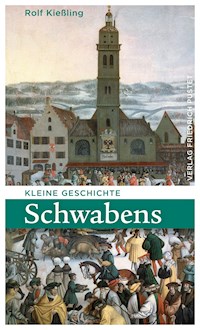
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Friedrich Pustet
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Bayerische Geschichte
- Sprache: Deutsch
Schwaben, das Land zwischen Iller und Lech, vom Ries bis zum Allgäu, ging über Jahrhunderte ganz andere Wege als Bayern: Als Teil des Herzogtums Schwaben war es geprägt von seiner politischen und kulturellen Vielfalt. Adel, Klöster, Städte, Bauern und Juden standen unter dem Schutz von Kaiser und Reich und erhielten eine Existenzgarantie. Gerade deshalb aber entwickelte es sich seit dem hohen Mittelalter zu einer der modernsten Wirtschaftsregionen Europas. Auch war es stets eine Landschaft des gesellschaftlichen Aufbruchs: der Reformation und des Bauernkrieges, der Revolutionen von 1848 und 1919, aber auch der Gelehrsamkeit und der Künste. Von all dem erzählt dieses Buch unterhaltsam und anschaulich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rolf Kießling
Kleine Geschichte Schwabens
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
3., aktualisierte Auflage 2021
© 2009 by Verlag Friedrich Pustet, Regensburg
Gutenbergstraße 8 | 93051 Regensburg
Tel. (0941) 920220 | [email protected]
ISBN 978-3-7917-3176-6
Umschlaggestaltung: www.martinveicht.de
Satz: Vollnhals Fotosatz, Neustadt a. d. Donau
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
Printed in Germany 2021
eISBN 978-3-7917-6185-5 (epub)
Unser gesamtes Programm finden Sie unter
www.verlag-pustet.de
Inhalt
Was ist Schwaben – in Bayern? Erste Annäherungen
Die Grundlagen: Kelten, Römer und Alemannen
Die römische Provinz Raetia
Cambodunum
Römische Zivilisation
Das Töpferdorf Rapis
Römer und Alemannen
Frühmittelalter: Bistum und Herzogtum
Die alemannische ‚Landnahme‘
Christianisierung und Kirchenorganisation
Das alemannische Herzogtum
Schwaben als Teil des Frankenreichs
Hochmittelalter: Herrschaftsbildung in der Region
Noch einmal: Herzogtum Schwaben und Reichsbistum Augsburg
Bischof Ulrich und die Schlacht auf dem Lechfeld
Adel und Klöster
Welfen und Staufer in Schwaben
„Anderen Lüsten zu frönen …“
Konradin – Land ohne Herzog
Spätmittelalter: Modernisierung durch Urbanisierung
Schwaben als Städtelandschaft
Leinen und Barchent
Die Entstehung der Textilzentren
Die ‚Aufsteiger‘
Verdichtung der Städtelandschaft
Patrizier und Zünfte
Zunftkampf
Arm und Reich
Peter III. von Argon
Städte, Adel und Fürsten im Konflikt
Auf dem Weg zum Schwäbischen Bund
Das 16. Jahrhundert: Schwaben als zentrales Reichsland
Das Reich in der Region
Augsburg als ‚heimliche Hauptstadt‘
Fugger, Welser und andere
Reformation und Bauernkrieg
Städtische Gemeinden öffnen sich
Fragen der Religion
Der Bauernprotest organisiert sich
Die „Zwölf Artikel“
Das Ende der Bauernhaufen
Die Ratsreformation
Die konfessionelle Spaltung Schwabens
Der Kalenderstreit
Kulturelle Vielfalt
Zwei parallele Bildungssysteme
Humanismus und Renaissance
Die Grablege der Fugger
Das 17. und 18. Jahrhundert: Territoriale Vielfalt
Krieg, Seuchen und Hunger
‚Kreuz- und Fahnengefecht‘
Bilder aus dem Krieg
Salz, Silber und Kattune
Begehrtes Kunsthandwerk
Das Handwerk in der Defensive
Aufstand der Weber
Schwäbischer Barock: Der ‚Teufelsbauwurm‘
Ottobeurens Kaisersaal
Jüdische Gemeinden im ‚Medinat Schwaben‘
Die Ulma-Günzburg
Schwäbische Aufklärung
Kemptener Aufklärer
Überlebte Duodezherrschaften oder fruchtbare Kleinkammerung?
Das 19. Jahrhundert: Der Weg ins Königreich
Neue Herren: Mediatisierung und Säkularisation
Enteignung zugunsten des Staates
‚Staatsabsolutismus‘
Ein neues Bürgertum entsteht
Auf dem Weg in die Provinz
Fürst Ludwig von Oettingen-Wallerstein
Bayerische ‚Reichspropaganda‘
König Ludwigs I. Reise durch Schwaben
Die Revolution von 1848 als regionales Ereignis
Städtischer Protest
Kaufbeurer Bürgerfest
Gegen die Feudallasten
Das Ende der Grundherrschaft
Rechtliche Gleichstellung auch für Juden?
Die Resignation hält Einzug
Industrialisierung als Innovationsschub
Gründung der SWA
Das neue Gesicht der Städte
Strukturveränderung auf dem Land
Die „Verfertigung von Strohhüten“
Die Milchwirtschaft und die Entdeckung der Berge
Vereinödung
Alpentourismus
Bergforscher Hermann von Barth
Zwischen bayerischem Königtum und deutschem Kaiserreich
Der Liberalismus als „Giftpflanze“?
Bismarckkult und Königsmythos
Das 20. Jahrhundert: Schwaben im Freistaat Bayern
Die Revolution von 1918/19 an der Peripherie
Ernst Niekisch
Für die Regierung Hoffmann
Politische Orientierungen
Schwaben und die Heimatpflege
Otto Merkt: Bürgermeister und Heimatforscher
Nationalsozialismus im Gau Schwaben
Die Etablierung des NS-Systems
Strukturelemente der Diktatur
Gauleiter Karl Wahl
Die Grauen Busse
Die Zerstörung der jüdischen Lebenswelt
Bet Chaluz
Die jüdische Gemeinde in Fischach
Resistenz und Widerstand
Die Region im Krieg
Zwangsarbeit
Nach dem Krieg
Flüchtlinge und Vertriebene
Neugablonz
Wachstumsregion Schwaben
Politischer Neuanfang
Zwischen Globalisierung und Regionalisierung
Schwaben als Industrielandschaft
Der moderate Modernisierer: Anton Jaumann
Eurocopter-Standort Donauwörth
Pflege regionaler Identität – und neue Herausforderungen
Ausblick
Zeittafel
Regierungspräsidenten
Bezirkstagspräsidenten
Literatur
Internetadressen
Register
Bildnachweis
Was ist Schwaben – in Bayern? Erste Annäherungen
Wer von Norden die bayerische Grenze überschreitet und auf den Regierungsbezirk ‚Schwaben‘ stößt, ist einigermaßen befremdet: Schwaben in Bayern? Wie geht das zusammen? Tatsächlich findet sich heute der einzige Gebietsname ‚Schwaben‘ nicht in dem Raum, den man ansonsten mit Schwaben identifizieren würde: mit Württemberg – nur die ‚Schwäbische Alb‘ als mittelgebirgiger Querriegel oder ‚Oberschwaben‘ als Raum zwischen Donau und Bodensee weisen dieses Grundwort auf. Der Name für den bayerischen Verwaltungsbezirk zwischen Iller und Lech, Ries und Allgäu geht auf König Ludwig I. zurück, der 1837 die – nach französischem Vorbild – nach Flüssen benannten Sprengel der Mittelbehörden umbenennen ließ, um für die Bewohner die Identifikation mit den historischen ‚Stämmen‘, die nun das neue Bayern bildeten, zu ermöglichen. Er wollte Identitäten schaffen, damit alle unter der Wittelsbacher Krone ihren Platz finden und sich auf diese Weise mit der Annexion zu Beginn des 19. Jahrhunderts versöhnen konnten.
Dennoch, die Erinnerungskultur ist bis heute hartnäckig geblieben: Sie hatte vielfältige Ansatzpunkte, die über diese Grenzen hinauswiesen, und man bemühte sie immer wieder, um aus dem Korsett der bayerischen Staatlichkeit wenn nicht real, so doch wenigstens im Kopf zu entfliehen. So gesehen, ist das heutige Schwaben ein Konstrukt und keine geografische Größe – aber das war es genau besehen schon immer, sooft es in der Geschichte für eine Raumkonzeption stand, ohne dass die Vorstellungen davon, was ‚Schwaben‘ bedeutet, deshalb übereinstimmen mussten. Mit dem ‚Stamm‘ der Alemannen verband sich der Gedanke eines ‚ursprünglichen‘ Siedlungsgebietes, das von den Vogesen bis an den Lech, von der Nordschweiz bis weit über die Alb reichte und mit dem sich ein frühmittelalterliches alemannischen Herzogtum verbinden ließ. Das hatte tatsächlich einen längeren Atem, denn nach der Eroberung Alemanniens durch die Franken und dem Ende des karolingischen Großreiches konstituierte sich am Anfang des 10. Jahrhunderts ein neues ‚schwäbisches Herzogtum‘. Freilich wurde es am Ende des 11. Jahrhunderts zwischen den Hochadelsgeschlechtern der Staufer, Welfen und Zähringer in Interessengebiete aufgeteilt. Als ‚Herzogtum Schwaben‘ hielt sich der Name nur bei den Staufern – doch sorgte dann die Vermischung Schwabens mit dem Reichsgut des Königsgeschlechts im 12./13. Jahrhundert dafür, dass es nach dem Ende der Staufer mit dem Tod des jungen Konradin in Neapel 1268 in Auflösung verfiel. Eine Wiederbelebung scheiterte – es gab kein ‚Schwaben‘ mehr als politische Größe.
In dieser Zeit war aber auch ‚Schwaben‘ nach Norden gewandert: Hatte das Herzogtum des 10. Jahrhunderts noch eindeutig seine ‚Vororte‘ am Bodensee mit dem Bischofssitz Konstanz als Zentrum gesehen, so streifte Zürich bereits im 14. Jahrhundert die Zugehörigkeit zu Schwaben ab. Die Abgrenzung gegenüber der Schweiz am Bodensee war um 1500 bereits erfolgt – die gegenseitige Beschimpfung als ‚Kuhschweizer‘ und ‚Sauschwaben‘ spricht Bände. Andererseits erhielt Hall im 15. Jahrhundert den Beinamen ‚schwäbisch‘, um sich als ehemals staufische Stadt gegen die Herrschaftsambitionen des Bischofs von Würzburg zu wehren. Auch politische Zusammenschlüsse wie der ‚Schwäbische Städtebund‘ seit 1376, die ‚Adelsgesellschaft mit St. Jörgenschild in Schwaben‘ seit 1406, der ‚Schwäbische Bund‘ von 1488 bis 1534 behielten den Beinamen ‚schwäbisch‘, um ihre räumliche Zuordnung sichtbar zu machen. Bis zum Ende des Alten Reiches prägte schließlich der weit ausgreifende ‚Schwäbische Reichskreis‘ zwischen Lech und Rhein, Bodensee, mittlerem Neckar und Ries die ‚Geschichtslandschaft‘ Schwaben. Nun beanspruchte Ulm gegen Konstanz und Stuttgart ‚des Schwabenlandes Herz und Haupt‘ zu sein, aber auch im frühen Württemberg sprach Eberhard im Bart gerne von ‚Württemberg und Schwaben‘, weil sich seine Dynastie zum dort verankerten Adel zählte. Um und nach 1500 gerieten die gelehrten Humanisten mit ihren Geschichtswerken um die Bestimmung des ‚alten‘ Schwaben miteinander in Streit: Während der Tübinger Universitätslehrer Johannes Nauclerus seine aktuelle patria, sein Vaterland Schwaben, in Abgrenzung von den Franken und Bayern sah und als topografische Grenzen die Alpen und den Rhein bestimmte, votierte Jakob Wimpfeling aus Strassburg für die Zugehörigkeit des Elsass zu einer ‚Germania‘; Beatus Rhenanus wiederum ließ eine ‚Alemannia‘ entstehen, die sowohl Schwaben als auch das Elsass umfasste (Dieter Mertens). Man sieht, in diesen Jahrhunderten war ‚Schwaben‘ alles andere als eindeutig bestimmbar – aber es lebte in den Köpfen.
Die staatliche Neubildung in der Ära Napoleons stellte dann neue Konstruktionen in den Vordergrund: So wie das erweiterte Württemberg ein antagonistisches Verhältnis von Oberschwaben und Innerschwaben mit sich brachte, deren verschiedene Traditionen ihre spezifische Wertung und emotionale Auffüllung hatten, so finden wir im neuen Bayern eine Spannung von Bayerisch-Schwaben zu Altbayern – und nun wird auch verständlich, warum der romantische Historismus König Ludwigs I. mit der Namensgebung der Regierungsbezirke die Anknüpfung an die schwäbische Tradition bewusst einsetzte: Es geschah „in der Absicht, … die alten, geschichtlich geheiligten Marken … möglichst wiederherzustellen, die Einteilung … und die Benennung der einzelnen Haupt-Landesteile auf die ehrwürdige Grundlage der Geschichte zurückzuführen“ (Wolfgang Zorn). Er beanspruchte auch seit 1835 den Titel eines ‚Herzogs in Schwaben‘, begnügte sich aber dann bei seinem Majestätswappen mit den rot-weiß-goldenen Sparren der ehemaligen vorderösterreichischen Markgrafschaft Burgau; erst 1923 übernahm der Freistaat Bayern den (halben) staufischen Löwen in Erinnerung an das mittelalterliche Herzogtum Schwaben.
Argumentierte man im neuen bayerischen Staat des 19. Jahrhunderts mit diesem historischen Konstrukt ‚Schwaben‘, so verband es sich in vielfältiger Weise wieder mit dem Ausgangspunkt: den Alemannen. Man besann sich auf ihren angeblichen Freiheitswillen; beispielsweise in der Form des Schwanks von den ‚Sieben Schwaben‘, der vom Spätmittelalter bis in die Romantik beliebt war und nun mit Ludwig Aurbacher seine humoristische literarische Form erhalten hat. Nicht selten leitete man daraus aber auch partikulare Interessen ab. Die jeweilige Dominanz der Staaten sollte damit kompensiert werden und mündete in die politische Denkfigur eines ‚Großschwaben‘, die das 20. Jahrhundert in verschiedenen Varianten erlebte: etwa als ‚Bundesstaat oder Reichsstaat Schwaben‘ vom Elsass und der deutschen Schweiz, Vorarlberg bis Württemberg und Bayerisch-Schwaben, wie er 1918 im Ulmer ‚Schwabenkapitel‘ angedacht wurde, oder in einer Instrumentalisierung gemeinschwäbischen Bewusstseins in der Krise der 20er-Jahre und in der regionalen NS-Politik Bayerisch-Schwabens, bis hin zu einer autonomen ‚Schwäbisch-alemannischen Demokratie‘ nach dem Zweiten Weltkrieg.
Doch das waren und blieben unrealistische Träume; realiter blieb die Illergrenze bestehen und wurde zunehmend zu einer Scheidelinie nicht nur zwischen den deutschen Staaten bzw. Ländern, sondern auch der Wahrnehmung und damit der Kulturen: Schwaben war aufgeteilt an Württemberg (ohne oder mit Baden) und Bayern – von der deutschen Schweiz spricht heute in dieser Hinsicht keiner mehr. Die Ausdehnung ‚Bayerisch-Schwabens‘ als Erbe napoleonischer Zeit hat sich bis heute erhalten, wenn auch mit Modifikationen: zunächst als ‚Oberdonaukreis‘ von 1817, seit 1837 unter Einschluss des Ries unter dem Namen ‚Schwaben und Neuburg‘, weil der Rückgriff auf das alte wittelsbachische Fürstentum Pfalz-Neuburg die Verbindung anbot, seit 1939 allerdings nur noch ‚Schwaben‘. Erst seit 1944 griff die Ostgrenze mit dem Landkreis Friedberg wieder über den Lech hinaus, und die Gebietesreform von 1972 erweiterte mit dem Landkreis Aichach sogar noch die oberbayerische Komponente als Hinterland der Regierungshauptstadt Augsburg, während gleichzeitig Neuburg an Oberbayern abgegeben wurde – die wirtschaftsrationale Gegenwartsorientierung der Verwaltung erhielt nun Oberhand.
Was war und ist also Schwaben, zumal in Bayern? Keineswegs ein vorgegebener Raum, sondern eine Abfolge von Konstrukten, von subjektiven Zugehörigkeiten, oder anders gesagt: von Vorstellungen davon, wie sich solche in Räumen abbilden lassen. Das heutige bayerische Schwaben ist ein Ausschnitt aus einer ehemals weiterreichenden historischen Landschaft, die sich mit dem Begriff ‚Schwaben‘ verband, genauer: sein östlicher Teil. Deshalb kann die folgende Darstellung auch nicht an den Grenzen des Regierungsbezirkes an der Iller Halt machen. Doch wenn man der Auffassung folgt, dass die jeweilige Kultur wesentlich eine Prägung durch die Geschichte ist und nicht durch eine angebliche Stammesmentalität, die einem in die Wiege gelegt wird, dann ist es auch zulässig, diesem ‚Ostschwaben‘ seine eigenen Wege zuzuschreiben. Und davon soll im Folgenden die Rede sein.
Die Grundlagen: Kelten, Römer und Alemannen
Die Zeit der prähistorischen Kulturen seit dem 6. Jahrtausend, die wir von der Archäologie rekonstruiert erhalten, kann für eine ‚Geschichte Schwabens‘ kaum reklamiert werden, waren sie doch Teil großräumiger mitteleuropäischer Zusammenhänge. Erst mit den Kelten in der späten Latènezeit – benannt nach dem Fundort in der Ostschweiz –, dem letzten halben Jahrtausend vor den Römern, benennen die römischen Geschichtsschreiber einzelne kleinräumige Gruppen: die Likatier am Lech, die Estiones im Raum Kempten und die Brigantier um Bregenz, die unter dem Sammelbegriff der Vindeliker firmieren. Freilich finden sich in Schwaben keine der markanten keltischen ‚oppida‘, Stadtsiedlungen, wie sie im benachbarten Manching bei Ingolstadt ausgegraben wurden. Was man aber in großer Zahl findet, sind die ‚Viereckschanzen‘, fast quadratische Anlagen mit Wall und Graben, deren früher als sicher angenommene Funktion von Kultplätzen neuerdings wieder bezweifelt wird. Dann verlieren sich die eigenständigen Aspekte keltischer Kultur; sie sind wohl mit der römischen Zivilisation verschmolzen, weitgehend friedlich, vermutlich weil die Bevölkerung zurückgegangen und die Siedlungsplätze schon zum Teil verödet waren. Doch erst mit dem Vorstoß der Römer über den Alpenhauptkamm wurde Schwaben Teil einer eigenständigen süddeutsch-österreichischen Geschichtslandschaft.
Die römische Provinz Raetia
Im Sommer des Jahres 15 v. Chr. unterwarfen die römischen Truppen unter Tiberius und Drusus, den beiden Adoptivsöhnen des Augustus, in schnellem Vorstoß die rätischen und vindelikischen Stämme in den Alpen und deren nördlichem Vorfeld, ohne auf große Gegenwehr zu treffen. Der militärischen Besetzung durch kleinere Lager – eines bei Oberhausen an der Wertach als frühester Siedlung im Raum Augsburg – und ersten Straßenbauten folgte unter Kaiser Tiberius (14–37 n. Chr.) der Ausbau der erster Niederlassungen in Bregenz (Brigantium), Kempten (Cambodunum) und auf dem Auerberg (Damasia?), den alten keltischen Vororten. Kempten, die Stadt auf dem Lindenberg, wurde zum ersten Sitz des Prokurators der Provinz Raetia (et) Vindelica. Ob es die splendissima Raetiae provinciae colonia des Tacitus (41,1) war oder damit schon das frühe Augsburg gemeint war, darüber streiten sich die Historiker noch. Das Erscheinungsbild Kemptens war jedenfalls imponierend.
Die römische Provinz Raetien um 200 n. Chr. (nach Dietz u. a.)
Cambodunum
„Ein System rechtwinkliger Straßen gliedert den zentralen Bereich der Stadt in zehn meist längsrechteckige Häuserblöcke, in so genannte insulae. Als Bewohner der einzelnen Hausparzellen einer insula dürfen wir Händler und Wirtsleute annehmen, zu Vermögen gekommene Handwerker ebenso wie den Besitzer eines größeren Landgutes, der hier sein Stadthaus hatte, und wohl auch den einen oder anderen Reichsbeamten. Zu den Hauptstraßen hin waren die Häuser mit Portiken, einer Art überdachter Gehsteige versehen. Außerhalb des orthogonalen Straßensystems angelegt sind die Bauten am Südrand der Stadt, vor allem aber die nördliche und südliche Vorstadt …
Um die insulae herum ist eine Reihe von öffentlichen und halböffentlichen Bauten gruppiert: Außerhalb der Hauptausrichtung des Straßensystems lieg(en) ganz am Rande des Illerhochufers der ‚Gallorömische Tempelbezirk‘ … und die so genannten ‚Großen Thermen‘ mit einer Fläche von ca. 4500 m2 …
Das forum selbst fügt sich in seiner letzten Ausbauphase mit einer kleinen Abweichung ebenfalls in das zentrale Raster des Stadtgrundrisses ein. Über einen eigenen Torbau, eine Art Propylon, gelangte man direkt in die Säulenhalle, die den ca. 37 x 69 m großen Hof auf allen vier Seiten umschloss. Aus den Gebäuden, die diesen Hof umgaben, ragen drei besonders hervor: die dreischiffige basilica, die Gerichtshalle, an die im Nordwesten wohl das Archiv der vier in der basilica tätigen Magistrate anschloss, als zweites die curia, der Versammlungsraum des ordo decurionum, des Gemeinderats, und schließlich auf der gegenüberliegenden Schmalseite des Hofes der Forumtempel, wohl der kapitolinischen Trias Jupiter, Juno und Minerva geweiht …“ (Gerhard Weber)
Die Römer fanden keine dichte Besiedlung in Schwaben vor, und die Ortsnamen keltischen Ursprungs wie z. B. Cambodunum verweisen eher auf eine ‚Integrationspolitik‘ der Römer; sehr schnell wurden auch mit Rätern und Vindelikern eigene Kohorten des Heeres gebildet. Sie drangen nach Norden zunächst bis zur Donau vor, dann unter den flavischen Kaisern, insbesondere unter Trajan (98–117) und Hadrian (117–138), bis über die Alb hinaus. Der steinerne Limes mit seinen Kastellen und Wachttürmen markierte nun die Grenze zwischen der römischen Welt und den Barbaren des freien Germanien – und umschloss Schwaben von Aalen über Weißenburg bis Eining a. d. Donau. Die Provinz Raetien reichte freilich nach Westen bis zur oberen Donau und zum Bodensee, nach Süden bis zu den Alpenübergängen des Simplon und Splügen, über den Reschen und Brenner hinaus und bis zum Inn nach Osten. Die Erschließung mit einem relativ engmaschigen Straßensystem aufwendiger Kunststraßen folgte den geographischen Leitlinien. Das Rückrat war dabei zweifellos die Via Claudia im Lechtal, deren Trasse, 46/47 fertiggestellt, über Füssen (Foetibus), den Fernpass und den Reschen in großen Teilen rekonstruiert werden konnte und stellenweise sogar noch zu sehen ist. Sie erhielt eine Variante östlich des Lech, die dann über Partenkirchen nach Süden verlief, und eine weitere Nord-Süd-Linie folgte der Iller bzw. führte von der Donau bei Rißtissen an den Bodensee; eine wichtige Querverbindung kreuzte von Kempten über Epfach (Abodiacum) nach Osten, und weitere Hauptstraßen vernetzten Rätien mit den übrigen Hauptorten nördlich der Alpen. Zahlreiche Straßen- und Übernachtungsstationen ermöglichten Ruhepausen und Pferdewechsel. Lech und Donau boten für Schwerlast auf Kähnen bzw. Flößen leichtere Transportmöglichkeiten, wobei in Augsburg vor kurzem auch dazugehörige Hafenanlagen ergraben wurden.
Römische Zivilisation
Als Augsburg am Anfang des 2. Jahrhunderts die führende Rolle Kemptens als Residenzstadt übernahm, war es noch primär Truppenstützpunkt des römischen Statthalters, wohl 120/21 erhielt es das Stadtrecht und firmierte damit als municipium Aelium Augusta Vindelicum mit einer selbständigen Verwaltung: eine Stadt von 10–15 000 Einwohnern mit repräsentativen öffentlichen Steinbauten, einer künstlichen Wasserversorgung aus dem 35 km entfernten Hurlach und seit dem Ende des 2. Jahrhunderts auch einer Steinmauer.
Das pulsierende Leben prägten nun nicht nur die Militärs, sondern die Kaufleute mit einer breit gestreuten Warenpalette von wertvollen Stoffen bis zu Orientwaren, zusammengehalten von Korporationen unter einem Dachverband der negotiatores municipii. Und diese reiche Oberschicht baute sich auch ihre gediegen ausgestatteten Landsitze, die villae rusticae, im unmittelbaren Umland und dann weiter ausgreifend an den Flussterrassen, bevorzugt der Friedberger Lechleite. Von den großen Gutshöfen kamen die Lebensmittel in die Stadt, aber das Land verfügte auch über umfangreiche Produktionsstätten für Industriewaren. Besonders herausragend war das Töpferdorf Rapis (Schwabmünchen) an der Straße nach Kempten.
Das Töpferdorf Rapis
„Die günstige Verkehrslage, geeignete Tone und ausgedehnte Wälder in der Umgebung sowie zugewanderte Töpfer aus Gallien haben spätestens seit flavischer Zeit dem Keramikhandel zu einer Blüte verholfen, die weit über die Grenzen Rätiens hinaus gewirkt hat. Das über 200 m lange Straßendorf auf der Hochterrassenkante und am Straßenanstieg wurde spätestens um die Mitte des 1. nachchristlichen Jahrhunderts gegründet … Das Töpferdorf zählte im 2. Jahrhundert mindestens ein Dutzend Familien, die in ebenso vielen Landhäusern aus Holz lebten und arbeiteten … Über 70 Töpferöfen mit einem Füllvolumen von jeweils einem Kubikmeter sind bisher freigelegt und untersucht worden … Aus der Blütezeit des späten 2. Jahrhunderts sind durch Fabrikantenstempel auf den produktionstypischen Reibschüsseln einige Namen Schwabmünchner Töpfer und Töpferfamilien bekannt …, die zum Teil aus dem keltischen Milieu, zum Teil aus dem Sklavenmilieu stammen. Hergestellt wurde neben allen gängigen Formen des rauwandigen Haushaltsgeschirrs für Vorratskeller und Küche vor allem feines Tischgeschirr.“ (Wolfgang Czysz)
In Westheim bei Augsburg fand sich eine kaiserliche Ziegelei, ein Staatsbetrieb, der neben den üblichen verschiedenen Formen von Ziegeln für Bau, Dach oder Fußbodenheizung – mit Stempelmarken versehen – auch Tonmedaillons, Backformen und Öllampen herstellte; eine Spezialität war Tontafelgeschirr als Kopien von aufwendigen Metallgefäßen.
Viel über das alltägliche Leben erfahren wir auch aus den Grabdenkmälern der bürgerlichen Oberschicht, die am Ende des 2. Jahrhunderts ihre Handelsgewohnheiten abbildeten. Die Gräber in den Landfriedhöfen bei den Villen und Dörfern fielen mitunter sehr aufwendig aus, etwa das einer Frau unter einem runden Erdhügel von 15 m Durchmesser an der Straßenstation bei Wehringen mit einer Urne der Toten, Resten von Holzmöbeln, Geschirr aus Bronze, Keramik und Glas und einer Kosmetikausstattung. Auf dem gleichen Friedhof war auch ein Arzt bestattet worden, dem man sein chirurgisches Besteck, Medikamente und eine Tageskasse beigegeben hatte.
Tempel des Apollo Grannus in Phoebiana (Faimingen), erste Hälfte des 2. Jhs. (Teilrekonstruktion).
Die Verehrung der Götter galt in Rätien neben Jupiter als ‚Vater der Götter und Menschen‘ vor allem dem Merkur, dem Patron der Kaufleute. Einen guten Eindruck vom römischen Götterhimmel in der Provinz eröffnet der berühmte Weißenburger Schatzfund des 2./3. Jahrhunderts, der 1979 in einem Spargelbeet entdeckt wurde und heute Teil des Museums ist. Eine besonders ausgeprägte Bedeutung hatte der Heil- und Quellgott Apollo Grannus, dem man in Phoebiana (Faimingen), einem Ort bei Lauingen, einen eigenen Tempel weihte. Hier suchte sogar Kaiser Caracalla während seines Feldzugs gegen die Alemannen 212/13 Heilung.
Diese recht ruhige Phase ging mit der Krise des 3. Jahrhunderts zu Ende, die sich im gesamten Römischen Reich von den Rändern her immer deutlicher bemerkbar machte. In Rätien waren es seit 233 die Alemannen und die Juthungen – sie siedelten nördlich der Donau im Anschluss an die Alemannen –, die für permanente Unruhe sorgten. Auch ein spektakulärer Sieg im April 260 vor den Toren Augsburgs „über die Barbaren des Stammes der Semnonen oder/und Juthungen“ – an dem übrigens auch Germaniciani beteiligt waren – offenbart die „wirren und desolaten Zustände in Rätien“ zu dieser Zeit (Lothar Bakker). Er kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Rücknahme der Grenze die einzige Chance zur Stabilisierung bot: Es entstand der ‚nasse Limes‘ vom Rhein über den Bodensee und die Iller entlang der Donau; das nördlicher gelegene Gebiet wurde verlassen – aber nie offiziell aufgegeben, was sich in der Fortdauer des Namens Rätien in ‚Ries‘ zeigen mag. Der verbliebene Teil wurde systematisch befestigt: Binnenplätze wie der Lorenzberg bei Epfach (Abodiacum) oder der Goldberg bei Türkheim stehen dafür ebenso wie die Aufgabe der Stadt Kempten zugunsten eines kleineren Areals unterhalb der Burghalde. Zivile Plätze wie Günzburg (Guntia) oder die neuen Kastelle Kellmünz (Caelius Mons), Bürgle bei Gundremmingen (Pinianis) oder Burghöfe bei Mertingen (Sumuntorio), dazu die zahlreichen Wachttürme markierten die Grenze.
Römer und Alemannen
Die letzte Phase des Römerreiches nördlich der Alpen in ‚Schwaben‘ war von Rückzug und Auflösung bestimmt, aber auch von einem zunehmenden Verwischen der Konturen gegenüber den Germanen. Trotz einer gewissen Beruhigung in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts unter Konstantin (306–337), einer Zeit, in der die Provinz Rätien geteilt wurde und Augsburg nunmehr als Hauptstadt der Provinz Raetia secunda fungierte, wird erkennbar, dass zunehmend auch alemannischjuthungische Kohorten das rätische Grenzheer stellten – man spricht zugespitzt von einem ‚Bruderkrieg an der Grenze‘.
Gleichzeitig wurden Germanen aber auch im Inneren angesiedelt, um als eine Art ‚Bauernmiliz‘ rasch mobilisiert werden zu können. Dennoch war die Abwanderung nach Süden für viele Romanen der einzige Ausweg, und von den einst blühenden Siedlungen blieben nur noch verkümmerte Reste, sodass selbst die Versorgung der Provinz weitgehend aus Italien erfolgen musste. Nur mehr Augsburg war so etwas wie eine ‚romanische Hochburg‘, nicht zuletzt als Rückzugsort für die Landbevölkerung, während das flache Land immer mehr unter den Einfluss der Alemannen geriet.
Wer waren diese Alemannen? Die Namensüberlieferung und Deutung als ‚zusammengelaufene und vermischte Leute‘ stammt von dem antiken Schriftsteller Asinius Quadratus. Entgegen der romantischen Vorstellung vom einheitlichen alten Großstamm ist man heute einhellig der Meinung, dass das Selbstverständnis, das sich in diesem Namen spiegelt, auf eine „Ethnogenese der Alemannen aus verschiedenen, ethnisch unterschiedlichen Personengruppen“ im Vorfeld des Limes hinweist (Dieter Geuenich). Schon die Spitzenstellung von mehreren reges (Anführer, Könige) und dazu noch regales (Unterkönige) und optimates (Adelige), belegt in der Schlacht bei Straßburg 357, zeigt eine sehr differenzierte innere Struktur. Sie bildet sich in den archäologisch fassbaren Funden auf den zahlreichen Höhenburgen der Oberschicht im heutigen Württemberg ab – der ‚Runde Berg‘ bei Urach ist der bekannteste.
Die Herkunft der Alemannen ist freilich nur in Umrissen erkennbar, doch lassen die Ausgrabungsfunde immerhin den Schluss einer engen Verwandtschaft mit elbgermanischen Gruppen zu, vor allem aus dem Mittelelbe-Saale-Gebiet. Im Bestattungsritus hatten sie allerdings bereits einen Traditionsbruch vollzogen, nämlich die Körperbestattung in durchaus aufwendigen Grabbauten, während die Elbgermanen vorwiegend Urnenbestattungen vornahmen. Außerdem ist eine Abgrenzung zu den Juthungen, die wohl schon im späten 5. Jahrhundert in den Alemannen aufgegangen sind, bislang nicht möglich – also tatsächlich ein ‚zusammengewürfeltes Mischvolk‘.
Zudem finden sich untrügliche Zeichen einer kulturellen Angleichung bis hin zur ‚friedlichen Koexistenz‘ mit den Römern. Rätische Grabfunde belegen eine Mischung aus provinzialrömischen und germanischen Formen. Aber auch einzelne Gräber auf dem flachen Land – wie der Bestattungsplatz einer Kleinsiedlung bei Westendorf – enthalten noch Waffenbeigaben eindeutig germanischer Tradition. Auf eine Nachahmung römischer Lebensweise deuten andererseits die Verwendung von Keramik und die Metallverarbeitung, wie sie auf den alemannischen Höhensiedlungen üblich wurden. Der Gedanke ist nicht weit hergeholt, dass die aus schriftlichen Quellen belegten römischen Gefangenen der Alemannen auch Handwerker gewesen sein könnten. Selbst die befestigten Burganlagen lassen sich möglicherweise auf römische Vorbilder zurückführen.
Die breite Phase des Übergangs von der Antike zum Mittelalter wird in Rätien somit nicht nur als Abwehrkampf, sondern auch als langer friedlicher Akkulturationsprozess begreifbar. Dass Namensmaterial – die Fluss- und einige Ortsnamen – und zivilisatorische Techniken handwerklicher Arbeit wie agrarische Methoden dazugehören, ist unbestritten. Siedlungskontinuitäten sind schon wesentlich schwerer zu fassen, wie das Beispiel Augsburg zeigt: Hier ist es sehr plausibel, die weitere Existenz provinzialrömischer Bevölkerung anzunehmen, beim Gräberfeld von St. Ulrich und Afra gibt es Brücken bei der Bestattung bis ins 6. Jahrhundert, und jüngst ist nicht nur die Ausgrabung eines alemannischen Siedlungskomplexes in der Nähe des Domes an der südlichen römischen Stadtmauer gelungen, sondern im Dombezirk selbst wurde eine Schichtenfolge bis ins Mittelalter nachgewiesen. Auf dem Land muss man von der Nutzung römischer Villenbauten und ihrer agrarischen Ressourcen ausgehen – und sei es nur als Steinbruch –, ohne dass direkte Kontinuitäten nachweisbar wären; lediglich bei den spätrömischen befestigten Siedlungen, etwa dem Lorenzberg bei Epfach, ist eine solche Annahme begründet, weil hier in den Ruinen einer spätantiken Kapelle alemannische Siedler der Merowingerzeit einen Friedhof anlegten. Eindringende Germanengruppen, vor allem Alemannen, lebten zwischen Resten romanischer Bevölkerung.
Frühmittelalter: Bistum und Herzogtum
Nach dem Tod des Statthalters Aetius 454, der noch einmal den römischen Herrschaftsanspruch durchsetzen konnte, geriet Schwaben endgültig an den sich auflösenden Rand des Römischen Reiches. Abgesehen von der kurzzeitigen Episode eines Protektorats Theoderichs (493–526) über die Alemannen beider Rätien – die allerdings keine stärkeren Spuren hinterlassen hat – stand es nun im Spannungsfeld zwischen Italien und dem Frankenreich, das sich seit dem ausgehenden 5. Jahrhundert im Nordwesten etabliert hatte. Die Dynastie der Merowinger, die mit Chlodwig (481–511) gegen die Alemannen 496 siegreich geblieben war, dehnte ihren Einflussbereich systematisch nach Südosten bis zu den Bajuwaren aus: In beiden Gebieten etablierte sich ein eigenes ‚Stammesherzogtum‘ unter fränkischer Oberhoheit. Ostschwaben zählte zum alemannischen mit Schwerpunkt weiter im Westen um den Bodensee.
Die alemannische ‚Landnahme‘
Die ‚Landnahme‘ der Alemannen gestaltete sich weiterhin als wenig spektakulärer Prozess. Das Einsickern von Gruppen setzte sich bis ins 7. Jahrhundert fort, wobei die Ortsnamen auf -ingen und -heim (soweit sie echt sind) und die Reihengräberbestattungen die Leitlinien aufzeigen: Von den alten Schwerpunkten des Ries und der nördlichen Donauterrassen sowie des unteren Lech, der Wertach und der Iller gingen sie talaufwärts voran, erschlossen dann auch das obere Illertal. Im Mindeltal lässt sich der Besiedlungsvorgang genauer verfolgen: Er begann in Salgen um 500 und rückte bis Mitte des 7. Jahrhunderts über Mindelheim bis zum Ausbauort Dirlewang am Südende des Tales voran, getragen von einer „nur durchschnittlich wohlhabenden“ Schicht (Volker Babucke). Im 7. Jahrhundert treten als Träger zunehmend Adelige mit Herrenhöfen und qualitätvollen Grabbeigaben hervor wie in Schlingen oder Jengen. Pforzen (Forzheim) an einer Wertachfurt oder Spötting am Lech (heute ein Ortsteil von Landsberg) markieren die bevorzugte Lage an Flussübergängen bzw. Straßen; interessanterweise überschritten wohl alemannische Gruppen den Lech, ohne dass damit eine dauerhafte Entwicklung ausgelöst worden wäre.
In der fränkischen Zeit nach der Mitte des 8. Jahrhunderts folgte dann eine erste Phase der Binnenkolonisation mit den jüngeren Ortsnamen auf -dorf, -hofen, -hausen, -heim, -stetten, -beuren. Im Zuge einer ‚fränkischen Staatskolonisation‘ entstanden zudem wohl eine Reihe von heim-Orten mit charakteristischen Himmelsrichtungen (Sontheim, Westheim etc.) oder mit dem Bestimmungswort Franken-, aber auch Friesen-, Sachsen- oder Wenden-.
Seit der Mitte des 6. Jahrhunderts war die Situation bereits durch Verfestigungen bestimmt, die sich in den Benennungen und Lokalisierungen niederschlugen. So schrieb der ostgotische Geschichtsschreiber Jordanes um 551/52: Das Land der Schwaben (regio illa Suavorum) hat im Osten die Bayern (Baibaros) zu Nachbarn, im Westen die Franken, im Süden die Burgunder, im Norden die Thüringer; und wenig später, um 565, berichtete Venantius Fortunatus auf der Rückreise von einer Pilgerfahrt zum Grab des hl. Martin von Tours: Von Augsburg aus, wo du die Gebeine der heiligen Märtyrerin Afra verehren wirst, ziehe weiter gegen die Alpen, dort, wo die Sitze der Breonen liegen, wenn der Weg frei ist und der Bayer dir nicht entgegentritt. Feste Grenzen zu ziehen, wäre freilich voreilig, denn der Prozess der Ethnogenese war noch keineswegs abgeschlossen.
Christianisierung und Kirchenorganisation
Wie die Erwähnung des Afrakultes deutlich macht, gehörte zu den großen kulturprägenden Faktoren in dieser Zeit die Christianisierung. Ihre Anfänge liegen freilich im Dunkeln. So lässt sich nur schwer abschätzen, wie weit die antike Kulttradition, die mit Chur und Säben auch zwei Bischofssitze hatte, hier tatsächlich ins Mittelalter reichte. Die archäologischen Funde von Goldblattkreuzen und anderen christlichen Zeichen auf Gürteln weisen ins 7. Jahrhundert, das Zentrum Augsburg dürfte wohl in die gleiche Zeit zu setzen sein, auch wenn der erste urkundlich genannte Bischof erst mit Wikterp (um 740–772) sicher belegt ist. Man vermutet, dass König Dagobert I. (623–639) zusammen mit der Festlegung des Bistumssprengels Konstanz auch das östlich der Iller benachbarte Bistum Augsburg organisiert haben wird – immerhin verzeichnet ihn der Nekrolog, das Totengedenkbuch, von St. Ulrich und Afra unter seinen Stiftern. Bischofssitze und ihre Sprengel waren strategisch wichtige Machtfaktoren des Frankenreiches. Und so diente Wikterp neben Augsburg auch der alte Lechübergang Epfach als zeitweiliger Aufenthaltsort – an der Grenze zu Bayern.
Die Missionswellen der Irofranken sind für Schwaben eng mit dem heiligen Magnus verbunden, der allerdings erst zur zweiten Welle gehörte. Vorher war Columban mit Gallus um 610 vom fränkischen Königshof nach Bregenz zu den nationes Suevarum gekommen. Während er nach Italien weiter zog, blieb sein Gefährte Gallus in Arbon und gründete die Zelle an der Steinach, das Kloster St. Gallen (um 719) – und stand dabei in enger Verbindung mit dem Alemannenherzog Gunzo von Überlingen; bezeichnenderweise war sein erster Abt Othmar auch ein Alemanne, der seine Ausbildung in Chur erhalten hatte. Von dort aus zogen dann um die Mitte des 8. Jahrhunderts Magnus und Theodor ins Allgäu; Magnus wirkte in dem antiken Ort Epfach, gründete wohl eine Kirche mit Zelle in Füssen (nach 741) und das Kloster in Kempten (um 750), Theodor in Ottobeuren, das nach der Klosterüberlieferung 764 entstanden ist. Die Vita Sancti Magni schildert anschaulich die Weihe der Kirche des hl. Magnus in Kempten durch Bischof Wikterp und erwähnt dabei Audegarius als Gründer und ersten Abt des Klosters; dabei ist auch von einem castrum Campidonensis und von der Anwesenheit einer Menge an ‚Volk‘ (multitudine populis) die Rede. Freilich ist diese Quelle höchst umstritten, vielfach als legendär, als ‚Fälschung‘ auf die Seite geschoben worden, wird aber heute immerhin in ihrem Kern wieder als einigermaßen wahrscheinlich akzeptiert.
Der ‚monastische Aufbruch‘ in größeren und kleineren Niederlassungen war bedeutsam für die entstehende Kirchenorganisation. Die Besetzung der Bistümer aber war eine politische Frage. Das Augsburger Bistum war spätestens im 9. Jahrhundert fest in fränkischer Hand. Besonders wichtig wurde hier bereits Simpert (778–807), der das besondere Vertrauen Karls des Großen genoss; zu seiner Zeit wurde auch der Sprengel jenseits des Lech in Bayern und einschließlich des Ries bis Dinkelsbühl stabilisiert und dem Metropoliten in Mainz unterstellt. Die Ausbildung des Pfarreisystems betonte nicht zufällig mit einer Reihe von Martinspatrozinien, dem fränkischen Reichsheiligen, die politische Verbindung nach Westen.
Das alemannische Herzogtum
Die Herrschaft in Alemannien spiegelt sich im Kampf um das Herzogtum, auch wenn es erst nach und nach klarere Konturen bekommt: 536/37 vom Ostgotenkönig Witigis an den Merowingerkönig Theudebert I. (533–547) abgetreten, hatte es als Provinz des Frankenreiches zunächst eigene Führungsfiguren – die beiden ersten Heerführer, die Brüder Leuthari und Butilinus, waren zwar fränkische Amtsherzöge, handelten aber offenbar mit einer gewissen Selbständigkeit. Mit Gunzo von Überlingen, familiär mit den Merowingern verbunden, der um 680 zu einer Kirchensynode nach Konstanz einlud, wird sein Gebiet genauer greifbar: es war offenbar weitgehend identisch mit dem Bistum Konstanz.
Die Durchdringung des Landes durch die Franken geschah von den romanisierten Rändern aus in das Innere Alemanniens, Herzog Gottfried († 709) residierte dann um 700 bereits in Cannstatt am Neckar. Er war es auch, der versuchte, mit seinem Geschlecht ein eigenes Herzogshaus zu etablieren – wie es den mit ihm verwandten Nachbarn, den Agilolfingern in Bayern, schon seit langem gelungen war –, doch damit geriet er in einen massiven Gegensatz zu den fränkischen Hausmeiern aus dem Geschlecht der Karolinger, die die Herrschaft im Frankenreich nach und nach an sich gezogen hatten und sie nun expandierten. Unter Gottfrieds Söhnen, den Brüdern Lantfrid († 730) und Theudebald (reg. bis 746), kam es zum Machtkampf: Fränkische Adelige wurden als Grafen eingesetzt, um die Macht der Herzöge einzugrenzen; das Kloster Reichenau sollte als karolingische Gründung 724 einen geistlichen Gegenpol zum alemannischen St. Gallen bilden. Dann führten die karolingischen Brüder Karlmann und Pippin d. J. 742/43 erste Feldzüge gegen Herzog Theudebald – und gegen Herzog Odilo von Bayern; beide standen an der Spitze einer ‚Koalition der Unzufriedenen‘. Nach weiteren Niederlagen Theudebalds in den folgenden Jahren schlug Karlmann eine letzte Empörung blutig nieder. Von dem anschließenden Gerichtstag 746 wurde bald als dem ‚Blutgericht von Cannstatt‘ berichtet, bei dem Tausende von Adeligen wegen Hochverrats hingerichtet worden seien – die Quellen dazu sind freilich widersprüchlich. Tatsächlich aber war nach einer schrittweisen Entmachtung des alemannischen Herzogtums dessen Ende gekommen: Nun waren es fränkische Adelige, die den Ton angaben, sich aber mit dem Rest des alemannischen Adels vermischten – ein typischer Vorgang der Integration in das Karolingerreich. Das Ziel der Karolinger, den Zugang zu den Alpen auf breiter Front zu sichern, war erreicht.
Dieses ‚ältere Stammesherzogtum‘ gewinnt durchaus deutliche Konturen: An die Spitze des herrschenden Adels hatte sich ein Herzogshaus gesetzt, es hatte den Aufbau der Kirche vorangetrieben und mit der Lex Alamannorum ein Gesetzbuch erlassen. Wie die anderen germanischen ‚Volksrechte‘ auch – etwa die Lex Baiuwariorum oder die fränkische Lex Salica – zielte es darauf, mit einer schriftlichen Rechtsgrundlage wenigstens die „primitive Friedensordnung“ eines Bußenkatalogs als verbindliche Verfahrensform gegen die „destabilisierenden Rachemechanismen“ zu setzen (Clausdieter Schott). Der ältere Pactus wohl aus dem beginnenden 7. Jahrhundert wurde unter Herzog Lantfrid um 730 zur Lex erweitert – damals noch in engem Zusammenwirken mit dem fränkischen Königtum. Sie handelt vom Schutz der Kirche, von der Rolle des Herzogs als Gerichtsherr und Friedensgarant sowie als Heerführer und schließlich von den ‚Volkssachen‘ mit verschiedenen Rechtsfällen. Sie unterschied die Menschen in Unfreie und Freie, die wiederum in verschiedene Stände gegliedert waren: die ‚minderbemittelten Freien‘ (baro minoflidis), die ‚mittleren Standes‘ (medianus) und die ‚hohen Standes‘ (primus Alemannus). Das ‚Wergeld‘, das als Buße bei den verschiedenen Vergehen zu entrichten war, war entsprechend abgestuft. Auch wenn es sich um rechtliche Kategorien handelte, so spiegelt sich in ihnen doch auch die soziale Gliederung. Sie wurde ihrerseits nach Rang und Vermögen bemessen, nach der Größe der Hausgemeinschaften und der Nähe zum Herrscher, erkennbar nicht zuletzt auch am Wert der Grabbeigaben.





























