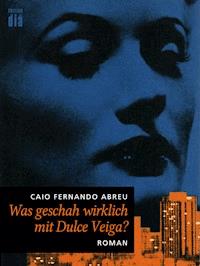Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition diá Bln
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Menschen, die hier das Wort ergreifen, befinden sich allesamt in existenziellen Ausnahmezuständen, die sich nur schwer mit einem gelassenen, geordneten Alltag vertragen: Verlassenwerden, Verrücktwerden, Rausch und Risiko, Ekstase und Ekel, Überschwang und Überleben, die erste große Liebe, die letzte große Liebe. In ihren Monologen verschränken sich stürmisch-animalisches Begehren und lebensphilosophisches Bohren, der Instinkt tritt gegen die Vernunft an, flankiert von Hypersensibilität und Alles-Egal. Diese Menschen, fragil und zäh zugleich, schwanken zwischen sehnsüchtiger Illusion und trotziger Desillusioniertheit. Sie wollen sich spüren, ihre Sinnlichkeit und Sexualität sind ein Tanz am Abgrund, ein Schritt ins Risiko. Sie treten uns zu nahe. Das geht an die Nieren und unter die Haut. Und selten gut aus. Was die Geschichten in ihrer intimen, drängenden Sprache nur umso wahrhaftiger und verstörender macht. Von Caio Fernando Abreu außerdem in der Edition diá: Was geschah wirklich mit Dulce Veiga? Ein Low-Budget-Roman Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Gerd Hilger ISBN 9783860345429
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
Die Menschen, die hier das Wort ergreifen, befinden sich allesamt in existenziellen Ausnahmezuständen, die sich nur schwer mit einem gelassenen, geordneten Alltag vertragen: Verlassenwerden, Verrücktwerden, Rausch und Risiko, Ekstase und Ekel, Überschwang und Überleben, die erste große Liebe, die letzte große Liebe. In ihren Monologen verschränken sich stürmisch-animalisches Begehren und lebensphilosophisches Bohren, der Instinkt tritt gegen die Vernunft an, flankiert von Hypersensibilität und Alles-Egal. Diese Menschen, fragil und zäh zugleich, schwanken zwischen sehnsüchtiger Illusion und trotziger Desillusioniertheit. Sie wollen sich spüren, ihre Sinnlichkeit und Sexualität sind ein Tanz am Abgrund, ein Schritt ins Risiko. Sie treten uns zu nahe. Das geht an die Nieren und unter die Haut. Und selten gut aus. Was die Geschichten in ihrer intimen, drängenden Sprache nur umso wahrhaftiger und verstörender macht.
»Herausragend in der modernen brasilianischen Literatur.« (Jornal da Tarde, Brasilien)
Der Autor
Caio Fernando Abreu, geboren 1948, studierte Literatur und Theater in Porto Alegre und lebte seit 1968 als freier Autor in São Paulo. Wie kein Zweiter beschrieb er die zahllosen Widersprüche des urbanen Brasilien. Zweimal erhielt er den bedeutendsten brasilianischen Literaturpreis Prêmio Jabuti. Sein Werk umfasst Romane, Erzählungen, Theatertexte, Songtexte und Drehbücher. 1996 starb er an den Folgen seiner HIV-Infektion. Onde andará Dulce Veiga? ist außer ins Deutsche auch ins Englische, Französische, Italienische, Niederländische und Spanische übersetzt worden.
Caio Fernando AbreuKleine Monster
Erzählungen
Ausgewählt und mit einem Nachwort von Gerd Hilger
Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Marianne Gareis, Gerd Hilger, Maria Hummitzsch, Gaby Küppers und Gotthardt Schön
Edition diá
Inhalt
Ohne Ana, BluesDie roten SchuheEine Geschichte mit SchmetterlingenKleines MonsterKarnevalsdienstagKönigin der NachtAn der GrenzeAugust und danach
Gerd Hilger:Zwischen allen Stühlen: mitten im Leben
Die ÜbersetzerQuellenImpressum
Ohne Ana, Blues
Für Dante Pignatari
Als Ana mich verlassen hat – dieser Satz ging mir nicht aus dem Kopf, und das in zwei Versionen –, und: Seit Ana mich verlassen hat. Ich weiß, das ist kein richtiger Satz, nur ein Satzanfang, aber genau der ging mir nicht aus dem Kopf. Denn ich dachte: Als Ana mich verlassen hat – und diese Verweigerung einer Fortsetzung war die einzige Form von Fortsetzung, die folgte. Zwischen diesem Als und diesem Seit gab es weder in meinem Kopf noch in meinem Leben etwas anderes als die Leere, die Ana hinterlassen hatte, obwohl ich sie hätte füllen können – die Leere ohne Ana –, auf ganz verschiedene Weise, mit allem nur Erdenklichen, Worten oder Taten. Oder wortlos und untätig, denn die Stille und die Starre waren in dieser Zeit zwei der weniger schmerzhaften Strategien, die meine Tage übernahmen, meine Wohnung, mein Bett, meine Spaziergänge, meine Abendessen, meine Gedanken, all die Ficks und anderen Dinge, die das Leben mit Ana ausgemacht hatten – und jetzt ohne sie ausmachten.
Als Ana mich verlassen hat, ungefähr zwanzig Uhr abends, stand ich sehr lange wie versteinert im Wohnzimmer, ihre Nachricht in der Hand. Jetzt im Sommer konnte man durch das offene Wohnzimmerfenster abends um acht noch ein letztes goldenes und rötliches Schimmern der Sonne auf den Hochhäusern Richtung Pinheiros erkennen. Sehr lange stand ich wie versteinert im Wohnzimmer, Anas letzte Nachricht in der Hand, und schaute zum Fenster hinaus auf all das Gold und Rot am Himmel. Ich weiß noch, dass ich dachte, das Telefon müsste jeden Moment klingeln, aber das Telefon klingelte nicht, und als das Telefon länger nicht geklingelt hatte, es hätte Lucinha aus der Agentur sein können oder Paulo vom Filmclub oder Nelson aus Paris oder meine Mutter aus Rio Grande do Sul, um mich einzuladen, zum Abendessen, Koksen und Nastassja-Kinski-Nackt-Sehen, um zu fragen, wie denn das Wetter sei und solches Zeug, und dann dachte ich, es müsste jeden Moment an der Tür klingeln. Vielleicht der Portier mit irgendwelcher Post, die Nachbarin von oben auf der Suche nach ihrer Perserkatze, die immer durchs Treppenhaus ausbüxte, oder gar eins dieser Kinder, dieser kleinen Monster, die allzu gern Klingelputzen spielten. Vielleicht auch nur ein Versehen, hätte doch sein können. Aber auch an der Tür klingelte niemand, keine Erlösung, und so stand ich lange wie versteinert im Wohnzimmer, das von der einbrechenden Nacht nach und nach in bläuliches Licht getaucht wurde, als befände ich mich in einem Aquarium, Anas Nachricht in der Hand, und das Einzige, was noch ging, war mein Atem.
Seit Ana mich verlassen hat – nicht genau in dem Moment, in dem ich dort stand, denn genau dieser Moment war der Als-Moment, nicht der Seit-Moment, und in dem Als-Moment passiert gar nichts, nur Anas Abwesenheit, genau wie eine Seifenblase, die glänzt, in der Luft hängt, schön in der Mitte des Wohnzimmers, und in dieser Seifenblase stecke auch ich bis jetzt fest, hänge in der Luft, allerdings ohne Glanz, im Gegenteil, ich bin trübe, matt, ohne jede Strahlkraft und stecke noch immer in einem der Anzüge, die ich zur Arbeit trage, habe nur die Krawatte leicht gelockert, weil Anfang Sommer ist und meine Hände vom herabrinnenden Schweiß feucht werden, so dass die Tinte von Anas Nachricht verläuft – seit Ana mich verlassen hat, wollte ich sagen, hab ich mir die Kante gegeben, wie es sich gehört.
Von den darauffolgenden Tagen behielt ich drei Geschmacksrichtungen im Mund – Wodka, Tränen und Kaffee. Den Geschmack von Wodka ohne Wasser oder Zitrone oder Orangensaft, Wodka pur, klar, leicht ölig, aus den Nächten zu Hause, in denen ich mich ohne Ana aufs Sofa setzte und aus dem einzigen Glas trank, das unser Streiten überlebt hatte. Der Geschmack von Tränen kam in den frühen Morgenstunden, wenn ich es schaffte, mich vom Sofa hochzuhieven und mich dann ohne Ana aufs Doppelbett im Schlafzimmer zu werfen, dessen Bettwäsche ich lange Zeit nicht wechselte, weil Anas Geruch noch darin hing, dann schlug ich mich selbst und zerkratzte mit meinen Fingernägeln wimmernd die Wände, umarmte das Kissen, als wäre es ihr Körper, und weinte haltlos, weinte und weinte, bis ich einschlief, trunken und traumlos. Der Geschmack von schwarzem Kaffee begleitete meine verkaterten Vormittage und die Tage in der Agentur, die sich irgendwo zwischen Werbetexten und meinem erschrockenen Zusammenzucken bei jedem Klingeln des Telefons abspielten. Denn inmitten von letzten Geschmacksresten aus Wodka, Tränen und Kaffee, von stechenden Kopfschmerzen, eklig aufsteigender Magensäure und geschwollenen Augen, vor allem an den Freitagen, kurz bevor die Samstage und Sonntage ohne Ana über mich hereinbrachen, wuchs die Gewissheit, dass urplötzlich und ganz natürlich jemand sagen würde, Telefon für dich, und am anderen Ende der Leitung würde eine vertraute Stimme sagen: Du fehlst mir, ich will zu dir zurück. Dazu kam es nie.
Was durchaus dazukam zu diesem Kreislauf aus Wodka, Tränen und Kaffee, war der Geschmack von Erbrochenem. Denn in den Augenblicken zwischen Wodka und Tränen, wenn ich mich vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer schleppte, kam mir der kleine Flur manchmal so endlos vor, als befände ich mich auf einem Hochseedampfer im Sturm. Auf dem Weg vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer, wenn ich in diesem Sturm durch den Hochseedampfer wankte, war es mir auf diesem kleinen, aber endlos wirkenden Flur einfach unmöglich, die Badezimmertür auszulassen. Ich kniete mich behutsam hin, umklammerte besonders behutsam die Kloschüssel aus gelber Keramik, so behutsam, als sei es Anas noch gegenwärtiger Körper, steckte die Brille mit den runden Gläsern und dem rötlichen Brillengestell umsichtigerweise in meine Brusttasche, schob mir den Zeigefinger immer tiefer in den Rachen, bis fast der ganze Wodka, zusammen mit ein paar Sandwichresten, sonst kriegte ich in diesen Tagen fast nichts runter, und dem untergemischten Geschmack der vielen Zigaretten, der sich aus meinem Mund in die Toilettenschüssel aus gelber Keramik ergossen hatte, die nicht Anas Körper war. Ich erbrach mich immer wieder, bis zum Morgengrauen, zurückgelassen mitten in der Wüste wie ein Heiliger, den Gott ausgesetzt hatte, auf dass er heftig büßte – und konnte nicht anders, als immerzu zu fragen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eine Antwort hörte ich nie.
Einige Zeit nach diesen Tagen, an die ich mich gar nicht richtig erinnern kann – weder daran, wie sie waren, noch, wie viele es waren, weil mir von ihnen nur dieser Geschmack von Wodka, Tränen, Kaffee und hin und wieder von Erbrochenem geblieben ist, worunter sich am Ende dieser Phase der Geschmack der Pizza mischte, die ich mir bringen ließ, meist an den Wochenenden, und die samstags, sonntags und montags verlassen auf dem Wohnzimmertisch den Tag begrüßten, inmitten überquellender Aschenbecher und nachts vollgeschmierter Servietten, die ich nicht mehr entziffern konnte und die wahrscheinlich so banale Dinge sagten wie »Bitte, Ana, komm zurück«, oder »Ich kann nicht ohne dich leben«, halb von Weinflecken und Pizzafett besudelte Wörter –, nach diesen Tagen begann die Phase, da ich Ana in allem, was ich war, abtöten wollte, im Bett, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, am Tisch, in der Wohnung und in dem Leben, zu dem mein Leben geworden ist, seit Ana mich verlassen hat.
Die hellgrüne Bettwäsche, in der noch Anas Geruch hing, gab ich in die Reinigung – es wäre zu grausam gewesen, mich jetzt an diesen Geruch zu erinnern, an genau den in der Kuhle zwischen Hals und Schulter, wo kein Mensch wie ein anderer riecht –, ich räumte die Möbel um, kaufte mir einen Kutka und einen Gregorio, eine Mikrowelle, leere Videokassetten, eine Ladung Weingläser und fing an, Frauen mit nach Hause zu nehmen. Frauen, die nicht Ana waren; Frauen, die niemals Ana hätten sein können; Frauen, die nichts mit Ana gemeinsam hatten und nie etwas mit ihr gemeinsam haben würden. Ana hatte kleine feste Brüste, darum suchte ich nach Frauen mit großen weichen; Anas Haare waren nahezu blond, also schleppte ich die Schwarzhaarigen ab; Ana hatte eine rauchige Stimme, deshalb suchte ich die mit den schrillen aus, die mir beim Vögeln vulgäres Zeug ins Ohr stöhnten, ganz anders als das, was Ana immer gesagt oder eben nicht gesagt hatte. »Liebster, mein Liebster« hat sie immer gesagt und »mein kleiner Süßer« und mit der rechten Hand meinen Hals und mit der linken meinen Rücken gestreichelt. Zu meiner Ausbeute gehörten Gina mit den schwarzen Höschen, Lilian mit den kalten grünen Augen, Beth mit dem kräftigen Hintern und den eisigen Füßen, Marilene mit dem kleinen Sohn und dem starken Zigarettengeruch, die japanischstämmige Mariko, die gern blond sein wollte, außerdem Mara, Luiza, Creuza, Júlia, Deborah, Vivian, Paula, Teresa, Luciana, Solange, Maristela, Adriana, Vera, Silvia, Neusa, Denise, Karina, Cristina, Márcia, Nadir, Aline, mehr als fünfzehn Marias und die heißen Bräute von der Rua Augusta, eine nach der anderen, mit ihren weißen hochhackigen Stiefeln und Lederminis, und schließlich die Mädels, die in den Zeitschriften ihre ganz speziellen Dienste anpriesen. Eine meinte, ich glaub, ich war schon mal hier, und ich sagte, keine Ahnung, kann sein, und wartete, dass sie sich ausziehen würde, während ich mir noch ein bisschen nachschenkte, um dann hoffentlich in sie eindringen zu können, aber mein Schwanz gehorchte mir so gut wie nie, also vergrub ich meinen Kopf zwischen ihren Brüsten und jammerte hilflos, weißt du, seit Ana mich verlassen hat, habe ich nie wieder, und obwohl mir mein Schwanz irgendwann endlich wieder gehorchte und ich einen elektrisierenden trockenen Orgasmus in ihr hatte, wischte ich mich mit einem Handtuch ab und warf sie mit einem fetten und sogar gedeckten Scheck raus – und dann schmiss ich mich bäuchlings aufs Bett und bat Ana, mir zu verzeihen, dass ich sie so verraten hatte, mit diesen Flittchen. Ana, die mich verlassen hatte, zu verraten schmerzte mich mehr als die Tatsache, dass sie mich verlassen hatte, ohne sich darum zu scheren, dass ich jede Nacht bei heftigem Sturm in diesem endlosen Seedampfer-Flur meiner Wohnung Schiffbruch erlitt, ohne Rettungsboot weit und breit.
Seit Ana mich verlassen hat, gab es, viele Monate später, auch die Phase der Mariä Verkündigung, des I Ging, der Wahrsagerei mit Muscheln, der Tarotkarten, des Pendelns, des Hellsehens, der Zahlenmystik und der positiven Candomblé-Energie – sie kommt zurück, versicherten sie mir, aber sie kam nicht zurück –, und natürlich folgte darauf die Phase der Gruppentherapie, des Psychodramas, der Jung’schen Traumtheorie, der Workshops in Transaktionsanalyse, als Nächstes folgte die Phase der Demut in Form von Gelübden vor Santo Antônio, von Sieben-Tage-Kerzen, Santa-Rita-Novenen und Spenden für die armen verlassenen Kinderchen & Alten, worauf dann die Phase mit dem neuen Haarschnitt kam, dem neuen Brillengestell und hipperer Kleidung, Zoomp, Mr. Wonderful, dazu Bodybuilding, Stretching, Yoga, Schwimmen, Tai-Chi, Hanteln, Jogging, und auf einmal war ich so attraktiv, so innovativ, so progressiv und demonstrativ frei vom Gedanken an die Zeit, in der Ana mich noch nicht verlassen hatte, dass ich mir nun auch die Phase der Strandwochenenden in Búzios, Guarujá oder Monte Verde gönnte, und plötzlich vielleicht, wer weiß, auch Carla, Vicentes Frau, so verständnisvoll & reif, und unerwartet Mariana, Vicentes Schwester, so willig & natürlich in ihren Metallic-Stringtangas, und dann, warum nicht, Vicente selbst, so zuvorkommend in der Art, wie er Eiswürfel in meinen Whisky gab oder auf der Achatplatte eine großzügige Line zog und dabei ganz leicht seinen muskulösen, von Sonne & Windsurfen braungebrannten Schenkel gegen meinen Schenkel presste, der ebenso von Sonne & Windsurfen braun gebrannt war. Es ist sehr viel Zeit vergangen, seit Ana mich verlassen hat, und ich habe überlebt. Die Welt wurde immer mehr zu einem riesigen, weit aufgerissenen Fächer tausender Möglichkeiten, die nicht Ana waren. Ach, diese neue Welt voller schöner und verführerischer Männer und Frauen, interessant und an mir interessiert, so dass ich nach all diesen Übungen im Ana-Vergessen lernte, auch schön zu sein, und durch diesen ganz besonderen Charme eines »fast ausgereiften und schon vom Verlust einer großen Liebe geprägten Mannes« auch verführerisch wurde, obwohl ich ausreichend Taktgefühl besaß, das Thema nie anzuschneiden. Denn nie habe ich irgendwem von Ana erzählt. Nie habe ich Ana mit irgendwem geteilt. Keiner hat je von all dem erfahren, was ich durchgemacht habe, als und seit Ana mich verlassen hat.
Vielleicht ist all das der Grund, weshalb ich an den Abenden jetzt, so lange Zeit danach, wenn ich im Sommer gegen zwanzig Uhr von der Arbeit komme und durchs Wohnzimmerfenster noch Spuren von Gold und Rot über den Hochhäusern von Pinheiros zu sehen sind, während ich die zahlreichen Nachrichten, Einladungen und Angebote auf dem Anrufbeantworter abhöre, immer – obwohl sich alles geändert hat und es mir inzwischen sehr gut geht –, immer das seltsame Gefühl habe, dass jener Tag auf ewig bestehen bleibt, wie eine verhexte Uhr, die in einem bestimmten Moment stehengeblieben ist – in diesem einen. Als würde das »als Ana mich verlassen hat« kein Danach kennen, kein »seit«, als stünde ich noch immer wie versteinert hier mitten im Wohnzimmer, das unseres war, ihre letzte Nachricht in der Hand. Die Krawatte leicht gelockert, weil es so heiß war, so heiß ist, spüre ich, wie mir der Schweiß am ganzen Körper hinabrinnt, über die Brust, die Arme, bis hin zu den Handgelenken, von wo er über die Handinnenflächen wandert, die Anas letzte Nachricht halten, wodurch die mit Tinte geschriebenen Buchstaben ihrer Worte verschmieren und nach und nach verschwimmen, vom Schweiß ausgelöscht werden, ohne dass ich sie vergessen kann, ganz gleich, wie viel Zeit vergeht, in der ich so oder so und auch ohne Ana weitergehe. Worte, die harte Wahrheiten sagen, trocken, unmissverständlich, unumstößlich: dass Ana mich verlassen hat, dass sie nie mehr zurückkommen wird, dass es nutzlos ist, nach ihr zu suchen, und schließlich, dass es endgültig aus ist, ganz gleich, wie sehr ich mich dagegen wehre. Und darum fühle ich mich jetzt für immer wie eine Seifenblase ohne jeden Schimmer, die mitten im Wohnzimmer in der Luft hängt und wartet, dass eine Windbö durchs offene Fenster hereinkommt und sie davonträgt, weg von diesem Ort, sie mitnimmt, diese dumme Seifenblase, oder dass jemand mit einer Nadel in sie hineinsticht, damit sie platzt, ganz plötzlich, in diesem bläulichen Licht, das eher wirkt wie das Innere eines Aquariums, und verschwindet, ohne auch nur die geringste Spur zu hinterlassen.
Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Maria Hummitzsch
Die roten Schuhe
Für Silvia Simas
»Tanzen sollst du«, sagte der Engel, »tanzen auf deinen roten Schuhen […] Tanzen sollst du von Tür zu Tür […] Tanzen sollst du, tanzen.«Hans Christian Andersen: Die roten Schuhe
1
Es war also vorbei. Man weiß es einfach, wiederholte sie immer wieder, während sie sich im Spiegel in die Augen schaute, irgendetwas in einem weiß immer genau, dass es vorbei ist. Oder dass es anfängt: ein im Magen sitzender Schreckmoment. Wie in einem dieser Achterbahn-Wagen, wenn man am höchsten Punkt angekommen ist und gleich auf den Schienen nach unten schießt, direkt auf – ja, worauf zu? Nach all den Berg- und Talfahrten direkt zu auf diesen unerträglichen Punkt der Austrocknung jetzt.
Aber immerhin, rauchen konnte sie noch, also steckte sie sich eine Zigarette an. Beim ersten Zug stützte sie den Kopf auf die Hände, was ganz nebenbei die Haut am rechten Auge straffte. Besser, viel besser, weg mit den Spuren der Verwüstung und glaubwürdigen Erschöpfung einer alleinstehenden fast Vierzigjährigen, murmelte sie vor sich hin, immer wieder, ungnädig mit sich selbst. Mit den Fingern der linken Hand straffte sie jetzt auch die Haut am anderen Auge. Nein, nicht so doll, da seh ich ja wie eine Japanerin aus. Eine Japse, eine Geisha, genau das bin ich doch. Die unterwürfige Hure, die ein Abendessen bei Kerzenschein inszeniert – Glenn Miller oder Charles Aznavour? –, zielsicher Badesalz – Kamille oder Lavendel? – ins Wasser gibt, Whisky einschenkt – heute einen oder zwei Eiswürfel, Liebling?
Ohne Eiswürfel, beschloss sie. Und kippte das Glas noch mal voll. Das hatte sie von ihm, vorher hatte sie das gar nicht gemocht. Verlorene Zeit, reine Zeitverschwendung. Und komm mir jetzt bloß nicht mit »du hast es doch auch ganz schön gehabt, oder etwa nicht«? Sein Kopf hingebungsvoll auf deinen Knien, wie du langsam die Finger aus den Haaren dieses Mannes löst. Du hättest dich mal dabei sehen sollen: in diesen Augenblicken hat sich ein Glanz und ein Lächeln auf dein Gesicht gelegt, ohne dass du gelächelt hättest, die Augen geschlossen, vollkommen versunken. War das denn alles nichts, Adelina?