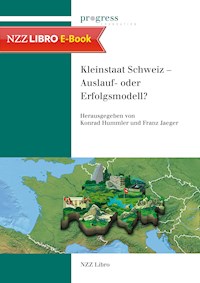
Kleinstaat Schweiz - Auslauf- oder Erfolgsmodell? E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was macht einen Kleinstaat aus? Welche Wege sind für einen Kleinstaat wie die Schweiz tatsächlich umsetzbar? Wie viel Eigenständigkeit ist sinnvoll und möglich? Was bedeutet es für die Schweiz, wenn Europa politisch kippt? In diesem Buch setzt sich eine interdisziplinäre Autorenschaft mit dem Phänomen Kleinstaat auseinander, skizziert Denkanstösse und Lösungsalternativen. Ein zwingender und dringender Beitrag zur aktuellen Positionierungsdebatte der Schweiz auf dem europäischen Kontinent und in der Welt. Mit Beiträgen von Carl Baudenbacher, Thomas Bieger, Mathias Binswanger, Micheline Calmy-Rey, Reiner Eichenberger, Katja Gentinetta, Heinz Hauser, Karen Horn, Konrad Hummler, Franz Jaeger, Martin Janssen, Hermann Lübbe, Daniel J. Mitchell, Robert Nef, Christoph Schaltegger, Urs Schoettli, Gerhard Schwarz, Rainer J. Schweizer, Hans-Werner Sinn, Michael Wohlgemuth und Stefan C. Wolter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kleinstaat Schweiz –Auslauf- oder Erfolgsmodell?
Herausgegeben vonKonrad Hummler und Franz Jaeger
NZZ Libro
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2017 NZZ Libro, Neue Zürcher Zeitung AG, Zürich
Der Text des E-Books folgt der gedruckten erweiterten Neuauflage 2017 (ISBN 978-3-03810-236-6)
Lektorat: Ruth Rybi, Gockhausen-Zürich
Titelgestaltung: Seiler / Graphik und Design GmbH
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN E-Book 978-3-03810-306-6
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Neuen Zürcher Zeitung
A. Einleitende Reflexionen
Vorwort
Franz Jaeger
Friedrich Dürrenmatt mag recht haben: Aus historischer Innensicht versteht sich die Schweiz zwar weder als Nation noch als Kleinstaat, sondern eher als ein föderalistischer Bund von kantonalen Kleinstaaten. Aus internationaler bzw. globaler Aussensicht dagegen wird die Schweiz geradezu als Klassiker einer kleinstaatlichen Entität wahrgenommen. Und auch völkerrechtlich wie ökonomisch gesehen erfüllt sie – dank ihrer relativen Kleinheit sowie dank ihrer souveränen gemeinschaftlichen Aussen-, Sicherheits- und Währungspolitik – zumindest die wichtigsten kleinstaatlichen Prärogativen.
Was macht denn überhaupt einen Kleinstaat aus, welche Konfiguration von Eigenschaften charakterisiert ihn? Was vermag ihn – evidenterweise – so erfolgreich zu machen? Welches sind seine Risiken, welches seine Chancen, und wo liegen seine Grenzen? Solche Fragen zu beantworten, erweist sich alles andere als trivial. Denn wer einen Blick in die breite Literatur zum Thema wirft, wird entdecken, dass es sich beim Kleinstaat um ein weder quantitativ noch qualitativ stringent definierbares Konzept handelt. Dass Kleinstaaten relativ klein, zumeist stark urbanisiert, ja sogar metropolitan geprägt, völkerrechtlich (relativ) souverän und sowohl sozioökonomisch wie ethnisch eng mit ihren Nachbarregionen verflochten sind, wird wohl allgemein akzeptiert.
Das vorliegende Buch setzt sich indes nicht nur mit der Begrifflichkeit, der Theorie und der Empirie des Phänomens «Kleinstaat» auseinander. Vielmehr geht es darüber hinaus der Frage nach, inwieweit sich der Kleinstaat genuin durch Eigenschaften wie innere Machtbalance, Souveränität, Universalität und Neutralität auszeichnet oder zumindest von davon herrührenden komparativen Vorteilen profitieren kann. Dabei gilt es auch die Nachteile, Risiken und Gefahren zu diagnostizieren, die den Kleinstaaten aus ihrer extremen Exposition auf den Weltmärkten, aus ihrer eklatanten ökonomischen Auslandabhängigkeit, aus ihrem geopolitischen Einflussmanko und aus ihren kleinheitsbedingten Skalierungs- und Binnenmarktnachteilen wie aus ihrer marginalen Position im Geflecht der globalen (von Grossstaaten weitgehend dominierten) Institutionen erwachsen. Und am Ende wird jeweils die Frage zu reflektieren sein, welche Konsequenzen sich aus dieser Diagnostik zuhanden der strategischen und operativen Politikgestaltung herleiten lassen, um als kleine offene Volkswirtschaft sozioökonomisch erfolgreich zu performen. Zu diesem Zweck versucht eine auserlesene, multidisziplinäre Autorenschaft, das Thema «Kleinstaat» breit auszuloten. Entsprechend bunt präsentiert sich die methodische Vielfalt: Neben theorie- und empiriebasierten Abhandlungen finden sich auch solche der feuilletonistischen, essayistischen und gar plädoyistischen Art.
Natürlich fokussieren wir uns bei unserer Spurensuche – nach einer global ausgerichteten Lagebeurteilung – auf den Kleinstaat Schweiz, nicht zuletzt, weil gerade er seit vielen Jahren praktisch in sämtlichen Standort-, Wohlstands- und Wohlfahrtsrankings weltweit Spitzenplätze einnimmt. Und das wohlvermerkt trotz einiger zum Teil politisch selbstverantworteter, interner Wachstumshemmnisse (wie bürokratische Markt- und Unternehmensregulative, Migrations-, Freihandels- und Globalisierungswiderstände, stark überbewerteter Schweizer Franken usw.). Der relative Erfolg des Kleinstaats Schweiz erstaunt dabei umso mehr, als sich diese gegenwärtig immerhin in einem turbulenten europäischen Umfeld bewegen muss – umgeben zudem von einem supranationalen Währungsraum, der seit 2007 zu einem dysfunktionalen Gemeinschaftskonstrukt mutiert und dabei schleichend in eine politische, finanzielle und strukturelle Existenzkrise zu geraten droht.
Konkret interessieren uns folgende Fragen: Wie steht es um die globalen und europäischen Rahmenbedingungen? Warum sind Kleinstaaten vielfach sowohl mikro- als auch makroökonomisch, sowohl konjunkturell als auch strukturell im Vorteil? Warum performen sie, wie etwa im Fall der Schweiz, selbst im Krisenfall oft besser als grosse Flächenstaaten? Und wenn dem so ist: Wie lassen sich (wie etwa im Fall Deutschlands) die Ausnahmen von dieser Regel erklären? Eignet sich ein Kleinstaat grundsätzlich auch besser für eine direktdemokratische Ordnung als ein grosser bevölkerungsreicher Flächenstaat? Wie lässt sich schliesslich verhindern, dass Spannungen zwischen Stadt und Land, zwischen Sprachregionen und Landesteilen, zwischen Eliten und Bürgergesellschaft den heterogenen Kleinstaat intern lähmen und das Land in seinen Aussenbeziehungen zum Vasallen einer grossen supranationalen Struktur werden lassen? Und nicht zuletzt: Welche Migrations- und welche Aussenwirtschaftspolitik ist für einen Kleinstaat optimal? Wie verschafft er sich in einer globalisierten Welt und im unüberschaubaren Geflecht von internationalen Organisationsstrukturen mehr Gehör? Wie kann der Kleinstaat trotz schwindender Autarkie und Autonomie seine genuinen Souveränitätsspielräume erhalten, seine politischen und ökonomischen Interessen im internationalen Kontext durchsetzen, wie seine innere und äussere Sicherheit gewährleisten? Letzteres insbesondere, wenn er sich, wie die Schweiz, der Neutralität verpflichtet hat?
Das also eine Auswahl von Fragen, die nachfolgend aus unterschiedlichen Blickwinkeln reflektiert und diskutiert werden sollen. Dabei geht es in erster Linie darum, Denkanstösse zu vermitteln sowie Diagnosen und Lösungsalternativen zu skizzieren. Mithin sollen durchaus auch kontroverse oder redundante Positionen bezogen werden können. Anliegen des Buchs ist es, einen gesellschaftlichen Diskurs darüber zu befeuern, wie sich ein Kleinstaat in einer globalisierten Welt integrieren, positionieren und präsentieren soll, ohne seine Eigenständigkeit und Identität zu verlieren, ohne seine Standortvorteile und seine Wertordnung aufzugeben. Natürlich interessiert uns auch dies: Was können bzw. müssen kleine offene Staaten unternehmen, um ihre kleinstaatlichen Erfolgsgeschichten selbst bei zunehmender räumlicher und demografischer Enge im eigenen Land fortzusetzen und nicht zuletzt Opfer ihres eigenen Premiumstatus zu werden?
Die vorliegende Sammlung von Beiträgen gliedert sich in drei Teile. Zunächst sollen – nach einigen einführenden Reflexionen – im Rahmen einer umfassenden Lagebeurteilung die europäischen und weltweiten Rahmenbedingungen aufgearbeitet werden. In einem zweiten Teil wird sodann auf die Chancen und Risiken des Kleinstaats eingegangen und dabei auch die spezifische Ausgangslage für unser Land als Kleinstaatklassiker diagnostiziert. In einem dritten Teil gilt es schliesslich, verschiedene strategische Optionen und Reformvorschläge, wiederum mit Fokus auf die Schweiz, herauszuarbeiten. Beim vorliegenden Nachschlagewerk handelt es sich also nicht einfach um eine Zweitauflage, sondern um eine stark überarbeitete, nicht mehr auf den Stadtstaat fokussierte, zudem aktualisierte und thematisch erweiterte Wiederauflage des vergriffenen Buchs Stadtstaat – Utopie oder realistisches Modell?. Erweitert wurde übrigens auch der Kreis der Autoren.
Zum Schluss bleibt mir zu danken. So etwa der Progress Foundation und ihrem Präsidenten Gerhard Schwarz sowie der Stiftung Fidinam, allen voran deren Präsidenten und unserem Mentor Tito Tettamanti – hat dieser die Realisierung des Buchs doch erst überhaupt möglich gemacht. Herzlicher Dank gebührt sodann meinem Koherausgeber Konrad Hummler und unseren engagierten Mitautoren für ihren kreativen Input sowie auch unseren wissenschaftlichen Mitarbeitern Simon Kuster, Tobias Trütsch und Daniel Vogt für die Umsicht und Geduld, mit der sie die Genesis des Buchprojekts bis hin zur Drucklegung begleitet haben.
Einführende Reflexionen zum Thema Kleinstaat
Franz Jaeger
Kleinstaaten haben in der Geschichte bis zurück in die Antike sowohl politisch als auch wirtschaftlich immer wieder eine bedeutsame Rolle gespielt. Dennoch ist Kleinstaatlichkeit in der Wissenschaft erst spät zum Thema geworden. Dies obwohl Kleinstaaten schon früher, nicht zuletzt dank ihrer oft urbanen, vielfach sogar metropolitanen Prägung, dank ihrer Souveränität und dank ihrer universellen Offenheit von relativ grosser sozioökonomischer Bedeutung und Ausstrahlung waren. Heute gelingt es vielen von ihnen sogar, trotz politischer Inferiorität und selbst unter zunehmend härteren globalen Wettbewerbsbedingungen, wohlfahrts- und makroökonomische Erfolgsgeschichten zu schreiben. Nachhaltig die Nase vorn haben jedoch selbst urban geprägte Kleinstaaten nur, solange sie ihre spezifischen komparativen Vorteile zu nutzen verstehen. Entscheidend dabei ist, dass sie auch willens und in der Lage sind, kleinstaatsspezifische Herausforderungen wie Migrationsdruck, Währungsrisiko, Auslandabhängigkeit, binnenwirtschaftliche Isolierung und räumliche Enge zu meistern. Solches soll nachfolgend reflektiert werden. Ganz besonders interessiert uns dabei, warum sich die Schweiz als typisch kleinstaatlicher Outperformer in einer besonders komfortablen Lage befindet. Um dies auszuloten, gilt es ihre komparativen Standortvorteile vertieft zu diagnostizieren, allerdings nicht ohne auch auf ihre kleinstaatlichen Handicaps und auf ihre speziellen Herausforderungen als EU-Nichtmitglied einzugehen.
Throughout the course of history, even as far back as antiquity, small states have repeatedly played a pivotal role politically and economically. Yet the nature of small states only became the subject of study somewhat late. This was in spite of the fact that even very early on their often urbane, frequently even metropolitan character, their sovereignty and their universal openness meant they had great socio-economic significance and resonance. Today many of them, despite their political inferiority and often given increasingly tough global economic conditions, can even be considered success stories in terms of their prosperity and macroeconomic status. However, even the primarily urban small states have only managed to stay ahead of the game when they have understood how to make use of their specific comparative advantages. Here it is crucial that they are willing and able to tackle challenges specific to small states, such as migration pressure, currency risks, dependency on other states, internal commercial isolation and a lack of space. These matters are to be addressed in the following. What particularly interests us here is why Switzerland, as a typical small-state «outperformer», finds itself in a particularly comfortable position. In order to explore this question, we need to examine the comparative advantages of its location in depth, although not without addressing the handicaps of being a small state and the special challenges it faces as a non-member of the EU.
1. Definitorisches und etwas Geschichte
Es mag überraschen, aber eine exakte Definition für das Phänomen «Kleinstaat», etwa in der Form eines OECD-normierten Zuteilungsstandards, ist nirgends zu finden. Deshalb erweist es sich als zweckmässig, die Staaten (und/oder deren Gliedstaaten) zunächst einmal anhand von Grössen- und Urbanitätsindikatoren zu beschreiben. Doch da steht man bereits vor einem Messproblem. Mit welchen Indikatoren lassen sich Grösse, Urbanität und Offenheit eines staatlichen Wirtschaftsraums quantifizieren? Sicher eignen sich hierzu am ehesten demografische und geografische Masse, wie etwa die Siedlungsdichte, die territoriale Fläche und die Bevölkerungswerte eines nationalen Wirtschaftsraums. Da zudem Staaten, sofern sie sich nicht der Autarkie verschrieben haben, mit abnehmender Grösse tendenziell stärker und enger mit dem Ausland verflochten sind, gilt es auch ihre grenzüberschreitende Offenheit zu spezifizieren. Dabei wird in diesem Buch zur Quantifizierung der Aussenbeziehungen von Staaten unter anderem auf Indikatoren zurückgegriffen, die helfen, sowohl ihre Integration in internationale Netze und Wertschöpfungsketten als auch ihren grenzüberschreitenden Austausch von Warengütern, Dienstleistungen sowie von Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital, Wissen) in Relation zur heimischen Wertschöpfung zu beziffern.
Sortiert man nun die Staaten aufgrund ihrer Grösse sowie aufgrund ihrer Offenheit und urbanen Durchdringung, so wird es möglich, sie zu rangieren.1 Dabei wird offenkundig, dass die Gruppe der Kleinstaaten nicht nur hinsichtlich der quantifizierten Messgrössen, sondern auch hinsichtlich ihrer qualitativen Charakteristika (wie etwa völkerrechtliche Souveränität und innerer Föderalismus, demokratische Willensbildung und Urbanität, innere Multikulturalität, demografische Vielfalt und ökonomisch-technischer Entwicklungsstand) eine überaus heterogene Staatenfamilie darstellt. Will man das Konzept «Kleinstaat» der theoretischen und empirischen Analyse zugänglich machen, kommt man deshalb nicht darum herum, sich zwecks deskriptiver Abgrenzung auch qualitativer Methoden zu bedienen.
Nach überkommenem Verständnis steht der Begriff «Kleinstaat», wie soeben gesagt, vielfach auch für einen Staat, der im Gegensatz zum Flächenstaat dominant von städtischem Gebiet durchdrungen ist:2 z. B. durch mindestens eine grossstädtische Agglomeration oder Metropole ohne schwach besiedeltes, grossflächiges Hinterland, jedoch mit einem Umland, das politisch, sozial, demografisch, kulturell und ökonomisch eng mit dem urbanen Gravitationszentrum verflochten bzw. intensiv auf dieses ausgerichtet und stark von ihm geprägt ist.3 Dabei kann es sich sowohl um einen Nationalstaat (z. B. Singapur) als auch um einen souveränen Gliedstaat innerhalb eines föderalen Nationalstaats (wie früher Hamburg) handeln. Solche urban oder gar metropolitan geprägten Kleinstaaten (man nennt sie auch Stadtstaaten) sind in einzelnen Fällen nur als Enklaven über ein einziges Land oder – z. B. als Hafenstadt-Staat – über den Seeweg erreichbar. Sozioökonomisch in einem gewissen Sinn verwandt und – mit Vorbehalten – vergleichbar mit dem Typ «Kleinstaat» sind integrierte, metropolitan dominierte Wirtschaftsräume innerhalb von Grossstaaten (wie z. B. die Agglomeration München als kleine, offene Volkswirtschaft ohne volle Souveränität) als subnationale Region.
Für besonders interessant in diesem Zusammenhang halten wir die Evolutionsgeschichte des Kleinstaats Schweiz: Hier nämlich gewannen die städtischen Bürgergesellschaften während der ersten industriellen Revolution die Herrschaft über das Land. Gleichzeitig entwickelten sie sich zu urbanen Trägern des Liberalismus, der in der Folge in der schweizerischen Bundesverfassung von 1848 konkrete Verankerung fand. Dabei entstand – sowohl auf gliedstaatlicher, d. h. kantonaler, als auch auf kommunaler Ebene – ein System gemeinschaftlicher Rechts- und Wirtschaftsräume, das heute durch ein filigranes Meccano interner Gewaltenteilung und gegenseitiger Machtkontrolle zwischen Bundesstaat und Gliedstaaten geprägt ist. Verstärkt wird dieses Check-and-Balance-System durch direktdemokratische Elemente einer plebiszitären Kontrolle sowohl der Exekutiven (Regierung und Verwaltung) als auch der parlamentarischen Legislativen. Diese DNA unterscheidet die Schweiz deutlich von den beiden autoritativ verwalteten Stadtstaatklassikern Singapur und Hongkong.
2. Das Konstrukt «Kleinstaat» aus gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Sicht
Zunächst die Frage: Lohnt es überhaupt, sich mit dem Kleinstaat als Konzept auseinanderzusetzen? Denn immerhin war das Phänomen «Kleinstaat» dem internationalen politischen Diskurs bis vor wenigen Jahren höchstens einige Randnotizen wert. Das hatte zweifelsohne auch damit zu tun, dass Kleinstaaten in der Regel nur marginal auf das weltpolitische Geschehen Einfluss nehmen können. Zudem wurde Kleinstaatlichkeit, wenn überhaupt, vorwiegend negativ konnotiert. Und zwar ganz einfach deshalb, weil man den Kleinstaat als Konstrukt auf längere Sicht verbreitet für nicht oder bestenfalls nur für begrenzt überlebensfähig hielt. Ja, selbst in der ökonomischen Theorie, insbesondere in der Finanzwissenschaft, spielte die immerhin recht relevante Variable «Staatsgrösse» kaum eine Rolle. Denn auch die einschlägige Wissenschaft war lange Zeit der Auffassung, dass Kleinstaaten grösseren Staaten funktional und ökonomisch – genuin – unterlegen wären.
Mit Referenz auf die ökonomische Produktionstheorie wurde diese These wie folgt begründet: Je kleiner ein Staat und damit das dort angesiedelte Nutzungskollektiv sind, desto kostspieliger wird dessen Versorgung mit reinen öffentlichen Kollektivgütern (Sicherheit, Infrastrukturen, Rechtsstaatlichkeit usw.) wie auch jene mit gesellschaftlich relevanten, sogenannt meritorischen, Individualgütern (Ausbildung, Gesundheit, Alterssicherung usw.) pro einzelnen Steuerzahler. Kleinstaaten erreichen somit die «betriebsoptimale» Grösse zur Bereitstellung von öffentlichen Gütern oftmals nicht. Denn sie leiden unter Grössennachteilen infolge negativer Skaleneffekte auf der Nutzerseite. Solche Skalierungsdefizite können – vor allem dort, wo natürliche Anbietermonopole vorliegen – auch in der kleinstaatlichen Versorgung mit privaten Gütern auftreten. Dies unter anderem als Folge der suboptimalen Kleinräumigkeit kleinstaatlicher Binnenmärkte, verbunden mit wenig wirksamem Anbieterwettbewerb und hoher Abhängigkeit von ausländischen Märkten. Gestützt auf die produktions- und wettbewerbsökonomische Theorie will auf diese Weise letztlich erklärt werden, warum in Kleinstaaten tendenziell auch ein tieferes Wohlfahrtsniveau herrscht als in grösseren Staaten.
Für die finale These gibt es indes heutzutage keine empirische Evidenz (mehr) (vgl. Kocher, 2003). Seit einiger Zeit zeigt sich nämlich immer deutlicher, dass es SMOPEC-Ländern durchaus gelingen kann, kleinstaatliche Skalierungsnachteile durch Produkt- und Prozessinnovation in der Güterbereitstellung wettzumachen. Zudem können sie die Kosten der Bereitstellung nicht nur von privaten, sondern auch von öffentlichen Gütern entweder durch Outsourcing ins Ausland oder zumindest durch Kooperationen im Rahmen von internationalen Partnerschaften absenken.
Hinzu kommt ein zweites, wohl realitätsnäheres Positivum: Je kleiner Staaten sind, umso weniger sind sie zwar ökonomisch autonom oder gar autark und umso stärker werden sie von Auslandentwicklungen beeinflusst. Dennoch können sie, insoweit sie ihre Gesetzgebungshoheit bewahren, hinreichend souverän bleiben. Das erlaubt es ihnen, zumindest selbst zu bestimmen, ob, wann, wie und wie lange sie sich – sei es re- oder proaktiv – an exogene Einflüsse anpassen bzw. ob und wie sie sich den ausländischen Herausforderungen stellen wollen. So hat etwa die Schweizerische Notenbank (SNB) nach eingehender Diagnose der internationalen Währungslage souverän entschieden, den Schweizer Franken am 6. September 2011 faktisch an den Euro zu binden, um einige Jahre später, nämlich am 15. Januar 2015, die Limitierung des EUR/CHF-Kurses wieder aufzuheben.4 Dabei bleibt es Kleinstaaten selbstverständlich anheimgestellt, sich unter Umständen wirtschafts- und sicherheitshalber sowie gesellschaftspolitisch auch einmal mit ausländischen Partnern abzustimmen bzw. Allianzen zu schmieden.
Je grösser ihr Souveränitätsspielraum, umso mehr erwächst den Kleinstaaten – allerdings unter dem Vorbehalt zwingenden Völkerrechts und international eingegangener Verpflichtungen – die Möglichkeit, anderen Staaten gegenüber ein Gesetzgebungsgefälle einzurichten. Das wiederum eröffnet ihnen die Chance, nicht nur ökonomische Nischen zu besetzen, sondern auch standortsökonomische Vorzugs- oder gar Alleinstellungspositionen gegenüber dem konkurrierenden Ausland aufzubauen, vorzugsweise durch eine branchenmässige Clusterung in der Finanzindustrie oder im Tourismus (Kocher, 2003). Dabei profitieren heute Kleinstaaten nicht mehr wie früher von ihrer einstigen internationalen Unauffälligkeit, sondern sie bewegen sich mehr und mehr – nicht zuletzt dank global digitalisierter Kommunikationsnetze – im Radar sämtlicher supranationalen Watchlisten.5 Hierzu sei beispielsweise auf die schweizerischen Standortvorzüge in Sachen Bankgeheimnis und steuerliche Holdingprivilegien hingewiesen, die beide stets weltweit grosses Aufsehen erregten, mittlerweile jedoch auf internationalen Druck hin aufgehoben und in der Folge durch innovative, nicht diskriminierende Steuerreformen kompensiert werden müssen.
Ein Argument dafür, das die These stützt, wonach es offensichtlich immer mehr Kleinstaaten gelingt, ihre Skalierungs- und übrigen Grössennachteile nicht nur kompensieren, sondern sogar zu übertreffen bzw. im weltweiten Vergleich gar zu ökonomischen Outperformern aufzusteigen, liefert folgende Tatsache: Was George Orwell in seiner Utopie 1984 voraussagte, nämlich das Verschwinden sämtlicher Kleinstaaten, ist nicht eingetroffen. Im Gegenteil hat der Geschichtsphilosoph Hermann Lübbe mit seiner Prognose Recht bekommen: «Die Pluralisierung der Staatenwelt gehört nachgerade zu den auffälligsten, unsere Gegenwart fortdauernd prägenden Resultaten der politischen Evolution im 20. Jahrhundert. Allein in unserer Hemisphäre (von Europa, Nahosten bis ins westliche Zentralasien) hat sich nämlich während sieben Jahrzehnten die Zahl der national souveränen Kleinstaaten mehr als versiebenfacht.» (Lübbe, 2013). Aber auch die seit dem Millennium weiter steigende Zahl von Kleinstaaten wie auch die wachsende Zahl regionaler Segregations- und nationaler Exitbewegungen (so wie etwa in Spanien, Grossbritannien, Frankreich, Belgien und Italien) sind ein starkes Indiz dafür, dass Kleinstaatlichkeit zusehends – auch in ökonomischer Hinsicht – an Attraktivität gewinnt.
Zum Schluss noch ein eher humoriger und essayistischer, aber nichtsdestotrotz illustrativer Ansatz zur Stützung der optimistischen These kleinstaatlicher Attraktivität und Zukunftstauglichkeit: Die Schweiz als ein föderal und direktdemokratisch konfiguriertes Kleinstaatkonstrukt übt bekanntlich eine eminente Anziehungskraft auf sämtliche ihre Nachbarregionen aus.6 In all diesen Nachbarregionen soll nämlich ein «Schweiz-Beitritt», so haben es jedenfalls in den letzten Jahren breit angelegte Recherchen immer wieder erhärtet, einem klaren Mehrheitswunsch entsprechen.7 Das mag zwar kaum der Option der Regierungen in den europäischen Hauptstädten entsprechen, manifestiert sich aber immerhin in der Haltung der Bevölkerungen und lokalen Behörden der betreffenden Nachbarregionen zum gemeinsamen Nachbar Schweiz.8 Freilich: Selbst wenn die mehrheitliche Kundgebung der genannten Regionenvölkerschaften für einen Beitritt zur Schweiz vornehmlich dem Wunsch nach einem Kontrastprogramm zu ihrem frustrationsbeladenem Dasein in den eigenen Nationen und in der EU entspringen mag – zumindest als zusätzliches Fanal für die allgemein wachsende Beliebtheit des direktdemokratischen und föderalistischen Konzepts «Kleinstaat» darf sie allemal empfunden werden. Denn bezeichnenderweise wird der Drang zur Schweiz stets mit akkurat jenen Vorteilen von souveränen Kleinstaaten begründet, die in diesem Kapitel beschrieben werden.
3. Spezifische Charakteristiken des urban geprägten Kleinstaats
Welches sind nun im Einzelnen die charakteristischen positiven und negativen Elemente, die einen urban geprägten Kleinstaat ausmachen? Hierzu gilt es zunächst, einige vorwiegend positive Konnotationen zu erläutern, die einen unabhängigen, kleinen und metropolitan geprägten offenen SMOPEC-Staat kennzeichnen. Den Fokus legen wir dabei auf das Fallbeispiel «Schweiz».
3.1 Einfachere Entscheidfindung im Kleinstaat
Offensichtlich stellt ein urban durchdrungener Kleinstaat in der Regel auch eine SMOPEC dar: Tendenziell gehören nämlich Kleinheit, Urbanität und Offenheit zusammen. Vermutlich war es akkurat das Zusammenspiel dieser drei Eigenschaften, das die Historien von SMOPEC-Staaten oftmals zu eigentlichen Erfolgsstorys werden liess. Und das keinesfalls nur im viel zitierten Fall der beiden Wohlstands- und Wachstumswunder Singapur und Hongkong. Allerdings ist es ausgerechnet der mit dem kleinstaatlich bedingten Mangel an schierer Grösse verbundene aussenhandelspolitische Wettbewerbsnachteil, der selbst fortgeschrittene SMOPEC-Länder im globalen Standortwettbewerb zunächst einmal vor enorme Herausforderungen stellt. Umgekehrt sind es wiederum genau diese Herausforderungen, die ihrerseits die Kleinstaaten nicht nur zu einer möglichst universell ausgerichteten, offensiven Standortpolitik und zu weitgehender Freizügigkeit mit Bezug auf Arbeitskräfte, Kapital und Wissen, sondern auch zu einer grundsätzlichen Zurückhaltung gegenüber protektionistischen Marktinterventionen im Aussenwirtschaftsbereich veranlassen.9
Die schwierigen Bedingungen im globalen Standortwettbewerb stimulieren die Kleinstaaten per se zu einer disziplinierten öffentlichen Haushalts-, kombiniert mit einer attraktiven Fiskalpolitik, die ihnen hilft, die Bonität des Landes als Investitions- und Anlegerstandort zu festigen. Auch motivieren sie zu ständiger Innovation im digitalen wie im übrigen Infrastrukturbereich. Und nicht zuletzt verlangt der internationale Wettbewerbsdruck vorab von der politisch und ökonomisch aktiven Bevölkerung des Kleinstaats überdurchschnittliche Disziplin, Zuverlässigkeit und Rechtsstaatlichkeit. SMOPEC-Länder, die sich diesen Herausforderungen weder stellen wollen noch können, profitieren naturgemäss weniger oder überhaupt nicht von ihrer Kleinstaatlichkeit. Ja, sie werden (wie nach der Finanzkrise 2007 bis 2010 etwa Portugal und Griechenland und – allerdings nur temporär – Island und Irland) sogar ins Abseits gedrängt.
Was sind nun die wichtigsten Vorteile kleinstaatlicher Verhältnisse? An erster Stelle zu nennen sind sicher die kurzen und teilweise schnellen Wege der Findung und Umsetzung von politischen und administrativen Entscheidungen, die flachen Führungspyramiden bzw. -hierarchien sowie die relativ schlanken bzw. kleinen Staatsapparate und Verwaltungsbürokratien. Weitere komparative Vorzüge erwachsen dem Kleinstaat aus seiner geografischen Dichte, der engen bzw. dichten institutionellen und personellen Vernetzung seiner Gesellschaft sowie aus den damit verbundenen interpersonellen Führungsvorteilen. Das wiederum lässt die individuellen und kollektiven Entscheidungs- und Vorgehensprozesse einfacher und effizienter ablaufen. Überschaubare Verhältnisse sind ceteris paribus transparenter, senken zudem für die Wirtschaft die Transaktionskosten und erleichtern staatspolitisch das Funktionieren von Föderalismus und direkter Demokratie. Erhöht wird dadurch im Allgemeinen auch die Bereitschaft von Individuen, als Willensgemeinschaft zu kooperieren, soziale Verantwortung zu übernehmen und zwischenmenschliche Solidarität zu üben.
Und nicht zuletzt sorgt Kleinstaaterei, vor allem wenn sie gepaart ist mit einer direktdemokratischen Staatsordnung, für kürzere Distanzen zwischen den politischen bzw. wirtschaftlichen Eliten einerseits und der übrigen Bürgerschaft andererseits. Das wiederum fördert den interessenausgleichenden, lösungsorientierten und umsetzungsförderlichen Dialog und die Kompromissfindung im Fall von kontroversen oder gar konfliktuellen Auseinandersetzungen. Und das vor allem dort, wo alle massgebenden politischen Kräfte und Entscheidungsträger – wie etwa in der Schweiz – föderalistisch, plebiszitär und konkordant in die politischen Entscheidungsprozesse eingebunden sind.10 Unter solchen Bedingungen ist auch ein Auseinanderdriften von wirtschaftlichen und politischen Eliten einerseits und von diesen und der breiten Bevölkerung andererseits viel weniger zu befürchten als in grossen nicht oder lediglich repräsentativ demokratisch organisierten Staaten.
3.2 Urbanität als Produktivitätstreiber
Im urban geprägten Kleinstaat werden der gesellschaftliche Wandel, die Wohlstandsentwicklung, die Ressourcenausstattung und die internationale Wettbewerbsfähigkeit wie auch die Standort- und Wohnortattraktivität, der technische Fortschritt und die sozialen und ökonomischen Innovationspotenziale zu Stadt und zu Land vorwiegend durch urbane Schubkräfte getrieben. Plausibel ist demzufolge, dass der Urbanitätsgrad eines kleinstaatlichen Wirtschaftsraums auch positiv mit dessen Arbeitsproduktivität, vorab im Exportsektor, korreliert ist.11
Wie bereits erwähnt, sind nicht alle SMOPEC-Länder dominant und flächendeckend urban geprägt. Als Beispiele hierfür sei auf die mediterranen Kleinstaaten Südeuropas (Griechenland, Montenegro und Portugal) hingewiesen. Andere, vorweg stadtdominierte Kleinstaaten wie etwa Hongkong, Singapur, Monaco und Luxemburg sind es sehr. Im Spannungsfeld zwischen Stadt und Land dominieren hier nicht zentrifugale Kräfte oder gar separierende Konflikte, sondern in diesen Stadtstaaten findet zumeist eine fruchtbare, d. h. wertschaffende, Symbiotik zwischen Stadt und Land statt. Das gilt heute in zunehmendem Mass auch für weniger stadtzentrierte Kleinstaaten wie für die Niederlande oder ganz besonders für die Schweiz. Interessanterweise hat sich hier seit den 1980er-Jahren der sogenannte Röstigraben – als historische, sprachliche und kulturelle Trennlinie zwischen Welsch- und Deutschschweiz – gemäss neuerer Studien praktisch eingeebnet (vgl. bspw. Koseki, 2016). Stattdessen driften heute in der Schweiz aufgrund verschiedenartiger politischer und kultureller Präferenzen eher die Stadt- und Landbevölkerungen auseinander, ohne jedoch dass das hier bisher zu irgendwelchen gesellschaftlichen Spannungen oder zentrifugalen Tendenzen geführt hätte.
3.3 Souveränität als Schlüssel zur Nischenstrategie
Ein zweites Konstitutivum des urbanen Kleinstaats stellen – wie oben erwähnt – seine nationale Souveränität sowie das subsidiäre Selbstbestimmungsrecht seiner Gliedkörperschaften dar.12 Diese Voraussetzung ist in der Schweiz geradezu formidabel erfüllt. Denn wo sonst gibt es eine dieser Art national integrierte politische, sprachliche und kulturelle Vielfalt föderal verbundener Willensgemeinschaften wie in der Schweiz, gepaart mit einer weitgehenden institutionellen Nichteinbindung in supranationale Strukturen? Was bedeutet nun staatliche Souveränität konkret für die Schweiz? Zunächst einmal – wie schon oben erläutert – sicher weder Autarkie noch Autonomie. Es gehört geradezu wesensbedingt zum Kleinstaat, dass er kaum die Möglichkeit hat, internationale Trends und Politstrategien zu lancieren, zu bremsen oder zu steuern, sei das im Fall des Ausbaus und des Betriebs von grenzüberschreitenden Netzinfrastrukturen, im Bereich der Flüchtlingspolitik, sei das im Fall der Gestaltung und Strukturierung der Währungs- und Aussenhandelspolitik. Der internationale Abstimmungs- und Koordinationsbedarf ist auch für die Schweiz in all diesen Bereichen relativ gross. Und noch wächst er im Zug der Globalisierung, auch wenn sich heute gerade gegen diese verbreitet konterkarierende Kräfte und Tendenzen bemerkbar machen.
Das alles bedeutet nicht, dass Kleinstaaten wie die Schweiz ihre kardinalen Politikbereiche wie etwa die Notenbank-, Finanz- und Fiskalpolitik, die Sicherheits-, Aussen- und Aussenwirtschaftspolitik, die Sozial-, Siedlungs- und Bildungspolitik sowie die Versorgung mit Gütern des Service public nicht weiterhin – nach innen wie nach aussen – souverän, d. h. ohne Fremdbestimmung, gestalten können. Auch Kleinstaaten verfügen, genau wie grosse und mächtige Länder, über hinreichende Handlungsspielräume, um ihre institutionellen, föderalen und politischen Prozessstrukturen eigenständig zu bestimmen und dort, wo nötig bzw. sinnvoll, in freier Entscheidung mit aussen zu koordinieren (oder eben nicht). Dazu gehören auch die selbstständige Ausgestaltung der eigenen demokratischen Staatsordnung sowie vor allem die föderale Steuerhoheit. Auch hierin bietet sich die Schweiz als geradezu klassisches Beispiel an.
Der (automatische) Nachvollzug ausländischer Rechtsentwicklungen darf und wird deshalb für einen souveränen Kleinstaat wie die Schweiz nie irreversibel sein. Ebenso wenig wird für ihn unter dem hier beschriebenen Souveränitätsverständnis für komplette und definitive, d. h. unkündbare, Einbindung in irgendeine, stark politisch orientierte, supranationale Integrationsstruktur infrage kommen. Dabei kann es sich allerdings auch für einen international vernetzten Kleinstaat durchaus als legitim – ja, sogar als opportun – erweisen, überall dort mitzutun, wo internationale Organisationen für globale Marktöffnung und Freihandel (WTO) und/oder für makroökonomische Systemstabilität (IMF) im Einsatz stehen. Es macht also durchaus Sinn und stellt ihr politisches Selbstbestimmungsrecht grundsätzlich nicht infrage, wenn die Schweiz als einer der weltweit wichtigsten Finanzmarktstandorte ihren Sitz im Internationalen Währungsfonds (IMF) unbedingt behalten will.13 An stabilitäts- und ordnungspolitisch (möglichst) sauberen Lösungen auf globaler Ebene interessiert, trifft sie schliesslich nicht nur im Kreis der WTO, sondern auch in jenem des IMF auf willkommene Verbündete.
Für einen neutralen Kleinstaat wie die Schweiz gilt es zudem die Aussenbeziehungen soweit wie möglich bilateral und stets mit einer Rückzugsklausel versehen zu ordnen. Andernfalls riskiert er, seine staatliche Souveränität zu relativieren oder nach und nach gar zu verlieren. Ehemals souveräne Kleinstaaten, z. B. in der EU, erleben deshalb, dass im Zug der Weiterentwicklung des Lissabonner Prozesses nationale Souveränitätsrechte nach und nach wegbrechen.14 Eine solche Erosion des Selbstbestimmungsrechts beraubt somit gerade sie einer ihrer zentralen Erfolgsvoraussetzungen. Aus diesem Blickwinkel erscheint es auch fraglich, ob z. B. die Fürstentümer Liechtenstein und Monaco (wirtschaftlich weitgehend in die Rechtsordnungen ihrer Nachbarländer Schweiz bzw. Frankreich eingebunden) oder das EU-Mitglied Luxemburg (im Prokrustes-Bett eines fortschreitenden EU-Wirtschaftsrechts gefangen) nicht bereits so viel an Souveränität eingebüsst haben, dass sie den kleinstaatlichen Status im Sinn unserer Beschreibung mittlerweile weitgehend verloren haben.
Nochmals: Die Forderung nach nationaler Eigenständigkeit und Eigenverantwortung steht dabei keineswegs im Widerspruch zum Postulat einer globalen Marktintegration. Vor allem für Kleinstaaten, die wie etwa die Schweiz in den Wertekonsens eines freiheitlich-marktwirtschaftlichen Systems eingebettet sind, wird es ökonomisch auf lange Frist nur zum Vorteil gereichen, wenn sie ihren heimischen Binnenmarkt international öffnen, nicht ohne sich selber internationalen Marktzugang zu verschaffen. Auch gereicht es ihnen zum Vorteil, zwar global geltende makroprudenzielle Markt- und Wettbewerbsregeln zu übernehmen, ohne sich jedoch dabei einem internationalen Harmonisierungsdiktat zu unterziehen. So etwa drängt sich für die Schweiz akkurat nach dem Brexit eine engstmögliche partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Grossbritannien auf, sei das bilateral oder – zielführender, aber hindernisreicher – im Rahmen der EFTA. Dies alles freilich stets unter der Voraussetzung der Einhaltung des Meistbegünstigtenprinzips15 und unter der Bedingung, dass dadurch der wirksame Wettbewerb auf dem heimischen Binnenmarkt und dessen Funktionsfähigkeit nicht ausgebremst, sondern nachhaltig gefördert werden. Zum Schluss noch einmal: Kleinstaaten erzielen ihre politischen und ökonomischen Erfolge – wie oben erörtert – im Wesentlichen über den Weg aussen(wirtschafts)- und standortpolitischer Nischenstrategien. Solche jedoch können sie umso erfolgreicher verfolgen und umsetzen, je breiter ihre eigenen Souveränitätsräume gespannt sind.
3.4 Universelle Offenheit – ein Wohlstandstreiber
Ein weiterer essenzieller Wesenszug des urban geprägten Kleinstaats stellt seine politische, ökonomische und soziale Universalität dar. Universalität kennzeichnet zwar auch viele Grossstaaten und flächenstaatliche SMOPEC-Länder. Doch Universalität bedeutet mehr als nachbarliche Offenheit. Offen sein z. B. gegenüber den Nachbarn ist das eine. Offen sein auch gegenüber der übrigen Welt bedeutet jedoch Universalität. So richtet sich vor allem der neutrale Kleinstaat tendenziell symmetrisch nach allen Azimuten aus. Denn je global symmetrischer bzw. geografisch diversifizierter er seine Aussenbeziehungen ausgestaltet, umso unabhängiger bleibt er und umso weniger ist er grossstaatlichen Machtansprüchen und aussenwirtschaftlichen Klumpenrisiken ausgesetzt. Ein Kleinstaat wie die Schweiz, aussenpolitisch neutral und Nichtmitglied einer supranationalen Union, erfüllt diese Voraussetzung in hohem Mass. Denn er ist zwar naturgemäss ökonomisch, demografisch, kulturell und auch bilateral-vertraglich dicht und eng mit seinem EU-Umland verflochten, gleichzeitig aber auch zunehmend offen gegenüber der übrigen Welt. Die ausgeprägte und wachsende Universalität der Schweiz manifestiert sich – ähnlich wie die der klassischen Stadtstaaten – unter anderem in ihren internationalen Vermittlungsbemühungen ebenso wie in ihren globalen Handels- und Dienstleistungsbeziehungen, sodann in der internationalen Vernetzung ihrer Wertschöpfungsketten, ihrem Unternehmenssektor wie in ihren Austauschbeziehungen in Sachen Kapital, Erwerbspersonal und Wissen rund um den Globus. Ihre vorstehend andiskutierten Mitgliedschaften bei WTO und IMF zeugen ebenfalls von der ökonomisch universellen Ausrichtung des Kleinstaats Schweiz. So gesehen, stünde es der Schweiz eigentlich gut an, z. B. die Personenfreizügigkeit für hoch qualifiziertes Personal noch vermehrt auch auf Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Ländern auszudehnen – so wie sie sich als neutrales Land ihre Aussenpolitik schon immer universell symmetrisch auszurichten bemüht hat.
Bei alldem gilt es zu berücksichtigen, dass – flexible Märkte vorausgesetzt – der grenzüberschreitende Austausch von Gütern, Wissen und Investitionen aus wachstumsökonomischer Sicht den Personenaustausch durchaus substituieren kann. Denn bei langfristiger Betrachtung gilt: Im Modell der Valorisierung der komparativen Vorteile in einem multinationalen Wirtschaftsraum sind (sofern Freihandel für Warengüter- und Dienstleistungen plus Allokationsfreiheit für Human- und Realkapital gegeben sind) weder die Binnenmarktharmonisierung noch eine generelle Personenfreizügigkeit zwingende Voraussetzungen für eine Optimierung des wohlfahrtsökomischen Ergebnisses. Oder anders gesagt: Hinreichende Voraussetzungen zur Wohlfahrtsoptimierung liefern allein schon der freie Marktzugang im Ausland für Güteranbieter (z. B. nach dem Cassis-de-Dijon-Prinzip) sowie die Niederlassungsfreiheit eigener Unternehmen, Forschungs- und Bildungsstätten im Ausland. Die Personenfreizügigkeit hat diesbezüglich lediglich subsidiären Charakter. Für die dogmatische Axiomatisierung der allgemeinen Migrationsfreiheit in der EU gibt es somit zumindest keine ökonomische Begründung – es sei denn, auf einem Teilarbeitsmarkt liege Mangel an hoch qualifizierten Fachkräften vor.
3.5 Starker KMU-Sektor als Innovationsgenerator
Fortgeschrittene Klein- und besonders Stadtstaaten sind des Weiteren meistens Länder, in denen neben grossen Weltunternehmen die KMU nicht nur als Konjunktur-, Arbeits- und Sozialstabilisatoren, sondern vielfach auch als dynamische und international wettbewerbsstarke Innovatoren agieren und damit Rückgrat und Beimotor ihrer Volkswirtschaften bilden. Das rührt vor allem daher, dass der wirtschaftspolitische Fokus in Kleinstaaten vielfach stärker auf mittelständische Unternehmen ausgerichtet ist als in grossen Ländern. Deren industriepolitischer Fokus liegt nämlich tendenziell vorzugsweise bei grossen Konzernen. Mittelständische Unternehmen treffen deshalb im überschaubaren Kleinstaat allgemein auf bessere soziale und ökonomische Rahmenbedingungen als im Grossstaat.
3.6 Dienstleistungs-Hub mit Laffer-Effekten
Fortgeschrittene, vor allem urban geprägte SMOPEC sind ökonomisch oft deshalb so erfolgreich, weil ihnen der Strukturwandel (sofern sie diesen nicht unterdrückt haben) einen arbeitsteiligen und wachstumstreibenden Mix von hoch spezialisierten Branchen sowie eine geografische Konzentration bzw. Clusterung ihrer Hightech- und Dienstleistungsindustrien beschert hat.16 Zudem ist in der Regel ihr Dienstleistungssektor – wie ganz besonders etwa in der Schweiz – stark von grenzüberschreitendem Handel, von der Finanzdienstleistungs- und Informatikindustrie geprägt.
Auch Konzerndienstleistungen machen dabei ihren vergleichsweise ebenfalls überaus bedeutsamen Anteil an der nationalen Wertschöpfung aus. Hierbei geht es um zentrale Leistungen, die durch die Hauptquartiere von Konzernen, so etwa von global aufgestellten Handelsfirmen, generiert werden, die dank ihrer genuinen Allokationsmobilität hochsensibel auf fiskalische Standortvorteile reagieren und deren Wertschöpfungsketten sich (wie z. B. im Fall Nestlé) oft überwiegend im Ausland befinden. Nicht zuletzt deshalb profitieren urban geprägte Kleinstaaten produktivitätsmässig, wohlstands- und wohlfahrtsökonomisch wie auch fiskalisch enorm von den hohen Unternehmensgewinnen dieses – dank innovationsbegründeter internationaler Wettbewerbsvorteile17 – hoch kompetitiven Exportsektors. Der sich verschärfende internationale Steuerwettbewerb zwingt deshalb gerade sie zu einer kompetitiven Konzernbesteuerung.
4. Kleinstaaten tendieren zur Outperformance
Dass urban geprägte Kleinstaaten dank ihrer vorstehend erläuterten komparativen Vorteile in vielen ökonomischen Belangen – ganz besonders im Zug von globalen Wirtschaftskrisen – je länger, je mehr zu internationaler Outperformance tendieren, ist nicht nur notorisch, sondern lässt sich auch empirisch leicht untermauern. Sowohl positive Ausreisser, wie etwa die Grossstaaten USA und Deutschland (sie dank ihrer metropolitan geprägten Agglomerationsregionen), als auch negative kleinstaatliche Ausreisser, wie etwa die Sorgenländer Griechenland oder vereinzelte Balkanländer, ändern an dieser These wenig. Es ist ebenfalls kein Zufall, dass gerade die Schweiz als SMOPEC-Klassiker in fast allen sozioökonomischen Länderranglisten zu den Spitzenreitern gehört und deshalb auf der internationalen Bühne zusehends als Sonderfall wahrgenommen wird. Wir beschränken uns nachstehend auf einige wenige Rankingaspekte.
4.1 Kleinstaatliche Wohlstandsvorteile
Dass und warum das reale Pro-Kopf-BIP eng mit Kleinstaatlichkeit korreliert, wird später einlässlich zu erörtern sein.18 An dieser Stelle nur so viel: Die Schweiz figuriert beispielsweise im Jahr 2015 – zusammen mit Luxemburg, Norwegen, Hongkong, Singapur, Irland und den USA – mit über 50000 US-Dollar realem BIP pro Kopf nicht nur in Sachen Wertschöpfung an der Weltspitze, sondern sie übertrifft mit brutto über 7000 Franken Durchschnittslohn pro Monat und Kopf selbst jenen in ihren vier Nachbarländern um weit mehr als das Doppelte. Dabei bleibt den schweizerischen Lohnempfängern trotz einheimischer Höchstpreise (vgl. Müller, 2016), selbst kaufkraftbereinigt immer noch 40 Prozent mehr Geld in den Lohntüten als jenen rund um unser Land herum (vgl. Fuster, 2016). Zudem hat in der Schweiz die reale Kaufkraft der Löhne während des aktuellen zweiten Jahrzehnts allein schon dank relativ tiefer oder gar negativer Inflationsraten ständig zugenommen.
Nun wird diesen Fakten immer wieder relativierend entgegengehalten, in reichen Kleinstaaten, so vor allem auch in der Schweiz, seien dafür die Einkommensunterschiede und der Armutspegel überdurchschnittlich hoch und gleichzeitig erodiere der Mittelstand zahlen- und wohlstandsmässig in beängstigendem Mass. Solche Klischees lassen sich allerdings durch empirische Analysen leicht und diametral widerlegen: Denn gemäss ihrem relativ tiefen Gini-Koeffizienten,19 als einem in der Forschung weltweit anerkannten Indikator zur Messung der Einkommensungleichheit, steht die Schweiz – übrigens einmal mehr in guter Gesellschaft mit anderen (vor allem skandinavischen) Kleinstaaten – punkto Einkommensunterschiede weit besser da als der OECD-Durchschnitt. Zudem nimmt die Ungleichverteilung der Einkommen in der Schweiz tendenziell sogar leicht ab. Auch hinsichtlich Armut gelangt der prominente Armuts- und Ungleichheitsforscher Branko Milanovic zum überraschenden Ergebnis, dass in der Schweiz, wiederum repräsentativ für viele Kleinstaaten, die ärmsten 5 Prozent der Wohnbevölkerung immer noch reicher sind als drei Viertel der gesamten übrigen Weltbevölkerung (vgl. Rühli, 2015). Und was schliesslich den angeblich schwächelnden Mittelstand anbelangt, hat Avenir Suisse aufgrund von BFS-Zahlen kürzlich gerechnet, dass dieser (definiert als die Summe aller Einkommensbezüger mit einem Einkommen zwischen 70 Prozent und 150 Prozent des Medianeinkommens) seit 1990 von 65 Prozent in Richtung 68 Prozent der Gesamtbevölkerung zugenommen hat, die Unterschicht gleichzeitig um fast 8 Prozent geschrumpft und die Oberschicht sogar um rund 5 Prozent gewachsen ist (Rühli, 2015). Das alles zeugt von sozialem Ausgleich und Aufstieg, der – zumindest bei makroökonomischer Betrachtung – in vielen anderen Kleinstaaten ebenfalls zu beobachten ist.
4.2 Wettbewerbsvorteile
Dass Kleinstaaten (ähnlich wie auch subnationale Agglomerationsregionen) dank ihres SMOPEC-Charakters genuin intensiver und vielfältiger mit dem Ausland vernetzt sind und – relativ zum BIP – über grössere Aussenwirtschaftssektoren verfügen als grossstaatliche Wirtschaftsräume, wird unten empirisch noch vertieft diagnostiziert.20 Das hat zur Folge, dass der binnenmarktliche Wertschöpfungsprozess von Kleinstaaten auch stärker durch deren Aussenwirtschaftsbeziehungen, d. h. durch den grenzüberschreitenden Austausch von Waren und Dienstleistungen, von Kapital, Wissen und Arbeit, durchdrungen und getrieben wird als in Grossstaaten. Denn der überdurchschnittlich dimensionierte Aussenwirtschaftssektor entfesselt auf kleinstaatlichen Binnenmärkten matchentscheidende multiplikatorische Spillover-Effekte und – damit verbunden – nachhaltig dominante, gesamtwirtschaftliche Wachstums-, Innovations- und Wohlstandsimpulse. Und zwar allein schon quantitativ in viel stärkerem Ausmass, als das in grossstaatlichen Wirtschaftsräumen der Fall ist. Der global zunehmende Wettbewerb wird damit – inskünftig noch verstärkt durch die vierte industrielle Revolution und die Sharing Economy – mehr und mehr zur unerbittlichen Herausforderung, gleichzeitig aber auch zur erstrangigen Erfolgschance für Kleinstaaten, und zwar mehr noch als für Grossstaaten. In kleinen offenen Volkswirtschaften lassen sich nämlich Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, statt zu kapitulieren oder defensiv zu reagieren, oftmals gerade durch die Herausforderung zu universeller Öffnung, zu permanentem Change-Management und – damit verbunden – zu einem proaktiv disruptiven Innovationsmodus im Prozess- und Leistungsbereich befeuern. Nicht zuletzt als Folge des damit verbundenen, zuweilen leidvollen Trainings werden Kleinstaaten im Allgemeinen erfolgreicher sein als ihre grossstaatliche Konkurrenz. Dabei werden sie längerfristig nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ von aussenwirtschaftlichen Wachstumsimpulsen profitieren. Kleinstaatliche Wirtschaftspolitik muss allerdings begleitend dafür kämpfen, dass der grenzüberschreitende Marktzugang und Austausch von Gütern und Produktionsressourcen – unter Sicherstellung fairer und unverzerrter Wettbewerbsbedingungen – weiter liberalisiert bzw. auf keinen Fall reprotektioniert wird.
Im Kleinstaat spielt zudem, wachstums- und wohlstandsökonomisch betrachtet, nicht nur die internationale Wettbewerbsfähigkeit seines Unternehmenssektors, sondern auch die ihm eigene Standortqualität bzw. seine Kompetitivität als Allokationsstandort und Attrahent von (hochkarätigem) ausländischem Kapital, Wissen und Personal eine überaus zentrale Rolle. Somit ist klar: Bei der staatlichen Standortpolitik handelt es sich gerade für ihn um die zweite erfolgsführende Schiene einer nachhaltigen Wachstums- und Wohlstandsförderung. Denn so wie auf den globalen Handelsmärkten wird auch der internationale und interregionale Standortwettbewerb im Kampf um hoch qualifizierte und stets mobiler werdende Produktionsressourcen zusehends härter. Die damit verbundenen Herausforderungen im Kampf um beste Wettbewerbsfähigkeit durch Optimierung der eigenen Standortqualitäten sind deshalb gerade für Kleinstaaten – mangels international politischer Potenz und ökonomischer Grössenvorteile – extrem hoch. Überaus hoch sind dafür aber auch ihre Chancen, im eigenen Hoheitsgebiet nicht nur eine wettbewerbsstarke Standortexzellenz aufzubauen, sondern mit dieser auch erfolgreich wachstums- und wohlstandsökonomische Impulse zu entfesseln. Wir denken dabei an das regulatorische Umfeld, an die Humankapital- und Infrastrukturangebote, an die internationale Verkehrsanbindung, an die Fiskalbedingungen usw.
Die vorstehend beschriebenen Zusammenhänge lassen sich empirisch unschwer untermauern. Hierzu lohnt sich eine Spurensuche im dichten Strauss komplexer internationaler Rankingverfahren, wie sie seit geraumer Zeit beispielsweise vom World Economic Forum (WEF), von der Weltbank und von der OECD kompiliert werden. Dabei kristallisiert sich folgende Faktenlage heraus: Was zunächst auffällt, ist die enge Korrelation zwischen der Zunahme des Pro-Kopf-Wohlstands, gemessen an der Bruttoinlandswertschöpfung einerseits und den anteiligen Aussenwirtschaftsbeziehungen (Güter-, Kapital- und Wissensaustauch), der technologisch-ökonomischen Innovationsdynamik und der standortökonomischen Wettbewerbsfähigkeit andererseits. Zweitens haben SMOPEC-Staaten (plus Deutschland und die USA dank ihrer metropolitan geprägten Agglomerationsregionen) praktisch in allen diesbezüglichen Weltranglisten die Nase vorn. Und nicht zuletzt gibt es drittens eine klare Evidenz dafür, dass der Kleinstaat Schweiz in all diesen Kampagnen zumeist einen Podestplatz einnimmt.21
So belegte die Schweiz im Jahr 2016 (trotz Frankenstärke, ungewisser Migrationspolitik und Überregulierung ihrer Produktemärkte) im Wettbewerbsindex des WEF bereits zum achten Mal in Folge den ersten Rang – und zwar in erster Linie sowohl dank Spitzenplätzen als Innovations-, Forschungs- sowie als tertiärer Bildungsstandort als auch dank ihres überaus flexiblen Arbeitsmarkts und ihrer spitzenmässigen technologischen Bereitschaft (WEF, 2016a). Sodann figuriert sie (zusammen mit Norwegen und Luxemburg) gemäss Inclusive Development Index-(IDI)-Massstab des WEF, der neben dem realen BIP-Wachstum und Haushaltseinkommen auch Lebensqualitäts-, Nachhaltigkeits-, Verteilungsgerechtigkeits-, Erwerbstätigkeits- und Produktivitätskriterien berücksichtigt, ebenfalls zuoberst in der Rangliste (WEF, 2017).22 Dabei ist erstaunlicherweise auch hier, wie übrigens in fast allen Rankings, der erste G7-Grossstaat (nämlich Deutschland) erst auf Rang 13 anzutreffen. Kein Wunder in diesem Kontext, dass die Schweiz im Weltvergleich gemäss verschiedenen Studien (zusammen mit Irland und Finnland) auch bestens auf die Digitalisierung und auf die anstehende vierte industrielle Revolution 4.0 (Feldges, 2016) sowie (zusammen mit Norwegen und Finnland) am besten auf die Globalisierung vorbereitet ist (WEF, 2016b). Nachvollziehbar ist sodann, dass sie weltweit nicht nur pro Einwohner auf die meisten wachstumsstarken Unternehmen zählen darf (Ecoplan, 2016), sondern gemäss INSEAD-Monitoring auch im weltweiten Wettbewerb um die besten Talente – und das bereits zum vierten Mal in Folge – den ersten Rang belegt (INSEAD, 2015).
4.3 Kleinstaatliche Arbeitsmarktvorteile
Als Hauptstärken etlicher Kleinstaaten erweisen sich überdies die nicht zuletzt in weltwirtschaftlichen Krisen offensichtlich resistenten, weil angebotsseitig relativ flexiblen, Arbeitsmärkte. Trotz vergleichsweise tiefer durchschnittlicher Jahresarbeitszeit in Stunden pro Erwerbstätigen und trotz flankierender Massnahmen zum Schutz gegen die Immigration erzielt die Schweiz auch in diesem Bereich seit Jahrzehnten Spitzenresultate im OECD-Wettbewerb. Und das nicht nur punkto Erwerbsbeteiligung der aktiven Wohnbevölkerung sowie punkto Beschäftigungsentwicklung, sondern auch mit Bezug auf die Arbeitslosenquoten im Allgemeinen und die Jugendarbeitslosigkeit im Besonderen (vgl. Rühli, 2015). Den komparativen Arbeitsmarktvorteil verdankt sie, zwar nicht ausschliesslich, aber doch zu einem erklecklichen Teil, ihrem dynamischen und im Kleinstaat besonders schwergewichtigen KMU-Sektor und zudem ihrer historisch solid verankerten Sozialpartnerschaft. Wie anderswo eine wichtige Rolle spielt diesbezüglich auch die verhältnismässig stark ausgeprägte Sozialkontrolle, mit der im föderativen Kleinstaat die Arbeitgeber konfrontiert sind. Und schon fast über ein Alleinstellungsmerkmal – nämlich noch einen Schritt vor der kleinstaatlichen Konkurrenz aus Österreich, Tschechien, Dänemark und den süddeutschen Agglomerationsregionen – verfügt die Schweiz hinsichtlich ihres schon fast legendären und weltweit bewunderten dualen Berufs(aus)bildungskonzepts. Dabei sorgt das darin inkludierte schweizspezifische Passerellensystem zusätzlich für Durchlässigkeit von der beruflichen bis hin zur tertiären Ausbildung.23 Abschliessend lässt sich festhalten: Eine durchlässige duale Berufsbildung – optimalerweise flankiert durch eine institutionalisierte berufsbegleitende Weiterbildung – könnte, wie in der Schweiz, überall, ganz besonders in den übrigen Kleinstaaten sowie in Südeuropa, helfen, sowohl die insgesamte als auch die Jugendarbeitslosigkeit nachhaltig tief zu halten.
4.4 Kleinstaaten als Favoriten im makroökonomischen «Schönheitswettbewerb»
Nach den vorstehenden Ausführungen überrascht es nicht, dass fortgeschrittene Kleinstaaten in der Tendenz auch makroökonomisch, d. h. hinsichtlich Wachstums- und Beschäftigungsniveau sowie hinsichtlich Geldwertstabilität und öffentliche Haushaltsdisziplin, ihrer grossstaatlichen Konkurrenz voraus sind und zudem jeweils schneller aus globalwirtschaftlichen Krisen herausfinden als diese.
Unsere Analyse in Abbildung 1 stützt die Outperformance-Hypothese: Unser aus den volkswirtschaftlichen Schlüsselgrössen (reales BIP-Wachstum, Beschäftigungslage, Geldwertstabilität und staatliche Defizitquote) kompilierter Makroindex bewegte sich seit dem Millennium in hoch entwickelten Kleinstaaten tendenziell auf höherem Niveau als jener in grossen nationalen (oder supranationalen) Wirtschaftsräumen.24 So etwa bildet die Schweiz, zusammen mit dem asiatischen City-State-Klassiker Singapur sowie mit dem im Jahr 2015 fünftplacierten (erdölgesegneten) Norwegen und dem EU-Kleinststaat Luxemburg seit 2000 die Spitzengruppe in diesem makroökonomischen «Schönheitswettbewerb». Zum Aufstieg der Schweiz aufs Podest während der Millenniumsjahre hat in einem nicht unerheblichen Mass auch ihre finanzpolitische Umkehr mithilfe der Schuldenbremse beigetragen. Der Kurvenverlauf am rechten Rand macht zudem deutlich, dass die vier Spitzenreiter während der Finanz- und Wirtschaftskrise (trotz hoher Exportexposition und entgegen den Erwartungen vieler Auguren) nicht nur ihren Vorsprung leicht ausgebaut, sondern auch die Krise weniger gespürt und vor allem rascher aus ihr herausgefunden haben. Sonderfälle stellen die beiden Kleinstaaten Irland und Island dar: Beide sind sie während der Finanzkrise, nachdem sie wegen ihrer Aktionen zur Bankenrettung als Staaten in die Schuldenfalle geraten sind, makroökonomisch richtiggehend abgestürzt.25 Beide haben sich jedoch mittlerweile dank heroischer Reformen wieder an die Spitze hochgearbeitet und brillieren aktuell mit den höchsten realen BIP-Wachstumsraten in Europa.
5. Nachteile, Risiken und Herausforderungen der Kleinstaatlichkeit
Trotz des makroökonomischen Vorsprungs, den die urban geprägten SMOPEC-Länder im globalen Wettbewerb ihrer Kleinstaatlichkeit verdanken, gilt es nun abschliessend auch die Kehrseite der Medaille zu beachten. Denn immerhin sind mit der Kleinstaatlichkeit auch gewisse Nachteile, Risiken und Gefahren verbunden. Dazu nachfolgend einige Hinweise.
5.1 Exportverteuernde Aufwertungsschocks26
Die eigene Währung und die eigene souveräne Notenbank bergen für kleine offene und exportgetriebene Volkswirtschaften nicht nur Vorteile, sondern – vorab in Krisenzeiten – auch das permanente Risiko in sich, als Fluchthafen von internationalen Anlegern aufgesucht zu werden. Schmerzhaft exzessive Währungsschwankungen sowie exportverteuernde reale Aufwertungsschocks können die Folge sein, was wiederum Währungsspekulanten auf den Plan ruft. Der permanente Aufwertungsdruck beschert den Kleinstaaten im internationalen Vergleich zwar strukturell tiefere Importpreise sowie niedrigere Zinsen und Inflationsraten. Doch stellt er – zusammen mit der Unberechenbarkeit und der oft spekulationsbedingt noch verstärkten Wechselkursvolatilität – für die Planbar- und Wettbewerbsfähigkeit ihrer Exportwirtschaft eine ständige Herausforderung, in Schockphasen oft sogar eine akute Belastung dar. Erschwerend kommt hinzu, dass kleinstaatliche Notenbanken zwar institutionell souverän sind, vor allem jedoch in Krisenzeiten über ausserordentlich wenig geld- und währungspolitische Autonomie verfügen und deshalb ihre operativen Konzepte stets auf die monetäre Politik der grossen Wirtschaftsblöcke bzw. deren Notenbanken abstimmen müssen.
Als illustratives Beispiel hierfür steht wiederum die Schweiz. Direkt nachfrageseitig (und indirekt auch angebotsseitig) werden ihre Wachstums- und Innovationskraft – wie oben dargelegt – seit Jahrzehnten massgeblich durch ihre kontinuierlich steigenden Aussenhandelsvolumina und Ertragsbilanzüberschüsse getrieben. Letztere wiederum waren und sind verantwortlich für die anhaltende innere und äussere Frankenstärke. Weitere Fundamentaltreiber des permanenten Aufwertungsprozesses27 sind im politischen und makroökonomischen Stabilitäts- und internationalen Bonitätsvorsprung des Landes gegenüber der ausländischen «Konkurrenz» sowie in der überdurchschnittlichen konjunkturökonomischen Krisenresistenz der schweizerischen Volkswirtschaft auszumachen. Dass in dieser Verkettung die Erfolge der anerkannt weltmeisterlichen Schweizer Exportwirtschaft sich in einer jahrzehntelang nachhaltigen, anhaltend graduellen Aufwertungstendenz des Schweizer Frankens niedergeschlagen haben, kann also durchaus als spiegelbildlicher Ausdruck der im letzten Abschnitt beschriebenen volkswirtschaftlichen Erfolgsgeschichte betrachtet werden. Die positiven Rückkoppelungseffekte dieses über weite Zeitstrecken «gemächlichen» Aufwertungstrends fanden in währungsökonomisch ruhigen Phasen sogar Ausdruck in einer anhaltenden makroökonomischen Outperformance der schweizerischen Volkswirtschaft. Dies nicht zuletzt dank der durch den moderaten Aufwertungsdruck induzierten binnenwirtschaftlichen Inflations- und Zinsdämpfungseffekte, bei gleichzeitiger Stärkung der eigenen internationalen Einkaufs-, Gläubiger- und Bonitätsposition. Darüber hinaus wirkte die moderate Langfristaufwertung über die lange Zeit wie ein selbstverstärkender Innovations- und strukturbereinigender Vitalisierungsantrieb auf die Schweizer Exportwirtschaft. Die Werthaltigkeit des Schweizer Frankens war und ist somit nichts anderes als Ergebnis und Treiber zugleich eines nachhaltig erfolgreichen volkswirtschaftlichen Wertschöpfungsprozesses. Sie unterscheidet sich diesbezüglich in keiner Weise vom norwegischen Erdöl, das indes irgendeinmal versiegen wird.
Ob und wie stark der vorher beschriebene inhärente Aufwertungstreiber den nominellen Wechselkurs der eigenen Währung jeweils nach oben oder unten bewegt, wird allerdings letztlich durch die Abflussdynamik auf der «Rückseite» der Zahlungs-, nämlich jener der Kapitalverkehrsbilanz, entschieden. Diese wiederum wird durch die Zu- und Abflussintensität als Folge von Direkt- und/oder Portfolio- und/oder übrigen Investitionen bestimmt. Je tiefer die Krise im Ausland verläuft bzw. je attraktiver der heimische Anlage- und Investitionsstandort aufgrund komparativer politischer und makroökonomischer Stabilitätsvorteile, besserer Konjunkturaussichten sowie aufgrund risikobereinigter Rentabilitätsvorteile auf ausländische Anleger wirkt, umso vitaler entfalten sich die Geld- und Kapitalzuflüsse und umso träger sprudeln die Devisen- und Kapitalabflüsse. D. h., umso schwächer entwickeln sich – relativ zu den Ertragsbilanzüberschüssen – die nominellen Defizite der Kapitalverkehrsbilanz. Unter dieser Art asymmetrischer Bedingungen kann der (obligate) Ausgleich der Zahlungsbilanz nicht anders als über eine entsprechend exzessive nominelle Aufwertung der eigenen Währung erfolgen. Die dabei generierten wettbewerbsverzerrenden Aufwertungsexzesse lassen Umsätze, Margen und Gewinne einbrechen. Investitionen und Innovationen werden ausgebremst. Ganze Branchen, durchsetzt auch mit erfolgreichen, exportstarken KMU vorab aus der verarbeitenden Industrie, dem Tourismus und dem Detailhandel, stossen an existenzielle Grenzen. Solange es nicht gelingt, solche kapitalbilanzgetriebenen Aufwertungsexzesse unter Kontrolle zu halten, setzt man demzufolge wichtige Teile des exportierenden Wachstumsmotors des Wirtschaftsstandorts eines Starkwährungslandes dem Risiko der Deindustrialisierung und substanziellen Erosion mit nachhaltigen Flur- bzw. Strukturschäden aus. D. h.: Im Fall solcher wechselkursverzerrender internationaler Währungsturbulenzen drohen Kleinstaaten gewissermassen Opfer ihres eigenen Erfolgs zu werden. Was ihnen bleibt, ist nur noch die operative (oft allerdings inopportune) Anpassung der eigenen Geld- und Währungspolitik durch ihre Notenbanken an jene der Notenbanken der handelsrelevanten Wirtschaftsräume.
Zusammenfassend kann mithin festgehalten werden, dass eine graduell, d. h. primär ertragsbilanzgetrieben aufwertende, eigene Währung, wie oben beschrieben, ein überwiegend positives volkswirtschaftliches Momentum darstellt. Im Fall jedoch von allgemeinen Währungskrisen bzw. von Währungsschwächen wichtiger Handelspartner wird die eigene Währung mangels hinreichender Kapitalbilanzabflüsse extrem anfällig für erratische und massiv übersteuernde Aufwertungsschocks. In solchen Fällen bleiben den Notenbanken kleiner offener Starkwährungsländer wie der Schweiz nur noch wenige Abwehrinstrumente. So etwa die kaum verzichtbare Einstimmung in die unkonventionelle Politik der Tief- bzw. Negativzinsen oder Wertpapierkäufe durch die marktbeherrschenden grossen Notenbanken. Dabei handelt es sich allerdings um Massnahmen, die generell kaum oder nur ungewisse, möglicherweise sogar kontraproduktive Wirkungen haben. In dieser Situation gibt es jedoch für kleinstaatliche Notenbanken, sozusagen als zielführende Ergänzung zur Zinspolitik, nur die Option, Währungen relevanter Handelspartner von Fall zu Fall gezielt zu stützen: Dabei muss sich die Notenbank nicht zwingend auf explizite, offiziell kommunizierte Untergrenzen fixieren. Sie kann stattdessen durchaus – mit Vorteil ausgerichtet auf intern definierte strategische Wechselkursziele – kasuistisch und ohne es zu publizieren handelsrelevante Schwachwährungen kaufen, um auf diese Weise die Valutaexzesse proaktiv zu drosseln.28 Man spricht im Fall eines solchen Vorgehens von «schmutzigem Floaten» (Sinn, 2016).
Zum Fallbeispiel Schweiz: Der Entscheid der schweizerischen Notenbank, die während mehr als drei Jahren verteidigte Euro-Untergrenze Mitte Januar 2015 wieder freizugeben und dieses Instrument durch den faktischen Nachvollzug des unkonventionellen, expansiven EZB-Konzepts zu ersetzen, hat die Erwartungen – jedenfalls in einer ersten Phase – nicht erfüllt. Im Gegenteil: Offensichtlich können Tiefst- bzw. Negativzinsen – je nach Höhe der anfallenden Bonitätsprämien, der Inflationsvorteile und der Aufwertungsgewinne, die ausländische Nachfrager im Fall von Frankenanlagen erwarten können – im makroökonomischen Kontext wirkungslos verpuffen, wenn nicht temporär sogar kontraproduktiv wirken. Letzteres, weil Negativzinsen den Währungsspekulanten schweizerischen Kultstatus und Hafensicherheit signalisieren. Kommt hinzu, dass Negativzinsen die Sparer zusätzlich enteignen und landeseigene Altersvorsorgesäulen sowie überhaupt die gesamte Versicherungswirtschaft vor gravierende Anlageprobleme stellen, die Blasenbildung auf Assetmärkten fördern, zu Fehlallokationen auf Kapital- und Investitionsmärkten führen und nicht zuletzt Politik und Unternehmen von Reformen und Innovation abhalten.
Hier geht es also letztlich um eine wirtschaftspolitische Güterabwägung: Darf es sein, dass eine Währungshüterin – und das selbst im währungsökonomischen Krisenfall wie damals – das Risikomanagement ihrer eigenen Bilanz grundsätzlich höher rangiert als die Abschirmung des wohlstandsgenerierenden Exportsektors (inkl. Tourismus) und des Werkplatzstandorts Schweiz gegenüber exzessiven und substanzraubenden Währungsschocks? Natürlich kann der schweizerische Produktivsektor auch so in Zukunft florieren, aber wie Figura zeigt, wird er das bei einem Wechselkurs unter etwa 1.15 Euro/Franken mehr und mehr ausserhalb der Schweiz tun,29 und dies zum Preis einer substitutiven Verlagerung von Wertschöpfungspotenzialen, Arbeitsplätzen und Wachstum ins Ausland. Dramatik und Hintergrund dieses Erosionsprozesses lassen sich sehr eindrücklich anhand einer Stückkostenanalyse erklären, stellen doch die Lohnstückkosten im Kleinstaat ein eminentes Momentum hinsichtlich dessen internationaler Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftskraft dar. So haben sich in der Schweiz seit der Jahrtausendwende – und noch verstärkt nach dem Ausbruch der Finanzkrise und des CHF-Aufwertungsschocks – die durchschnittlichen Lohnstückkosten trotz weltweit höchster Reallöhne (vgl. Abschnitt 4.1) relativ moderat und weit unter jenen der europäischen Konkurrenz (mit Ausnahme Deutschlands) entwickelt (siehe Abbildung 2). Das darf zweifelsohne vor allem den durch den Frankenschock hierzulande ausgelösten Produkt- und Prozessinnovationen sowie den Auslagerungen von Teilen der Wertschöpfungsketten ins Euroausland zugeschrieben werden. Werden nun allerdings die Zahlen kaufkraftparitätisch bereinigt (d. h. zum Beispiel in Euro umgerechnet), so zeigt sich ein anderes, ein geradezu dramatisches Bild. Jetzt präsentiert sich nämlich die SMOPEC Schweiz als europäische Überfliegerin:
Nirgends in Europa sind die wechselkursbereinigten wettbewerbsrelevanten Lohnstückkosten so stark, nämlich bis 2015 um fast 60 Prozent, nach oben gestiegen wie im Exportland Schweiz.
Sicher ist ein schöpferisch zerstörender Strukturwandel im Sinn Schumpeters immer gut. Aber wenn innovative, solide und prosperierende Strukturen durch staatlich derart verzerrte Wechselkurse wegbrechen oder einfach geografisch ausgelagert werden, so handelt es sich hier um irreversible Verluste an Standortqualität. Die SNB hat ihren Güterabwägungsentscheid vom Januar 2015 mittlerweile graduell korrigiert, unseres Erachtens jedoch noch nicht hinreichend.
Aus dem Zielkonflikt zwischen klassischer monetärer Stabilitätspolitik, standortökonomisch proaktiver Währungspolitik und bilanzieller Risikominimierung könnte die SNB letztlich durch Einrichtung eines separat bewirtschafteten Fonds herausfinden. Dieser Fonds kann und muss – im Unterschied zum klassischen Konzept des Staatsfonds – in ihrem Eigentum bleiben, sollte jedoch durch eine selbstständige Leitung bewirtschaftet und aus ihren überschüssigen Währungsreserven gespeist werden. Die Gewinnverwendung und Bewirtschaftung des Fonds verbleibt im Hoheitsbereich der Notenbank. Und sein Kapital darf nur noch am Rand in Nominalschulden, sollte jedoch vorwiegend, strategisch diversifiziert und selbstverständlich rentabilitätsorientiert, in werthaltige, ausschliesslich ausländische Sachwerte investiert werden. Faktisch scheint sich heute die Bewirtschaftung der Währungsreserven durch die SNB in diese Richtung zu bewegen.
5.2 Migrationsdruck und Staukollaps
Seit Jahren simulieren wir für die Schweiz auf der Basis recht konservativer Prämissen verschiedene Beschäftigungs- und Wanderungsszenarien mithilfe des an der ES-HSG verwendeten SwissSim-Modells.30 Um das im Simulationsmodell anvisierte, nachhaltige Realwachstum von etwa 1,6 Prozent unter arbeitszeitlichen und produktivitätsmässigen Status-quo-Bedingungen (als weitere konservative Prämisse) zu realisieren, müssten bis 2050 für den schweizerischen Arbeitsmarkt rund eine Million überwiegend hoch qualifizierte Arbeitskräfte im Ausland rekrutiert werden. Die dadurch induzierte Zuwanderung liesse hierzulande die Wohnbevölkerung um etwa 1,6 Millionen wachsen.31 Die daraus resultierenden Externalitäten im Siedlungs-, Mobilitäts- und Emissionsbereich sowie der dadurch generierte Anstieg der Preise auf den Güter-, Faktor-, Ressourcen- und Emissionsmärkten wären immens. Eine Studie der Credit Suisse hat es Mitte 2010 unternommen, die demografischen, sozialen und ökonomischen Langzeitfolgen solcher Langfristszenarien (bis 2020) zu konkretisieren und ansatzweise zu spezifizieren (vgl. Neff, 2010). Dabei kam sie schon damals zum Schluss, dass Kleinstaaten ab einem kritischen Punkt ihrer Entwicklung auch hier Gefahr laufen, zum Opfer ihres eigenen Erfolgs zu werden.
Solange nämlich ökonomisches Wachstum mit einem parallel geschalteten Anstieg von Beschäftigung und Nettozuwanderung, Siedlungsfläche (für Wohnen, Arbeit und Freizeit),32 von Mobilität und/oder Ressourcenverbrauch bzw. Umweltbelastung verbunden ist, generiert das zwar gesamtwirtschaftliches Wachstum. Weil jedoch die Bevölkerung – immigrationsbedingt – gleichzeitig überproportional zunimmt, impliziert das nicht zwingend auch ein entsprechendes Pro-Kopf-Wachstum, es sei denn ein solches, das überwiegend dem (hoch qualifizierten) Immigranten im Arbeitsmarkt zugutekommt.33 Darüber hinaus muss sogar damit gerechnet werden, dass eine oder mehrere dieser Variablen zu wachstumsbremsenden oder gar wachstumsbegrenzenden Engpassfaktoren mutieren.34 So etwa sind – verknappungsbedingt – explosiv steigende Preise, Kosten und Qualitätseinbussen im Immobilien-, Ressourcen-, Umwelt- und Mobilitätsbereich (inkl. Staukosten) die wahrscheinliche Folge. Ebenso Tatsache ist ein zunehmender politischer Widerstand infolge um sich greifender Wachstums-, Technologie-, Infrastruktur- und Ausländerverdrossenheit in der Bevölkerung. Letztere wiederum wird unter anderem genährt durch die Angst vor Inländerverdrängung und Lohndruck am Arbeitsplatz als Folge der Immigration in den Arbeitsmarkt. Daneben macht sich zudem Verängstigung breit, so etwa vor (gefühlten) nationalen Freihandels- und Globalisierungsnachteilen und den damit verbundenen Einkommensspreizungen und ökologischen Externalitäten, vor allem aber vor Wohlfahrtsverlusten als Folge zunehmender Immigration in die nationalen Sozialsysteme. Allerdings tauchen solche Immigrationsängste nicht nur in Klein-, sondern zunehmend auch in Grossstaaten auf. Weltumspannend haben sie bei Urnengängen bereits erste Spuren hinterlassen: Annahme der Masseneinwanderungsinitiative in der Schweiz, Brexit-Ja in Grossbritannien, Trump-Wahl in den USA usw. Dennoch bleibt Fakt: Darüber, dass das Blockaderisiko solcher «Bottleneck»-Situationen ceteris paribus umso rascher zunehmen und auch umso rascher eintreten wird, je kleiner, überfüllter und prosperierender ein politisch definierter Wirtschaftsraum ist, existiert heute eine umfangreiche, theoretisch und empirisch solid basierte Literatur.
Quintessenz: Gerade der Kleinstaat ist bei der langfristigen Optimierung seiner Entwicklung mit komplexen Herausforderungen konfrontiert. Als Ausweg aus diesem Dilemma bietet sich ihm eine nachhaltige Wachstumspolitik an, die darauf angelegt wird, die Stundenproduktivität des Faktors Arbeit etwa mithilfe von mehr Wettbewerb sowie wissensbasierter technischer und organisatorischer Innovation so zu steigern, dass selbst bei schrumpfender Wohn- bzw. Erwerbsbevölkerung ein absolutes und qualitatives Wirtschaftswachstum realisiert werden kann. Nach dem eingangs erwähnten Szenario müsste in der Schweiz der gesamtwirtschaftliche Produktivitätsfortschritt je Stunde mindestens 1,6 bis 1,8 Prozent per annum betragen. Im Ausmass, wie sich ein solcher beschäftigungs- und demografiekompensierender Produktivitätsschub nicht realisieren lässt, werden Kleinstaaten ihre inhärenten Evolutionspotenziale unter gleichzeitiger Wahrung der erreichten Lebensqualität auf lange Sicht kaum auszuschöpfen in der Lage sein. In diesem schlechteren Fall zumindest müsste es ihnen gelingen, mithilfe einer zielführenden und wirksamen Migrationssteuerung, unterstützt durch struktur-, siedlungs- und technologiepolitische Reformen, die ökonomischen Wachstumsprozesse wenigstens graduell von jenen der demografischen und energetischen sowie ökologischen und flächenmässigen Inputfaktoren zu entkoppeln. Auf jeden Fall hätten sie ihre Wachstumsstrategien noch vermehrt auf qualitative Komponenten sowie auf Pro-Kopf-Werte (anstatt wie bis anhin auf absolute Gesamtwerte) auszurichten. So oder so wird die Raum- und Siedlungsplanung, flankiert durch migrationssteuernde Massnahmen, in Kleinstaaten zu einem strategischen Schlüsselbereich urbaner Entwicklungspolitik werden. Andererseits eröffnet sich dem urban geprägten Kleinstaat dabei die Chance, das Städtedesign innovativ zu adaptieren. Ihm muss es gelingen, der oft zufälligen Zersiedelung entgegenzusteuern. Denn gerade der Kleinstaat wird durch seine Raumknappheit gezwungen, die monistisch aufs Wohnen ausgerichteten Landgebiete, Vorstädte und Agglomerationsgürtel vermehrt polyzentrisch (um)zugestalten, d. h. noch vermehrt mit einem vielfältigen Mix an urbanen Qualitäten auszustatten (vgl. Schmid, 2010 und Kotkin, 2010).
Für die Inklusion in den europäischen Binnenmarkt gilt: Je stärker die zwischenstaatliche Personenfreizügigkeit eingeschränkt ist, umso mehr Freizügigkeit bzw. Mobilität braucht es in Sachen grenzüberschreitendem Wissens-, Kapital- und Güterverkehr. Ökonomische Verluste aufgrund von Einschränkungen der grenzüberschreitenden Personenfreizügigkeit können nämlich – wie oben in Abschnitt 3.4 angesprochen – mit freiem Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Real- und Humankapital wettgemacht werden. Immigration in den Arbeitsmarkt ist nämlich nur dann, dort und so lange volkswirtschaftlich gewinnbringend, als auf einem Arbeitsmarkt eine Überschussnachfrage, d. h. vor allem ein Mangel, an hoch qualifiziertem Personal herrscht. Volkswirtschaftliche Verluste bzw. Umverteilungseffekte zulasten der Inländer treten hingegen in dem Ausmass auf, in dem – separat oder mit der arbeitsmarktlichen Zuwanderung verbunden – freie Immigration in den Wohlfahrtsstaat, in die Infrastruktur, in die steuerfinanzierten Service-public-Institutionen und in die vorhandene Staatskultur stattfindet (Schwarz, 2016b). Hierbei gilt es auch den ordnungspolitischen Aspekt zu beachten, wonach freie, d. h. letztlich «kostenlose», Immigration in den Wohlfahrtsstaat liberale Rechte auf (kollektives) Eigentum der Inländerbevölkerung tangiert. Deshalb gibt es zwar ein Menschenrecht auf Auswanderung, wogegen – ausserhalb der Flüchtlingsproblematik – kein solches als Grundrecht auf freie Zuwanderung. Dies auch nicht auf internationalen Binnenmärkten.35
Eine auf dem Grundsatz der Arbeitsfreizügigkeit basierende, aber im Sinn des Subsidiaritätsprinzips differenzierende Zuwanderungsteuerung ist somit (mindestens solange sie nicht über Kontingente erfolgt) sowohl aus ökonomischer als auch aus ordnungspolitischer und menschenrechtlicher Sicht im Grund unanfechtbar. Ob die Migrationssteuerung dabei über eine Schutzklausel (im Sinn des Konzepts Ambühl), eine Karenz oder Einschränkung hinsichtlich Eintritt in den Sozialstaat, über einen Inländervorrang und/oder über eine zeitlich befristete Zuwanderungssteuer bzw. Tagespauschale erfolgen soll, muss letztlich auf der Basis von Effizienz- bzw. Wirkungsanalysen entschieden werden (vgl. Eichenberger und Stadelmann, 2016; Sheldon, 2016). Von derartigen Überlegungen sind allerdings die Führungsriegen und die veröffentlichte Meinung in der EU mit ihrer verabsolutierenden Dogmatisierung einer undifferenzierbaren Personenfreizügigkeit im EU-Binnenland zurzeit noch meilenweit entfernt.36 Dies eigentlich wohlwissend, dass sie damit die Unions- und Euromüdigkeit in den Bevölkerungen ihrer Mitgliedsländer unablässig verstärken und gleichzeitig den links- wie rechtsnational-populistischen Regungen politisch zunehmend Auftrieb verleihen.
Was bedeutet das alles nun für den Kleinstaat Schweiz? Sicher gilt auch für ihn: Die First-Best-Voraussetzungen für eine funktionsfähige Inklusion in den supranationalen Binnenmarkt sind weder eine flächendeckende Harmonisierung noch eine vorbehaltlose Personenfreizügigkeit im gemeinsamen Marktgebiet. Was es braucht, sind vielmehr unionsweit freien Handel sowie freien Marktzugang und grenzüberschreitende Kooperationsfreiheit, etwa in Forschung und Ausbildung. Essenziell ist auch Niederlassungsfreiheit für Unternehmen. Akkurat darauf beruhen ja die bilateralen Verträge zur Regelung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU. Es muss deshalb schlicht als unerträglich empfunden werden, dass die politisch und ökonomisch schwergewichtige EU – kodiert durch ihre Durchhalteparolen betreffend Freizügigkeitsdogma – den kleinen erfolgreichen Kleinstaat Schweiz, anstatt ihn konzeptuell zum Vorbild zu nehmen, vor die unabdingbare Wahl stellt, entweder die eigene Bundesverfassung zu verletzen oder aber die bilateralen Kooperationsbeziehungen Schweiz-EU integral aufzulösen. In dieser Nötigungsfalle hat die Schweiz gut daran getan, dass sie der EU Ende 2016 mit dem Modell eines Inländervorrangs «light» bei der Anstellung von Arbeitskräften in angespannten Arbeitsmärkten fristgemäss einen Migrationssteuerungsmechanismus vorgeschlagen hat, der zwar noch kaum verfassungskonform ist und zudem eher bürokratisch und wenig zielführend zu funktionieren droht. Der Vorschlag hat nämlich den Vorzug, dass er aktuell von der EU akzeptiert wird und später, d. h. im Fall einer (inskünftig nicht undenkbaren) Lockerung bzw. Differenzierung der Freizügigkeitsdoktrin durch die EU, weiterentwickelt und stringenter ausgestaltet werden kann.
Nun ist die Frage die: Wie gross ist die Eintretenswahrscheinlichkeit, dass es in der EU zu einer Enttabuisierung des Freizügigkeitsdogmas kommt? Konsultiert man die Resultate bzw. die (allerdings nie zweifelsfreien) Umfragen zu den aktuellen Bundeswahlen in Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich und weiteren Mitgliedsländern, kommt man um folgende Frage nicht herum: Wie schaffen es hier politische EU-Spitzenkräfte, den aufstrebenden, genuin EU-kritischen, zum Teil nationalistischen und rechts- bzw. linkspopulistischen Bewegungen Herr zu werden? Werden die reale EU und die reale Eurozone nach diesen – wohl schicksalsbestimmenden – Wahlen zuletzt doch noch am harten Brexit und/oder an der fehlkonstruierten Eurozone und/oder an der Migrationsfrage bzw. an der Tabuisierung der Personenfreizügigkeit zerbrechen? Ein derartiges Scheiternrisiko liegt unter heutiger Perspektive vermutlich wohl deutlich höher als 50 Prozent. Vermutlich darf umgekehrt allerdings mit über 50 Prozent Eintretenswahrscheinlichkeit erwartet werden, dass man einem solchen Schreckensszenario als Ultima Ratio doch noch mit einem tief greifenden Korrekturprozess zuvorkommen wird. Eine diesbezüglich exakte Prognose ist zwar kaum möglich. Aber eines steht fest: Die Nicht-EU-Mitgliedsländer, so vor allem die Schweiz, tun zurzeit gut daran, europapolitisch vorläufig an der Seitenlinie auszuharren, auf Zeit zu spielen und jeden (Pro-)Aktivismus zu vermeiden.





























