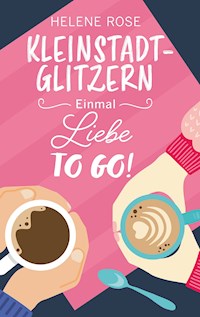
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Beziehungsstatus: Kleinstadtblues. Jeder kennt jeden in der kleinen Stadt Effelsbach. Hier lebt Mariella seit ihrer Kindheit. Als junge Redakteurin der Lokalzeitung mit einem Faible für alles, was glitzert, fehlt ihr eigentlich nur noch der Traummann zum perfekten Kleinstadtglück. Doch der ist weit und breit nicht in Sicht. Das ändert sich schlagartig, als ein neues Café am Markt eröffnet. Sofort schmiedet Mariella einen Plan, wie sie den gutaussehenden Caféinhaber und Weltenbummler Bastian für sich gewinnen kann. Doch das läuft nicht ganz wie geplant - und Mariellas beschauliche Kleinstadt-Welt gerät ins Wanken ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HELENE ROSE, geboren im Jahr 1996, studiert Linguistik an der Universität Potsdam. Vor und während des Studiums arbeitete sie in der Medienbranche. Die Autorin wohnt heute mit ihrem Partner in Potsdam, kennt aus ihrer Kindheit aber all die Eigenheiten eines Kleinstadtlebens. Das Schreiben begeistert sie seit ihrer Jugend.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 1
Jeder hat ja so seine Vorlieben. Ich zum Beispiel mochte es, wenn etwas schön war und idealerweise auch noch glitzerte. Das war allerdings hier, wo ich mich gerade befand, nicht gegeben. Und das würde es auch nie sein, dachte ich und hob meinen Blick von meinen neuen geblümten rosa Gummistiefeln, die noch sauber und trocken im Fußraum des Autos ruhten, in Richtung Kuhstall.
Genau das hatte ich beim Kauf nicht gewollt: dass sie schmutzig wurden. Was ich im Sinn gehabt hatte, war, dass ich im Grunde bei schlechtem Wetter gewappnet sein würde, aber eigentlich wollte ich meine hübschen Stiefelchen nur drinnen zur Schau tragen.
Ich hatte ein kleines Faible für aufregende Schuhe, aber für eine ernsthafte Härteprüfung waren sie nie vorgesehen, zumindest nicht in meiner Welt. Sie sollten eigentlich nur zeigen, dass ich theoretisch wusste, welches Schuhwerk in welcher Situation gefragt war.
Doch nun blieb mir gar nichts anderes übrig, als das schützende Auto meines Kollegen Torben zu verlassen, denn wir hatten einen Auftrag. Ich als Redakteurin, er als der mir zugeteilte Fotograf der hiesigen Lokalzeitung, den Effelsbacher Nachrichten, kurz EBN. Die Abkürzung sollte wohl modern im Stil eines amerikanischen Fernsehsenders klingen, nur nannte eigentlich keiner unsere Zeitung so. Außer vielleicht, man wollte aus irgendwelchen angeberischen Gründen etwas weltliches Flair in unserer ländlichen Gegend versprühen.
Effelsbach war die einzige Kleinstadt in einem Radius von sicherlich 20 Kilometern und somit das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens der näheren Umgebung. So war es die einzig logische Konsequenz, dass auch unsere Zeitung nach dieser Stadt benannt worden war. Proteste von Leuten aus dem Umland, dass auch sie Leser der Zeitung wären und somit eine Art Berechtigung auf einen angepassten Zeitungsnamen hätten, gab es zwar auch ab und an, doch sie blieben erfolglos. Wie hätte man die Zeitung sonst auch nennen sollen? Effelsbach-und-Um-land-Nachrichten? Meine Chefredakteurin Regina hätte so einen Vorschlag mit einem Wink à la »Wir wollen doch nicht albern werden« abgelehnt.
Aber die Stadt Effelsbach war nicht nur namensgebend für die Zeitung gewesen, sondern sie war für mich auch – und vor allem – meine Heimatstadt. Ich war hier geboren und liebte die Stadt schon als Kind. Sie war mein Zuhause, mein sicheres Umfeld, in dem ich jeden, der mir begegnete, mindestens schon einmal gesehen hatte. Im Gegensatz zu heute streifte ich damals allerdings meistens alleine durch die Gegend. Ich war zwar nicht völlig sozial inkompetent, nur hatten meine Eltern irgendwie vergessen, mir beizubringen, wie man üblicherweise Beziehungen unterhält. Was aber nicht erstaunlich war, wenn man sie selbst, ihre Beziehung zueinander und ihr Verhältnis zu mir genauer unter die Lupe nahm. Aus heutiger Sicht und bei genauerer Betrachtung wurde bei uns in der Familie wohl nie mehr als Smalltalk geführt.
Bis heute hat sich daran wenig geändert – weder bei ihren Bewohnern noch in der Stadt selbst.
Man konnte also fast darüber staunen, dass es offenbar dennoch genügend Themen gab, um täglich eine Ausgabe der Effelsbacher Nachrichten herauszubringen. So banal die Inhalte der Artikel einer Lokalzeitung wie den Effelsbacher Nachrichten auch sein mochten – ich liebte nicht nur die Stadt, sondern auch meinen Job. Ich fand es gut, immer als Erste zu wissen, was sich hier in der Gegend ereignet hatte. Mir gefiel es, viele Leute zu kennen. Und ja, ein kleines bisschen erhob mich auch das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, es zu hören, wenn die Leute sich zuflüsterten: »Die sind von der Presse.«
In schuhgefährdenden Situationen wie dieser, in der ich gerade steckte, führte ich mir die Liebe zu meinem Job und all seine Vorteile vor Augen, um mir glaubhaft zu versichern, dass ich hier das Richtige tat. Wirklich nur ganz kurz kam ich diesbezüglich ins Wanken, als ich abermals feststellte, dass ich auf solch ländliche Termine wie den heutigen auch verzichten konnte. Meine Stiefel und ich gehörten einfach weder in den beständigen Nieselregen noch in die erste matschige Pfütze, die direkt hinter der Autotür auf mich wartete. Als ich meine Augen ein wenig weiter wandern ließ, musste ich obendrein mit Bestürzen feststellen, dass es sich bei dieser um die erste von vielen handelte, denn der Weg zum Stall bestand quasi aus nichts anderem, und ob es in dem riesigen, schon von Weitem stechend riechenden Holzgebäude besser wurde, war mehr als fraglich.
Als ob es etwas ändern würde, seufzte ich herzzerreißend tief, was mir einen kurzen Seitenblick aus den treuen, braunen Augen von Torben einbrachte, bevor dieser seine Jacke schloss, sich die Kapuze über sein kurzes dunkles Haar (ob es noch braun oder schon schwarz war, vermochte ich nicht zu sagen, es sah mal so, mal so aus) schob, die Autotür öffnete und vom Fahrersitz herunterrutschte, um den Wagen herumlief und mir mit einem mitleidigen Lächeln meine Tür aufhielt.
»Die sind neu, hm?«, stellte er mehr fest, als dass er es fragte, und warf einen Blick auf meine Stiefel. Ich musste es ihm nicht erst erklären, er kannte mein Dilemma. Wir hatten schon viel Arbeitszeit gemeinsam verbracht und es war nicht das erste Mal, dass ich um meine Schuhe trauerte.
»Ja, sind sie«, sagte ich, erlaubte meinen Augen noch ein letztes Mal, die Stiefel-Unversehrtheit zu betrachten, und ließ dann, an Torben gewandt, zumindest einen Mundwinkel nach oben wandern, um ihm für seine Anteilnahme und das Aufhalten der Tür zu danken. Dann beendete ich das unbeschmutzte Leben meiner Stiefel.
Wir wussten beide, dass es nichts brachte, sich über Termine wie diesen zu echauffieren. Auch sie gehörten ab und an zu unserem Tagesgeschäft, wobei es nicht darum ging, ob uns das passte oder nicht. Einzig und allein unsere Chefredakteurin Regina Herrmann (deren herrischer Name Spiegelbild ihres Daseins war) verteilte die Artikel-Aufträge. Sie schickte uns aber glücklicherweise nicht allzu oft aus der Stadt raus in die (noch) ländlicheren Gebiete, viel öfter waren wir im Effelsbacher Rathaus, in Schulen oder in irgendwelchen Geschäften (wenn es Schuhe im Sortiment gab, war das sehr zu meiner Freude) zugange.
Ihr hatte ich es auch zu verdanken, dass ich bei jedem Auftrag Torben an meiner Seite hatte. Denn seit ich damals für meinen ersten Artikel über das wöchentliche Samstagsspiel der hiesigen Fußball-Kreisliga in ihren Augen ausschließlich nicht zu gebrauchende Bilder vom Spiel gemacht hatte (ich verstand bis heute nicht, was sie dagegen gehabt hatte, dass ich nur Fotos von den Zuschauern gemacht hatte, von denen übrigens am Ende gar keins gedruckt wurde), vertraute sie meinen Fotokünsten nicht mehr. Aber so unrecht war mir die damalige Entscheidung von Regina (wie Torben und ich sie heimlich nannten, wenn wir unter uns waren, denn wir durften sie offiziell nicht duzen) gar nicht, denn Torben und ich hatten uns ausgesprochen viel zu sagen, konnten uns infolgedessen gut miteinander unterhalten, und so verging die Arbeitszeit oft wie im Flug.
Doch Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel, und was sollte ich sagen: Dem war heute nicht so.
Mit hängenden Schultern stand ich auf einem nur allzu landwirtschaftlich geprägten Innenhof zwischen diversen Stallanlagen, hielt mein Notizbuch in der Hand und war bereit, Mitschriften zu machen für meinen Artikel über ein (vermutlich eher banales) dörfliches Ereignis.
Ich wusste noch nicht, worum es hier überhaupt gehen sollte. Regina hatte uns nur kurz Bescheid gegeben, dass wir uns auf den Weg machen sollten und hier am Stall erwartet werden würden, denn der Besitzer hätte für uns »eine Geschichte, aus der man was machen könnte«. Auf solche Worte sprang sie natürlich an wie ich auf ein Schild mit den magischen vier Buchstaben (Sale!) in einem Schuhladen-Schaufenster. So hatte sie uns umgehend aus der Redaktion und in Torbens Auto gescheucht. Hier standen wir nun wie bestellt und nicht abgeholt, was ja auch tatsächlich der Fall war, und guckten uns suchend um.
»Der hat wohl vergessen, dass er eine Story hatte. Das scheint ja etwas brennend Wichtiges gewesen zu sein«, meinte Torben mit einem ironischen Stirnrunzeln, was mich zumindest ein bisschen schmunzeln ließ.
Sein Kommentar kam genau zur rechten Zeit, denn ich hatte schon angefangen, damit zu hadern, dass ich überhaupt (und womöglich umsonst) meine Schuhe dreckig gemacht hatte. Um mich davon abzulenken, wandte ich mich an Torben: »Wollen wir trotzdem mal gucken gehen? Regina bringt uns um, wenn wir mit nichts zurückkommen.«
»Ach, ich weiß nicht«, sagte Torben mit einem neckischen Funkeln in seinen Augen, das mir schon verriet, dass er in seinem Kopf an einer Pointe bastelte. »Also, ich finde schon, es wäre eine interessante und vor allem neue Story, wenn wir ihr berichten, dass der Landwirt nach seinem mysteriösen Anruf verschwunden ist«, meinte er mit süffisantem Grinsen. »Und die Überschrift ist dann: ›Bei Anruf Mord‹ im Effelsbacher Umland«, fügte ich hinzu.
Wir kicherten ein wenig vor uns hin, waren kritisch betrachtet aber noch keinen Schritt weitergekommen.
Und da noch immer, abgesehen von den muhenden Kühen, kaum etwas zu hören oder zu sehen war, blieb uns nichts anderes übrig, als allein ein paar Schritte auf den Hof zu wagen. Dabei war Torben, der Fußwege eher scheute, schon extra so nah wie möglich an das offene Stalltor herangefahren (was mir stiefeltechnisch nur recht gewesen war), dann aber unerfreulicherweise durch einen Anhänger voller Strohballen daran gehindert worden, direkt vor dem Tor zu parken.
Ich konnte mir förmlich vorstellen, wie mein ebenfalls rosafarbener Mantel (sonst hätten die Stiefel sich einsam gefühlt) mit jedem weiteren Meter den stechenden Geruch, der in der Luft lag, aufnahm. Das würde eine wahre Freude für unsere Kollegen werden, wenn wir ins Büro zurückkamen. Denn als Stadtmensch auf dem Land wusste ich, dass man Stallgeruch in den Klamotten nicht so schnell wieder loswird. Torben schien mich und meinen Gesichtsausdruck für sich gedeutet zu haben und sagte zu mir: »Du bist wie die Städter, die am Wochenende für einen Ausflug herkommen. Die alles idyllisch finden, bis sie sich einem Stall nähern, der nicht so aussieht wie der aus Playmobil, mit denen ihre Kinder immer spielen.« Mit einem fast schon warnenden Blick, ich solle ein anderes Gesicht machen, bedeutete er mir, Haltung anzunehmen.
»Guck mal, da drüben kommt schon jemand«, flötete er ob des in Hörweite kommenden Mannes und deutete mit einer Kopfbewegung auf ihn.
Dass Torben heimlich bester Laune, ja, gar gespannt war, und sich weder an dem Dreck noch am Geruch störte, hätte ich mir eigentlich denken können. Er war nämlich die Art nerdiger Fotograf, der sich nicht scheute, sich in ganzer Länge (und Torben war nicht gerade klein oder wenigstens schmal gebaut) auf den Boden zu legen, um einen besseren Winkel fürs Foto zu bekommen. Auch nicht, wenn besagter Boden alles andere als steril war. In dem Fall kaufte er sich eben auf dem Rückweg in die Redaktion irgendwo ein neues T-Shirt, vorzugsweise beim einzigen Herrenausstatter unserer kleinen Stadt.
Auch hier auf dem Hof hatte er sich jedenfalls schon weitaus interessierter, als ich es war, umgeschaut, während ich mich kaum mehr als ein paar Meter von seinem Auto wegbewegt hatte. Ich wollte warten, bis man auf mich zukam, in der Hoffnung, man könnte mir den Sachverhalt auch hier darstellen.
Nun näherte sich uns jedenfalls ein großer, stämmiger Mann mit Latzhose und Basecap. Und das mit so forschem Schritt, dass bei jedem Auftreten Matsch aufspritzte (was ihn aber herzlich wenig zu kümmern schien) und ich fürchten musste, er könnte meine Stiefel oder gar meinen Mantel obendrein noch vollspritzen. Als ob wir nicht schon genug gelitten hätten.
»Tag, Möller ist mein Name. Mir gehört der Laden hier«, erklärte mir der Landwirt während eines kräftigen Händedrucks. Würde mich nicht wundern, wenn der damit gerade erst eine Kuh getätschelt hätte, dachte ich, das Gegenteil hoffend.
»Mariella Albrecht von den Effelsbacher Nachrichten. Schön, dass wir herkommen durften«, log ich. Also, der Name stimmte, aber angenehm war mir das Ganze hier nun nicht gerade.
»Sie hatten angerufen?«, fragte ich, um das Gespräch in Gang und den Termin schneller hinter mich zu bringen.
»Ich werde Ihnen mal zeigen, was passiert ist«, sagte er, ohne näher auf meine Frage einzugehen, und bedeutete uns mit einer Handbewegung, ihm zu folgen.
In der Regel waren solche Besuche ›business as usual‹, viel konnte er uns eigentlich nicht zu präsentieren haben. Vermutlich führte er uns das tausendste Kälbchen, das hier geboren worden war, vor oder so ähnlich.
Ich bemühte mich, Haltung zu bewahren und meinen Gesichtsausdruck nicht in absolutes Missfallen abgleiten zu lassen, und stellte mir als Hilfestellung vor, wie Herzogin Kate einen solchen Termin mit strahlender Souveränität absolvierte. Torben schien hingegen keine Mühe zu haben, sich erfreut darüber zu geben, sich ausgiebiger auf dem Hof umgucken können.
Und so verlangte es der Job eben. Ich konnte ja schlecht zurück in die Redaktion kommen und verkünden, dass ich den Auftrag leider nicht erfüllen konnte aufgrund der zu bedenkenden Sauberkeit für meine Schuhe. Ich konnte mir schon denken, was Regina mit einem kühlen Lächeln auf den Lippen in so einem Fall wohl sagen würde: »Wenn Sie den Job nicht machen wollen, finden wir auch jemand anderes dafür. Keiner ist unersetzbar, auch Sie nicht.«
So etwas durfte ich nicht riskieren. Ich hatte zu lange dafür gekämpft, Journalistin zu werden. Den Beruf hatte ich schon als Schülerin bei meinem zweiwöchigen Praktikum durchaus interessant gefunden, weil er mir versprach, über die ganze Welt zu berichten, ohne dafür meine sichere Heimat verlassen zu müssen. (So hatte ich mir das zumindest gedacht, während ich Notizblöcke und Kugelschreiber sortierte.) Und der Lokaljournalismus wäre für mich sogar noch besser geeignet, befand ich, denn so konnte ich von zu Hause aus über zu Hause berichten. Damit stand mein Plan fest.
Schweren Herzens musste ich dann für das Studium mein heimisches Umfeld, das immer gleiche Effelsbach, verlassen. Bis zum Ende gewöhnte ich mich nicht richtig an die neue Stadt. Als ich dann mit der glücklichen Aussicht auf einen Job bei den Effelsbacher Nachrichten zurückkehren konnte, hatte ich nicht nur meinen Traumberuf in der Tasche, sondern hatte auch gelernt, was ich wollte und was nicht. Und das war ganz klar: Ein Kleinstadtglück mit einem guten Job und am besten mit Haus und Mann sollte es sein. (Und, wenn möglich, natürlich mit schönen Schuhen.)
Immerhin – den Traumjob hatte ich schon. Zwar war meine Vorstellung nicht unbedingt gewesen, samt Notizbuch und einem übereifrigen Fotografen durch einen matschigen Kuhstall zu stiefeln, aber da ich nun mal gerne in Effelsbach leben wollte, war mir nichts anderes übrig geblieben, als bei den Effelsbacher Nachrichten zu bleiben, denn meine Hoffnung, dass die Vogue sich hier in Form einer kleinen Außenstelle niederlassen würde, war wohl unter der Kategorie ›utopisch‹ einzuordnen.
Die Stallanlage stellte sich als erschreckend lang heraus, und auch, nachdem wir sie durchquert hatten (und meine rosa Blümchen-Stiefel unterhalb des Knöchels als solche nicht mehr zu erkennen waren), war das Ziel noch nicht erreicht. Landwirt Möller ging forschen Schrittes weiter voran und schlug den Weg Richtung Weide ein. Nachdem wir auf dieser Strecke auch noch runter von der Straße mussten, um einen Traktor mit seinen zwei Hängern passieren zu lassen, hatte ich keine Hoffnung mehr für mein modisches Schuhwerk und beschloss, keinen schmerzhaften Blick gen Boden mehr zu richten und mich stattdessen auf die zu berichtende Geschichte zu konzentrieren.
Am Weidezaun angekommen, der im Prinzip nur aus ein paar dünnen Stäben samt gespannten Schnüren bestand, stoppte Herr Möller (dessen Vornamen ich noch für den Artikel erfragen musste, sonst würde mich Regina zur Strafe direkt zu ihm zurückschicken, um den rauszubekommen). Dass er stehen blieb, bedeutete mir, dass wir wohl am Ziel waren. Ich hielt prompt Ausschau nach etwas, das einer Veröffentlichung in der Zeitung würdig war, konnte aber nichts entdecken. Das schien der Landwirt zu bemerken, denn er sah sich daraufhin dazu veranlasst, eine ausschweifende Geste mit seinem Arm zu vollführen. »Sehen Sie mal dort rüber! Einer von den Kerlen aus dem Dorf muss uns den Zaun da kaputt gemacht haben. Ich hab‘ da auch schon einen Verdacht, wer das war …«
Während er sich bei Torben darüber ausließ, wer ihm aus welchen Gründen missgünstig gegenüberstand und deshalb schuld am umgestürzten Zaunabschnitt sein könnte, sah ich es als meine Aufgabe an, mir den Fall genauer anzusehen, ganz wie es die journalistische Neugier verlangte.
Wie sich nach ein paar weiter vorwärts gestaksten Metern auf der Wiese herausstellte, war der Schaden überschaubar. Das versprach ja ein ganz großer Artikel zu werden!
An sich waren wir Lokalredakteure immer froh, wenn wir Infos über eine potenzielle Geschichte zugespielt bekamen, denn es war nicht immer einfach, in unserer ländlichen Gegend jeden Tag genug Erzählenswertes zu finden, um den vierseitigen Lokalteil der Effelsbacher Nachrichten zu füllen. Ob sich jedoch aus der hiesigen Angelegenheit etwas machen ließ, hielt ich für mehr als fraglich.
Doch um Landwirt Möller und die auf Neuigkeiten wartende Regina nicht zu brüskieren, zückte ich an dieser Stelle mein Notizbuch und einen pinken Gelschreiber. (Das war natürlich nicht die Standardausrüstung für uns Lokalredakteure, aber vom Büro bekamen wir nur ein schwarzes Büchlein und Werbekugelschreiber gestellt, und wie hätte das denn ausgesehen zu meinen neuen Schuhen? Richtig, das wäre nicht machbar gewesen. Also hatte ich beschlossen, mir selbst ein bisschen farbliche Übereinstimmung zu gönnen.) Aber was sollte ich hier groß notieren? Die ganzen Mutmaßungen des Landwirts, wer der Täter sein könnte, waren unbrauchbar. Vielleicht gab es auch gar keinen Schuldigen außer dem Wind in der Nacht und einem Stab, den man selbst mit viel Wohlwollen und Großzügigkeit kaum ein Zaunpfählchen nennen konnte?
Sicher interessierten die Leser die Vermutungen des werten Herrn Möller, aber ich konnte ja schlecht Selbstjustiz spielen und die vom Landwirt Verdächtigten für die Täter ausgeben. Die würden das Geschwätz und das Misstrauen der anderen Dorfbewohner nie wieder loswerden. Und für das Sammeln von Beweisen sah ich mich nicht zuständig. Also notierte ich schlichtweg: zwei Zaunfelder umgestürzt.
Sehr gut, der erste Satz des Artikels war somit quasi verfasst. Und nun?
Ich hörte an den lauter werdenden Stimmen hinter mir, dass die beiden Männer sich mir und dem »Tatort« näherten. »Gestern war noch alles in Ordnung«, tönte die dunkle Stimme von Herrn Möller zu mir rüber. »Die müssen das in der Nacht gemacht haben. Als ich heute früh hier ankam, war der Zaun schon kaputt.« Ich notierte: nachts.
»War da Strom drauf?« Ich deutete mit meinem Stift auf die Weidenbegrenzung. Herr Möller nickte, und ich ergänzte meine Notizen um das Wort Elektrozaun.
»Ist denn sonst noch was vorgefallen? Sind Kühe entlaufen?«, fragte ich. Den Zusatz, das Wort »wenigstens« in meine zweite Frage einzubauen, konnte ich mir gerade noch so verkneifen. Trotzdem hoffte ich zugegebenermaßen schon ein bisschen, dass es so wäre, denn das würde meinem Artikel etwas mehr Esprit und Spannung und vor allem Inhalt verleihen.
»Nein, die waren alle im Stall. Den Regen und den Wind von gestern Nacht mögen die nicht so. Da ist also nichts passiert.« Ich vollführte mit einem professionellen Lächeln auf den Lippen mein wissendes, gutmütiges Nicken und versuchte, mir nicht anmerken zu lassen, dass mir eine andere Antwort lieber gewesen wäre.
Denn nach aktuellem Stand würde mein Artikel also aus zwei Sätzen bestehen: Bei Landwirt Möller ist in der Nacht ein Teil des Weidezauns kaputtgegangen. Warum, weiß bislang keiner.
Wenn das nicht für rege Gespräche am Frühstückstisch unserer Leserschaft sorgen würde, wohlgemerkt: unserer ohnehin schon tendenziell leicht abnehmenden Leserschaft. Und dass solche Artikel, wie ich ihn wohl heute verfassen musste, nicht gerade die Abo-Zahlen in die Höhe schnellen ließen, war nicht überraschend.
Da die Situation auf der Weide aber nicht mehr hergab, blieb mir wohl kaum etwas anderes übrig, als meinen Artikel mit hoffentlich halbwegs belangvollen allgemeinen Informationen zu füllen. Also fragte ich: »Wie viele Weiden haben Sie denn insgesamt?«
»Hier in der Nähe nur zwei, die eine hier und die andere dort drüben am Wald«, antwortete Herr Möller mir und machte eine Handbewegung in die ungefähre Richtung.
»Hinter dem Dorf ist aber noch eine andere große«, fügte er noch hinzu. Eine langweilige Antwort, fand ich. Aber gut, die Antwort kam immer auf die Frage an, und ich wusste selbst, dass meine nicht gerade vor Spannung strotzte. Und das war meist das erste sichere Zeichen, dass mich auch mein eigener Artikel später sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen langweilen würde. Ich konnte nur hoffen, dass sowohl Regina als auch die Leser darüber hinwegsahen, am besten darüber hinwegblätterten, und sich stattdessen freuten, ein ihnen vielleicht bekanntes Gesicht in der Zeitung zu entdecken.
Man hat es eben nicht immer leicht und schon gar nicht spannend als Lokaljournalistin. Was sie einem aber natürlich beim Vorstellungsgespräch nicht verraten, denn da wurden mir nur die Parade-Storys, über die in den Effelsbacher Nachrichten schon berichtet wurde, aufgetischt: ein Kriminalfall, vermutlich der einzige, der sich je in Effelsbach ereignet hatte; ein Promi, der in der Stadt gewesen war, was übrigens sein Alleinstellungsmerkmal werden konnte; eine nicht zu verachtende Foto-Ausstellung zum Thema »Kirchen der Region« in der nächsten größeren Stadt – auf den Zug war man gleich mit aufgesprungen und hatte ausführlich darüber berichtet.
Aber für die fehlende Spannung konnte auch Landwirt Möller nichts, also antwortete ich ihm mit einem hoffentlich interessiert wirkenden »Aha« und notierte: insgesamt drei Weiden.
»Und wie lange betreiben Sie den Hof schon?«
»Es sind jetzt bald 20 Jahre«, freute er sich sichtlich über die Frage.
»Gut, dann haben wir alles, glaube ich«, sagte ich an Torben gewandt, um ihm zu signalisieren, dass er noch ein Foto schießen sollte und wir dann zum Abflug nach Effelsbach in Richtung Redaktion ansetzen würden.
Meine spärlichen Informationen zum noch spärlicheren Gegenstand des Artikels würde ich dann später noch mit reichlich Floskeln in die Länge ziehen müssen.
Es gab nur eine Sache, die den Artikel noch etwas strecken konnte: ein sperriger Doppel-Vorname mit Bindestrich, den der Landwirt hoffentlich trug. Ich konnte gut einen Friedrich-Alexander gebrauchen, das wären immerhin 19 Zeichen pro Namensnennung.
»Ach ja, wie ist denn Ihr Vorname?«, fragte ich also hoffnungsvoll.
»Jörg. Ganz normal, wie man spricht. Und Möller mit Ö, nicht mit Ü, so wie es letztes Mal in der Zeitung stand.« Kürzer ging es wohl kaum.
»Ist notiert, danke.«
Damit war ich an dieser Stelle durch. Torben aber noch nicht, denn der strich sich eine dunkle Haarsträhne aus der Stirn (nicht vorstellbar, wenn er keinen klaren Blick durch dieses Guckfenster der Kamera, dessen exakte Bezeichnung sich nicht in meinem Wortschatz befand, hatte) und rief Jörg Möller zu sich für ein Foto. Torben mochte es nämlich nicht, wenn auf seinen Fotos keine Menschen zu sehen waren (das fand er zu »uninspiriert«), und ließ in Fällen wie dem heutigen gerne jemanden mit anklagender Geste auf etwas zeigen, was zu dem Szenario führte, dass er Herrn Möller mit traurigem Gesicht und ausgestrecktem Zeigefinger auf den kaputten Weidezaun deuten ließ.
Ich selbst musste mich schon oft genug für Torbens Fotos mit dem Rücken zu ihm beispielsweise vor irgendwelche Kunstwerke stellen oder so tun, als ginge ich zufällig an einem Gebäude vorbei. Auf diese Art fand ich mich ein-, zweimal im Monat selbst in der Zeitung wieder. Natürlich jedes Mal so, dass man mich nicht genau erkennen konnte. Das wäre ein gefundenes Fressen für die Leute, wenn rauskäme, dass »die von der Zeitung« sich ab und an selbst fotografierten, um ein paar Menschen und damit ein bisschen Leben auf die Fotos zu bringen.
Torben ließ indessen Herrn Möller noch einmal vor und einmal hinter dem umgestürzten Zaunteil posieren, kontrollierte auf dem Display seiner Kamera die Ergebnisse und schien einigermaßen zufrieden. Noch bevor wir am Auto angekommen waren, hatte er sein Lieblingsbild gefunden, zeigte es wie üblich dem Fotografierten, der das Ganze abnickte, und somit war auch Torben an dieser Stelle mit diesem Auftrag fertig. Noch zwei Handschläge, dann war unsere Mission auf dem Hof endgültig beendet.
Nachdem Herr Möller sich wieder Richtung Stall aufgemacht hatte, versuchte ich, vor der Abfahrt noch mühselig mit ein paar Taschentüchern meine Stiefel zu reinigen, was mir aber mehr schlecht als recht gelang. Also blieb mir nichts anderes übrig, als sie an meinen Füßen und so, wie sie waren, in Torbens Auto zu schwingen und ein Stückchen Stall samt beißendem Geruch mit Richtung Büro zu nehmen. Torben schien das nicht zu stören, er sah das Ganze immer eher pragmatisch. (Zum Thema Stiefel: »Die kannst du doch auch noch heute Abend zu Hause wieder sauber machen.«)
Die knapp 15-minütige Fahrt verbrachten wir teils schweigend, was eher unüblich für uns war. Aber Torben zeigte sich nicht ganz so gesprächig wie sonst, womöglich dachte er darüber nach, was er wohl zu Mittag essen könnte. Fertiggericht aus dem Supermarkt? Was vom Imbiss holen? Gar ins nahe gelegene Restaurant, den Ratskeller, gehen? Solche Fragen drängten sich einem in so einer ländlichen Gegend wie der unseren spätestens gegen 11:30 Uhr auf. Außerdem eröffnete unsere Chefredakteurin die Mittagspause immer pünktlich um zwölf Uhr, wenn die Kirchenglocken schlugen. Damit blieb Torben nur eine knappe halbe Stunde, um sich bezüglich dieser sich ihm aufdrängenden Frage zu entscheiden.
Ich sinnierte indes darüber, wie ich das eben Erlebte bloß in eine zumindest halbwegs interessant erscheinende Story verpacken konnte. Und das am besten bis 15 Uhr, denn dann stand der nächste Termin an. Am Nachmittag würde ich von Regina nämlich in die Ganztagsschule in der Nähe unserer Redaktion geschickt werden, um die Ergebnisse der zwei dort stattgefundenen Projekttage zu dokumentieren. Solche Ereignisse stellten fast schon eine Art Highlight des Lokaljournalismus dar, und die Aufbereitung dessen zu einem Artikel würde den restlichen Nachmittag und den frühen Abend einnehmen. Wichtiger als Schulprojekte waren für die Effelsbacher Nachrichten im Grunde fast nur Mitteilungen der Bürgermeisterin, das Stadtfest im Sommer und der Weihnachtsmarkt, der immer für zwei Wochenenden im Dezember geöffnet hatte. So viel mehr war hier in der Gegend sonst nicht los, was mich aber noch nie sonderlich gestört hatte. Im Gegenteil, ich mochte die immer gleichbleibende Beständigkeit, die Effelsbach für mich ausstrahlte. Vermutlich lag das daran, dass ich mich der Stadt schon als Kind so verbunden gefühlt hatte. Es war, als wäre sie meine Freundin, derer ich ansonsten nicht allzu viele hatte. Vielmehr war ich dieses eine Kind, das in selbst gebatikten Sachen (so ein Unfall würde mir heute nicht mehr passieren) zur Schule geschickt wurde, daraufhin von seinen Mitschülern als absolut merkwürdig eingestuft wurde und somit recht oft verlassen auf dem Pausenhof stand. Wenn mich dann nach der Schule Einsamkeit oder Langeweile umgab und ich mich nicht zu beschäftigen wusste, wurde ich nach draußen geschickt, waren meine Eltern doch in ihrer exzentrischen Art schon immer mehr mit sich selbst in Form von diversen Selbstverwirklichungsprojekten beschäftigt gewesen. Meine Mutter konnte sich stundenlang in ihre Malereien vertiefen, während mein Vater sich in seine Werkstatt zurückzog und dort irgendetwas zersägte und wieder zusammenschraubte. Sie waren damals wie heute immer mehr mit sich selbst als mit mir beschäftigt, und Geschwister hatte ich keine. So trieb ich mich früher oft in der Stadt herum und lernte quasi jeden Winkel kennen, die sich bis heute kaum verändert hatten, wie ich wieder einmal mehr feststellte, als ich auf der Fahrt durch Effelsbach aus den verregneten Fensterscheiben von Torbens Auto blickte.
Kapitel 2
Gerade als Torben sein Auto auf seinen Lieblingsparkpatz (weil nahe der Eingangstür) vor der Redaktion rollen ließ, wandte ich meine Gedanken wieder der Arbeit zu und kam zu dem Schluss, dass mir bezüglich der Möller‘schen Zaungeschichte wohl nichts anderes übrig bleiben würde, als zu hoffen, dass mir für den Text dieses Artikels nicht mehr als eine Spalte in der Zeitung von Regina zugedacht wurde. Torbens Foto konnte ja meinetwegen gerne größer ausfallen, sehr gerne sogar, aber ich konnte unmöglich mehr als einige Zeilen dazu schreiben, selbst nicht mit den unter uns Lokalredakteuren allseits beliebten und auch von mir durchaus geschätzten wortreichen und platzfüllenden Floskeln.
Als wir uns kurz darauf nach nochmaliger notdürftiger Reinigung meiner Stiefel mit einem gefundenen Stöckchen – bei der Torbens einziger Beitrag darin bestand, mir zuzuschauen und kluge Tipps zu geben – in der Redaktion einfanden, war es tatsächlich schon kurz vor Mittag. Für welche Essensvariante Torben sich nun entschieden hatte, wusste ich nicht, er hatte mich nicht in seine Pläne eingeweiht. Ich jedoch wollte mit den anderen in den Ratskeller gehen, ein nahegelegenes kleines Restaurant in einem alten Fachwerkhaus direkt neben dem Rathaus von Effelsbach. Wie unser Redaktionsgebäude auch lag beides direkt am Marktplatz, auf dem zwei Mal in der Woche verschiedene Stände aufgebaut waren. Von frischem Obst über chemisch riechende Tischdecken bis hin zu selbst gebauten Vogelhäuschen gab es dort an jedem Montag und Donnerstag alles zu kaufen, was vermeintlich von den Effelsbachern gebraucht werden konnte. (Ich hatte dort zwar noch nichts Begehrenswertes entdecken können, aber wer weiß, vielleicht kam doch noch einmal jemand auf die Idee, ansehnliche Schuhe anzubieten.) Ich für meinen Teil lief vor allem gerne wegen der Leute, die man dort treffen konnte, über den Markt, Regina (und Torben) wohl eher, weil das der kürzeste und damit zeitsparendste Weg von der Redaktion in den Ratskeller war.
Da es ohnehin nicht mehr lange dauern konnte, bis die Glocken der Kirche zwölf Uhr schlugen, behielt ich meinen Mantel nach dem Eintreten in die Redaktion gleich an. Als ich den langen Flur unserer Redaktion ein kleines Stück herunterging und nach links in den größten der Büroräume guckte, sah ich auch schon, dass ich nicht die Einzige mit essensgehbereitem Outfit war. Am Empfangstresen, gleich hinter der Tür zum Redaktionsraum, war Silke, die Sekretärin der Effelsbacher Nachrichten, auch schon dabei, ihre Jacke anzuziehen und ihr Portemonnaie zu suchen. Leider gehörte sie nicht gerade zu den stilsicheren Menschen, und so trug sie auch heute ihre petrolfarbene Jacke mit orientalisch anmutenden Stickereien, die ihre besten und modischsten Zeiten vor mindestens zehn Jahren gehabt hatte, zur Schau. Dazu eine Schlaghose und ein zu enges langärmeliges Oberteil. Und ihrer brünetten Kurzhaarfrisur hätte meiner Meinung nach ein frisch geschnittener Pony gutgetan. Aber da mich keiner nach meiner Meinung fragte, behielt ich diese Einschätzung für mich. Und so unmodern Silke sich auch kleiden mochte, so freundlich und zuvorkommend war sie und ich konnte mich auf sie verlassen, dass sie pünktlich die Gehaltszahlungen veranlasste – inklusive Bonus, falls ich doch einmal selbst ein Foto schoss und es überraschenderweise für die Veröffentlichung zugelassen wurde.
Ich ließ meinen Blick etwas weiter nach rechts in den Raum hineinschweifen, und – wie jeden Tag kurz vor Mittag – auch die anderen vier Redakteure waren schon ausgehbereit. Da waren Frank, der den Sportteil übernahm, Armin und Jürgen (der den klangvollen Nachnamen Rödel-Schmitz hatte), die sich meistens mit den überregionalen Themen befassten und sich deshalb ganz besonders politisch bewandert fühlten; sie waren von der Hauptredaktion aus nach Effelsbach versetzt worden (in ihren Augen eine Strafe), und der etwas schüchterne Ralfi (kein Spitzname, seine Eltern hatten das vollkommen ernst gemeint), der erst seit wenigen Wochen bei uns war und mir nach über einem Jahr endlich den Titel des »Neuen« abgenommen hatte. Ralfi machte zurzeit erst mal alles, was man ihm sagte, und fungierte nach Reginas Geheiß bei Bedarf als Ersatzfotograf (sehr zur Freude von Torben, der sich – egal, wobei – meistens lieber mir anschloss). Von allen waren Ralfi, Torben und ich als Mitt- bis Endzwanziger die Jüngsten, bei allen anderen konnte man nur ahnen, wie alt sie wirklich waren und wie viele Jahre sie rein optisch durch ihre beständige Raucherei in den in ihren Augen wohlverdienten Pausen hinzugewonnen hatten.
Mit Silke, Ralfi, Frank, Armin und Jürgen saßen Torben und ich im gleichen Büroraum, in dem mit etwas Abstand im Dreieck immer zwei Tische T-förmig aneinandergestellt waren, sodass man seinen Sitznachbarn zwar gut sehen und mit ihm sprechen konnte, der Bildschirm aber nur für den vor ihm sitzenden Betrachter einsehbar war. Mir gefiel das ausgesprochen gut, denn so bekam es Torben, mit dem ich mir einen T-Tisch teilte, nicht immer mit, wenn ich aus Versehen auf Schuhwerbung klickte statt auf seriöse Rechercheseiten. Außerdem befand sich in meinem Rücken die Wand, sodass auch keiner unbemerkt hinter mir langschleichen und einen Blick auf meinen Bildschirm erhaschen konnte. Genauso teilten sich Frank und Ralfi und, wie hätte es auch anders sein sollen, Armin und Jürgen einen der Arbeitsbereiche. Mit diesen drei T-Tischen und Silkes Empfangstresen war unser Redaktionsraum auch fast schon voll. Es gab sonst nur noch an der Wand zu meiner Linken einen Kopierer und einen größeren (zur Abwechslung nicht T-förmigen) Tisch mit einem riesigen Ordner, in dem ältere Ausgaben des Jahres archiviert wurden und auf dem wir unsere vorerst fertiggestellten ausgedruckten Artikel ablegten. Ich war mir sicher, dass dieser Tisch nicht zufällig an dieser Stelle stand, denn er lag verkehrsgünstig genau auf Reginas Laufstrecke zwischen Teeküche, Toilettenräumen, Eingangstür und ihrem eigenen Büro, dessen Tür sich zwischen meinem Platz und dem Ablagetisch befand. So konnte sie sich im Vorbeilaufen die ausgedruckten Texte schnappen und sie, ohne sich unnötig lange bei ihren Untergebenen aufhalten zu müssen, an sich nehmen. Anschließend riss sie in der Regel das Projekt an sich, bearbeitete nach ihrem Belieben den Artikel und gab ihn für den Druck frei.





























