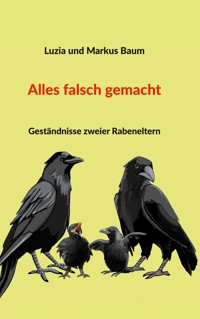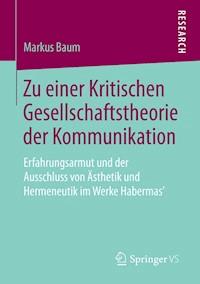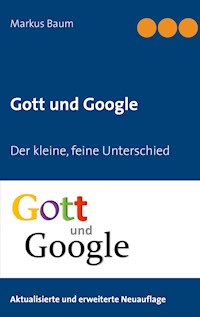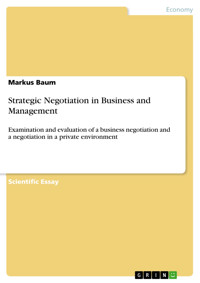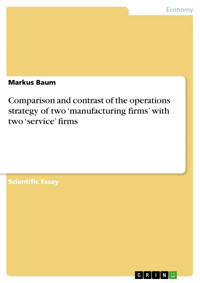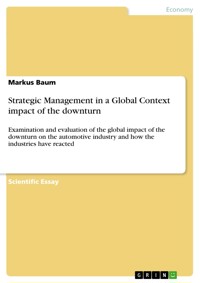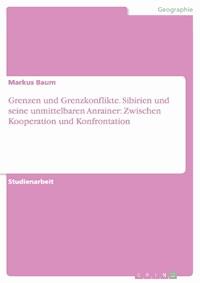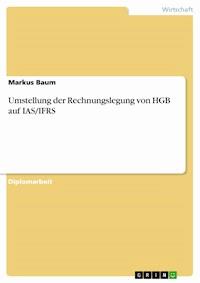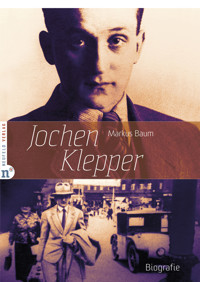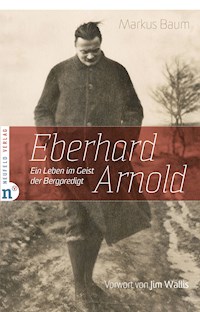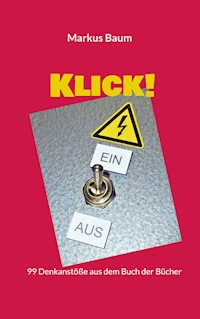
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Kleine Ursache, große Wirkung: Eine Handvoll Worte reicht manchmal schon aus, um die Welt zu verändern. Viele Sätze aus der Bibel haben dieses Potential - haben das auch in der Vergangenheit schon geschafft. Eine kleine Auswahl von 99 teils markanten, teils auf den ersten Blick recht unscheinbaren Bibelworten ist hier versammelt. Jedes einzelne kann auf seine Weise elektrisieren oder anregen oder verstören oder irritieren. Also nicht erschrecken, nur wundern und überraschen lassen, wenn etwas in Bewegung gerät oder einrastet. Klick!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Sie werden lachen: Die Bibel!“
Bertold Brecht (1898-1956), gefragt nach seiner Lieblingslektüre
Inhaltsübersicht
Vorneweg
Das ist die Höhe
Das gilt!
Das wird ja immer schöner!
Das hat mir noch keiner gesagt!
Das verbindet!
Das hält fit!
Das bringt auf Trab!
Das ist starker Tobak!
Das gibt’s doch gar nicht!
Das ist unglaublich, aber auch wahr?
Das sind ja Aussichten!
Vorneweg
Kleine Ursache, große Wirkung: Eine Handvoll Worte reicht manchmal schon aus, um die Welt zu verändern. Viele Sätze aus der Bibel schaffen das, haben dieses Potential. Sie sind zum Teil vor hundert Generationen geprägt worden, haben aber nichts an Kraft eingebüßt. Können auch heute noch etwas auslösen. Sie treffen und erschüttern, bringen viele Menschen ins Grübeln, manche zur Einsicht, einzelne zum Kassensturz oder gar zur Kapitulation. Sie verhelfen Menschen zur Änderung ihrer Sicht der Dinge – manchmal auch zur radikalen Änderung des Lebensstils.
Damit muss man rechnen, darauf sollte man gefasst sein. Eigentlich müsste jede Bibel einen Warnhinweis tragen, in Neonfarben: Vorsicht, heiß – Vorsicht, hochwirksam! Enthält Allergene, kann Menschen auf die Palme bringen, Kopfschmerzen auslösen, aber auch Glücksgefühle, Freudenausbrüche, Erkenntnisschübe. Zugegeben: Das sieht man den meisten Bibelausgaben nicht an. Und die brisanten Sätze sind oft genug auch gut versteckt zwischen weniger aufregenden, gleichwohl ehrlichen und realistischen Schilderungen aus ferner, fremder Vergangenheit.
Allein 1.824 solcher „Spreng-Sätze“ hat die Herrnhuter Brüdergemeine in der Hebräischen Bibel, dem Alten Testament der Christenheit identifiziert – und damit den Lostopf bestückt, aus dem seit 1731 für jeden Tag eines Jahres die „Herrnhuter Losungen“ gezogen werden. Ähnlich viele denkwürdige Sätze hält das Neue Testament bereit.
Eine kleine Stichprobe von 99 teilweise markanten, teilweise auf den ersten Blick recht unscheinbaren Bibelworten aus dieser großen Sammlung ist die Grundlage dieses Buches. Was diese Worte und Sätze gedanklich so alles auslösen können, das erstaunt mich immer wieder. Und ich kann nur empfehlen: Bitte nicht überrascht sein, wenn es Ihnen genauso geht. Wenn eine biblische Aussage etwas im Kopf in Bewegung setzt. Es muss nicht gleich das große Räderwerk sein – manchmal reicht es schon, wenn ein kleiner Kippschalter umgelegt wird. Klick!
Markus Baum
1. Das ist die Höhe!
Los geht’s
Alles, was endet, muss irgendwo und irgendwann einmal angefangen haben. Und alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
Wenn Sie das für eine banale Aussage halten, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Alles hat ein Ende – und alles hat einen Anfang: Das ist ganz und gar nicht selbstverständlich. Diese Behauptung ist hochgradig mit Philosophie aufgeladen. Gerade in unserer Zeit wird das mit dem Anfang und mit dem Ende massiv in Frage gestellt. Zum Beispiel wird unter Astrophysikern und Kosmologen ernsthaft diskutiert, ob diese Welt tatsächlich einen Anfang hatte – oder ob es sie vielleicht schon immer gab, nur anders. Ob der Urknall, wenn es ihn gegeben hat, wirklich so ursprünglich war, oder ob es nur ein Knall war, mit ganz viel davor. Auch wenn wir über dieses „Davor“ keinerlei Aussagen machen können.
Für die Wissenschaft mag die Frage noch offen sein. Für glaubende Menschen ist sie längst entschieden, stand sie nie wirklich zur Debatte. Die Bibel, das heilige Buch der Juden und der Christen, beginnt genau damit. „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ Punkt. Zu Deutsch: Es gab einen Anfang, natürlich, und diesen Anfang hat Gott markiert. Gott hat das Universum erschaffen, er hat sich das alles ausgedacht, ihm verdanken wir diesen schönen, lebensfreundlichen blauen Planeten, und ihm verdanken wir unser Leben.
Alles hat ein Ende, auch unsere Welt, und auch bei diesem Ende wird Gott Regie führen. Mehr noch: Gott hat offensichtlich auch schon eine Fortsetzung geplant. Auf den letzten Seiten der Bibel ist von einem neuen Himmel und einer neuen Erde die Rede. „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ Und seit diesem Anfang kümmert er sich um seine Schöpfung. Also auch um Sie und um mich. Gut zu wissen.
Was will er denn?
„Du machst ja doch, was du willst“. Wenn ich so etwas zu einem Mitmenschen sage, dann ist es in der Regel nicht schmeichelhaft gemeint. Dann schwingt da oft ein Vorwurf mit, oder es klingt resignierend.
Nun steht es uns Menschen nicht an, Gott Vorwürfe zu machen. Und die Liederdichter Israels hatten das vermutlich auch nicht im Sinn, als sie vor etwa 2.500 Jahren den 135. Psalm verfasst haben. „Alles, was der Herr will, das tut er“, heißt es da, und zwar tut er es wo? „Im Himmel und auf Erden, im Meer und in allen Tiefen“ (Psalm 135,6).
Gott macht, was er will. Das könnte bedrohlich klingen, wenn wir nicht zugleich wüssten, dass Gott gütig ist und barmherzig. Wir wissen, was er will – und was er nicht will. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Alle sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will nicht, dass fehlbare, sündige Menschen unerlöst sterben. Keiner und keine soll ahnungslos ins Verderben rennen. Und was Gott will, das tut er auch, und was er nicht will, das verhindert er. Da schiebt er einen Riegel vor. Im Himmel und auf Erden. Im Meer und in allen Tiefen.
Die Psalmisten, also die Songwriter Israels, wussten freilich auch: Gott spannt uns Menschen gerne ein, um seinen Willen umzusetzen. Da ist öfter mal von Leuten die Rede, die den Willen Gottes tun (Ps. 40,9; Ps. 103,21). Was Gott will, das tangiert mich also durchaus. Manchmal vielleicht mehr, als mir lieb ist.
Aber ich habe es ja so gewollt. Als Christ spreche ich regelmäßig das Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat, und darin bitte ich Gott ausdrücklich: „Dein Wille geschehe – wie im Himmel, so auf Erden.“ Anders ausgedrückt: „Gott, mach doch einfach, was du willst.“ Und ich bin sicher: Gott nimmt mich beim Wort. Er lässt sich nicht daran hindern, seinen Willen durchzusetzen. Am wenigsten von mir. Und das ist gut so.
Aussterbende Gattung
Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Traurig, traurig. Im Alltagsdeutschen verschwindet der zweite Fall zusehends. Und dort, wo er sich noch behaupten kann, trägt er auch nicht immer zu seiner Popularität bei. Beispiel gefällig? Ein Vers aus den Sprüchen Salomos Kapitel 1: „Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis.“ Wessen Furcht? Die des Herrn. Wessen Anfang? Der der Erkenntnis. Zweimal Genitiv gleich einmal Verwirrung. Denn natürlich fürchtet sich nicht Gott, der Herr. Sondern es geht um die Furcht VOR Gott, dem Herrn. Furcht im Sinne von Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang der Erkenntnis. Erkenntnis im Sinne von Einsicht. Wo ich Ehrfurcht vor Gott habe, da wird's Tag. Da geht mir ein Licht auf. Da bekomme ich Durchblick.
„Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis.“ Mal abgesehen von der Sache mit dem Genitiv eignet sich dieser Satz nicht, um Menschen einzuschüchtern. Im Gegenteil. Dieser Satz macht Mut, macht mutig. Im Prinzip muss ich keinen Respekt haben, vor nichts und niemand – mit einer Ausnahme: Vor Gott schon. Ihm gebührt mein Respekt, meine Ehrfurcht, meine Verehrung. Ganz unbedingt.
Und dann birgt dieser Satz auch noch einen Schlüssel. Nämlich den Schlüssel zur Weisheit. Gott ist der Inbegriff, der Hort der Vernunft und der Weisheit. Ehrfurcht vor Gott schließt mir diese Weisheit auf. Jedenfalls einen Zipfel davon. Und das ist in einer ratlosen Welt schon ziemlich viel.
Mit dem Falschen angelegt
Im Märchen vom Tapferen Schneiderlein, da legt sich ein etwas übermütiges kleines Kerlchen mit einem Riesen an – und gewinnt. Die Botschaft ist klar: Köpfchen siegt über Muskelkraft, Intelligenz und Cleverness ist wichtiger als körperliches Vermögen.
Viele Menschen haben diese Botschaft verinnerlicht. Manche allerdings übertreiben es dabei. Sie übertragen die märchenhafte Pointe auf Gott. Und das ist gefährlich. Denn Gott ist kein tumber Riese, den man einfach übertölpeln könnte. Gott ist definitionsgemäß allmächtig. Und das heißt: Er ist allemal schlauer als wir. Wir können uns zwar mit ihm anlegen, aber wir sollten uns besser nicht darauf verlassen, dass wir gewinnen.
Vor rund 2.700 Jahren hat Gott durch den Propheten Jesaja die Ansage gemacht: „Ihr in der Ferne, hört, was ich tue; ihr in der Nähe, erkennt meine Kraft!“ (Jesaja 33,13) – Was hat er denn getan, und worin hat sich seine Kraft ausgedrückt? Nun, er hat antike Großreiche überhaupt erst groß werden lassen – und hat sie innerhalb weniger Generationen auch wieder von der Landkarte getilgt. Hat anmaßende Gewaltherrscher zurechtgestutzt und großmäulige Potentaten vom Thron gestoßen, hat kleine, nach menschlicher Erfahrung eigentlich nicht überlebensfähige Gemeinwesen über Jahrhunderte blühen und gedeihen lassen. Und was er damals drauf hatte, das kann ein allmächtiger und ewiger Gott natürlich auch heute noch. Wetten dass?
Kommt ein Mann zum Arzt...
Zahllose Witze rund ums Thema Gesundheit, körperliches Wohlergehen, wirkliche und eingebildete Krankheiten beginnen so: „Kommt ein Mann zum Arzt…“. Ich habe noch nie einen Witz gehört, der mit den Worten begonnen hätte: „Kommt ein Mann zur Sprechstundenhilfe…“. Das hätte vielleicht auch seinen Reiz, aber da fehlt einfach das Gefälle zwischen den Halbgöttern in Weiß und den normalen Sterblichen. Mit der freundlichen Arzthelferin kann ich mich vielleicht über Hausmittelchen gegen meine Leiden unterhalten. Aber ob sie die richtige Diagnose stellt, die richtige Therapie weiß? Darauf würde ich dann doch keine Wette abschließen. Vom Arzt oder von der Ärztin mit Doktortitel und akademischem Hintergrund und jahre-, wenn nicht jahrzehntelanger Erfahrung im Klinikbetrieb oder in der Privatpraxis, von dem oder der erwarte ich fundierten Rat. Der oder die soll mein Leiden lindern, am besten ganz kurieren.
Kommt ein Mann zum Arzt, und das ist jetzt kein Witz. Der Arzt ist Gott. Er behauptet es jedenfalls von sich selbst: „Ich, der Herr, bin dein Heiland, und ich, der Mächtige, dein Erlöser.“ Das sagt er so im Buch des Propheten Jesaja (Jesaja 60,16). Indem Gott das so vollmundig behauptet, erklärt er alle sonstigen vermeintlichen Gurus und Heiler und Erlöser zu Scharlatanen und Großsprechern. Und das hat schon etwas zu bedeuten. Vor allem, wenn ich in Rechnung stelle, dass ich wie alle anderen Menschen an der Krankheit zum Tode leide – an der fatalen menschlichen Neigung zur Sünde, zu Regelverstößen aller Art in Gedanken, Worten und Taten. An einer unüberbrückbaren Diskrepanz zwischen Wollen und Vollbringen. Es gibt für mich keine Rettung. Es sei denn, dieser Arzt, dieser Heiland kuriert mich. Erlöst mich von meinem Leiden. Er hat die Macht dazu, auch ohne weißen Kittel und Stethoskop. Deshalb geh ich zu Gott und bleibe nicht im Vorzimmer stehen. Ich will nicht zur Sprechstundenhilfe, sondern ich gehe zum Arzt.
Nebukadnezar ist kein Raumschiff
Der babylonische Hochkönig Nebukadnezar ist Leuten U50 hierzulande vor allem deshalb ein Begriff, weil in der Filmtrilogie „Matrix“ das Raumschiff der Rebellen nach ihm benannt ist - warum auch immer. Im wirklichen Leben war Nebukadnezar ein cholerischer Gewaltherrscher. Seinen Hofbeamten und Beratern machte er das Leben schwer. Im Alten Testament und da im Buch Daniel wird berichtet, dass Nebukadnezar einmal sogar die Liquidierung der gesamten intellektuellen Oberschicht seines Reiches anordnete. Und warum? Weil keiner der babylonischen Weisen in der Lage war, einen Traum des Herrschers schlüssig zu deuten.
Der jüdische Beamte Daniel konnte erreichen, dass die Hinrichtungswelle ein wenig aufgeschoben wurde, und arrangierte mit ein paar Freunden einen Gebetsmarathon. Schon in der folgenden Nacht ging Daniel der Sinn von Nebukadnezars Traum auf. Und er nahm sich trotz der angespannten Lage Zeit für ein Dankgebet. Es begann mit den Worten: „Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke!“ (Daniel 2,20).
Gut, dass Nebukadnezar das nicht gehört hat. Denn das war ein ausgesprochen subversives Gebet. Dem Hochkönig, der Ministerpräsidentin, dem Kanzler gebührt vielleicht auch ein bisschen Respekt, aber nur für begrenzte Zeit. Gott dagegen hat von Ewigkeit zu Ewigkeit Lob und Ehre verdient. Und was Weisheit und Stärke angeht: Auch die hat Daniel nicht in der politischen Elite seiner Zeit vermutet. Sondern ebenfalls bei Gott.
Was lernen wir daraus? Wenn wir den Kopf einziehen sollen, dann nicht vor Menschen, nur vor Gott – dem Gott, der schon vor aller Zeit da war und noch immer sein wird, wenn die letzte Uhr aufgehört hat zu ticken. Und wenn wir Weisheit und Stärke brauchen, dann können wir uns praktischerweise an dieselbe Adresse wenden. An Gott. Denn der ist immer noch da. Während Nebukadnezar längst Geschichte ist.
Das nasse Element
Wasser ist zum Trinken da, zum Waschen und Spülen, und nicht zuletzt zur Erholung: für Fuß- oder Voll- oder Wellnessbäder. Viele Menschen fühlen sich im Wasser ganz in ihrem Element. Wasser spendet Leben, ohne Wasser ist unsere Existenz unmöglich. Wasser hat aber auch eine bedrohliche Seite, und die hängt nicht von der Menge ab. Unter besonders unglücklichen Umständen kann man sogar in einer flachen Pfütze ertrinken.
Der See Genezareth im Norden Israels ist mit 46 Metern Tiefe wahrlich keine flache Pfütze. Wenn starker Wind aufkommt, was unter den klimatischen Bedingungen dort gar nicht so selten ist, dann verwandelt sich das beschauliche Gewässer in Nullkommanichts in einen tosenden Kessel mit beängstigendem Wellengang. Ich war schon mal Zeuge dieses Naturschauspiels – vom sicheren Ufer aus. Seither kann ich mir die Panik der Männer vorstellen, die in ihrem Fischerboot vor knapp 2.000 Jahren weit draußen auf dem See in einen Sturm geraten sind. Nur einer von der Bootsbesatzung ist nicht in Panik geraten: Jesus. Von dem heißt es im Markusevangelium: „Jesus stand auf und bedrohte den Wind und sprach zum Meer: Schweig und verstumme! Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille“ (Markus 4,39).
Wenn einem schon ein Sturm am See Genezareth Furcht einflößen kann, dann hat Jesus, der Mann aus Nazareth, der Sohn Gottes, der über die Elemente herrscht, meinen Respekt verdient – und mein Vertrauen.
Ganz anders
Totaliter aliter: Das ist lateinisch und bedeutet „ganz anders.“ Totaliter aliter – das klingt gut, das klingt wie gereimt, und das schmeichelt dem menschlichen Gehör. Totaliter aliter – mit dieser Formel hat der Schweizer Theologe Karl Barth zu Beginn der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts Gottes Wesen charakterisiert. Gott ist der ganz Andere. Gott tickt anders, rechnet anders, handelt anders, als wir Menschen es uns vorstellen können. Auch in unseren kühnsten Träumen können wir uns nicht ausmalen, wozu Gott in der Lage ist – und was er noch alles auf Lager hat. Totaliter aliter.
Gott ist so ganz anders, seine Ideen sprengen unseren menschlichen Horizont, sein Denken ist für uns einfach zu hoch, und deshalb haben wir auch unsere liebe Mühe mit Gott. Totaliter aliter. Wie soll man sich diesem fremden, andersartigen Gott nähern? Geht das überhaupt? Mal vorausgesetzt, dass er uns natürlich versteht – aber wie kann er sich uns verständlich machen? Wie können wir etwas von ihm begreifen?
Wir brauchen ein Medium. Eine Schnittstelle. Einen Vermittler. Und an der Stelle kommt Jesus ins Spiel. „Nur einer ist Gott, und nur einer ist der Vermittler zwischen Gott und den Menschen: der Mensch Jesus Christus“, so heißt es in einem Brief, den der Apostel Paulus vor 1.950 Jahren an seinen Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat (1.Timotheus 2,5). Will heißen: Jesus ist Gottes Generalbevollmächtigter unter uns Menschen. Jesus kann himmlisch – da kommt er nämlich her. Er kann aber auch menschlich. Er hat das von klein auf gelernt. Er ist in beiden Sphären zuhause. Deshalb kann er uns den ganz anderen Gott begreiflich machen. Und genau das tut er. Er bringt uns den großen, so ganz andersartigen Gott nah. Nur er schafft das. Nur er kriegt das hin.
Abseits von Jesus, rechts und links von ihm gibt es vielleicht ehrenhafte Vermittlungsbemühungen. Aber wenn Gott wirklich totaliter aliter ist, ganz anders – dann können diese Versuche nur scheitern. Die Initiative muss schon von Gott ausgehen. Und Jesus ist Gottes Vermittlungsinitiative. In Person. Wer den ganz anderen Gott verstehen möchte, muss schon Jesus fragen.
... aber bitte sofort!
Geduld ist eine Tugend, eine seltene und kostbare noch dazu in unserer hastigen Instant-Welt. Alles muss auf Bestellung, auf Knopfdruck funktionieren. Alles muss pronto gehen und fix. Dabei strapaziert gerade die moderne Welt unsere Geduld bis aufs Äußerste. Ich sag mal nur: Verwaiste Autobahnbaustellen in der Ferienzeit. Warum rührt sich da tage- und wochenlang keine Hand, während sich der Verkehr nebenan im Schritttempo über verengte Fahrstreifen wälzt? Oder nehmen wir die Bildung: zehn oder zwölf oder dreizehn Jahre Schule bis zu einem qualifizierten Abschluss – da kann man unterwegs schon kribbelig werden. Geht das nicht schneller? Gibt’s keine Abkürzung? Gibt es nicht. Gut Ding will Weile haben. Jeder Mensch muss das lernen. Vor dem Lohn kommt die Mühe, vor dem Erfolg die Anstrengung, und bis Früchte reifen, geht viel Zeit ins Land. Deshalb ist Geduld nötig. Geduld mit anderen, Geduld mit uns selbst. Gar nicht so einfach.