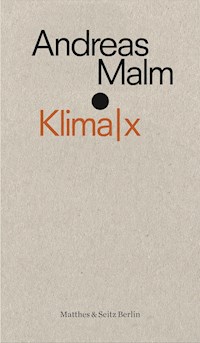
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: punctum
- Sprache: Deutsch
Nach der Krise ist vor der Krise ist in der Krise. In seinem hellsichtigen Essay, geschrieben in Berlin in den Wochen des Lockdown, der nicht nur Deutschland im Frühjahr 2020 zu einem abrupten Stillstand zwang, wirft der Klimaaktivist und Humanökologe Andreas Malm die entscheidenden Fragen auf: Wie war es möglich, dass die Staaten des globalen Nordens angesichts der COVID-19-Pandemie so effektiv und entschlossen handelten – und im Hinblick auf die Erderwärmung immer noch nichts tun? Woher kommt die Sehnsucht nach einer Rückkehr zum Normalzustand, der längst schon keiner mehr ist? Und welche Schlüsse lassen sich aus der Kriegsrhetorik, in der über die Pandemie gesprochen wurde, für den Kampf gegen den eigentlichen Krankheitserreger ziehen? Jenem Krankheitserreger, der in Corona nur eine seiner Formen fand, die zeigt: Es gilt, der Zeit der Untätigkeit in Anbetracht des globalen Feindes namens Klimakrise ein entschlossenes Ende zu bereiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Malm
Klima|x
Aus dem Englischenvon David Frühauf
punctum 017
Inhalt
I.Corona und Klima
II.Chronischer Notstand
III.Kriegskommunismus
Dank
Anmerkungen
I. Corona und Klima
Die dritte Dekade des Jahrtausends begann mit der Unterzeichnung eines weiteren historischen Konjunkturpakets zur Förderung der dystopischen Vorstellungskraft. Buschfeuer fegten über Australien hinweg, äscherten ein Gebiet ein, das größer war als Österreich und Ungarn zusammengenommen, ließen Flammen 70 Meter in den Himmel aufschießen, verbrannten 34 Menschen und mehr als eine Milliarde Tiere, entsandten Rauchfahnen über den Pazifischen Ozean bis nach Argentinien und färbten den Schnee über den neuseeländischen Bergen braun, als ein Virus auf einem Lebensmittelmarkt in der chinesischen Stadt Wuhan ausbrach. Auf dem Markt wurden in der Wildnis gefangene Tiere verkauft. Es gab Wolfswelpen im Angebot, Bambusratten, Singzikaden, Stachelschweine, aber auch Eichhörnchen, Füchse, Zibetkatzen, Schildkröten, Salamander, Krokodile und Schlangen. Als Quelle des Virus nannten erste Studien jedoch Fledermäuse. Von diesem Wirt sei das Virus auf eine andere Spezies übergegangen – Schuppentiere galten als Hauptverdächtige – und dadurch auf den Markt von Wuhan gelangt, wo ihm der Sprung auf einige der an den Geschäften entlang Flanierenden gelungen sei. Schon bald suchten Patient*innen scharenweise die Krankenhäuser auf. Einer der ersten, ein abgesehen davon vollkommen gesunder 41-jähriger Mann, der auf dem Markt arbeitete, hütete eine Woche lang mit Fieber, Engegefühl in der Brust, trockenem Husten und anderweitigen Beschwerden das Bett, bevor er hastig auf die Intensivstation gebracht wurde. Zufälligerweise stiegen während dieser Woche auch die Temperaturen in den betroffenen australischen Bundesstaaten auf über 40 Grad Celsius.
Kurz danach breitete sich das Virus wie ein elektromagnetischer Impuls über die ganze Welt aus. Anfang Februar 2020 starben täglich rund 50 Menschen, meist an akuter Atemnot und -versagen; Anfang März lag die Zahl der Opfer weltweit bei 70 Menschen pro Tag; Anfang April, bei mittlerweile 5000 Toten täglich, stand die exponentielle Wachstumskurve beinahe senkrecht. Mit mindestens einem Infektionsfall in 182 von 202 Ländern hatte der tödliche Impuls jeden Ozean überquert und fegte von Belgien bis Ecuador durch die Straßen. Zur gleichen Zeit überzogen Heuschreckenschwärme – größer und dichter als je zuvor erinnert oder aufgezeichnet – Ostafrika und Westasien, bedeckten das Land, fraßen Pflanzen und Früchte und ließen kaum einen Flecken Grün zurück. Vergeblich versuchten die Bauern, sie von den Feldern zu vertreiben. Heuschreckenwolken verdunkelten den Himmel, und ihre Körper türmten sich in rauen Mengen auf, sobald die Insekten tot zu Boden fielen, dicht genug, dass selbst Züge vor ihnen haltmachen mussten. Ein einzelner lebender Schwarm in Kenia umfasste ein dreimal so großes Gebiet wie New York City; ein üblicheres Aufgebot bestünde aus einem Vierundzwanzigstel dieser Größe, das, bis zu acht Milliarden Lebewesen umfassend, immer noch in der Lage wäre, die gleiche Menge zu verschlingen wie vier Millionen Menschen an einem Tag. Unter normalen Bedingungen kommt es nur äußerst selten zu solch riesigen Schwärmen. Ginge es nach ihr selbst, würde die Heuschrecke an ihrem solitären Lebensstil in der Wüste festhalten. Doch 2018 und 2019 wurden ebendiese Wüsten von außergewöhnlichen Wirbelstürmen und sintflutartigen Regengüssen heimgesucht, die sich in einem derartigen Feuchtigkeitsüberschuss niederschlugen, dass die Zahl der Heuschreckeneier regelrecht explodierte und somit zur Gefahr für die Nahrungsmittelversorgung von zig Millionen Menschen erwuchs – und zwar in genau jenem Moment, in dem das Virus über die Welt hereinbrach.
Kein apokalyptischer Reiter sitzt allein zu Pferd. Seuchen tauchen nicht im Singular auf. Es hat ganz den Anschein, als müssten wir auch noch mit Geschwüren und Viehpest und stinkenden Flüssen und toten Fischen und Fröschen rechnen. Zum Zeitpunkt der Niederschrift, in den ersten Tagen des April 2020, kratzt die Gesamtzahl der während der Corona-Pandemie registrierten Fälle an der Schwelle von einer Million Infizierter, während die Zahl der Toten bereits die 50 000er-Marke überschritten hat, und niemand weiß, wie all das enden wird. Um Lenin zu paraphrasieren: Es ist, als ob Jahrzehnte in Wochen gepfercht worden wären, die Welt dreht sich mit immer größerer Geschwindigkeit, sodass jegliche Prognose Gefahr läuft, sich lächerlich zu machen. Sobald jedoch auch uns ein Teil des Dystopiekonjunkturpakets zufällt, werden wir problemlos in der Lage sein, uns einen fiebrigen Planeten vorzustellen, auf dem Menschen mit Fieber leben: Es wird dort globale Erwärmung und Pandemien geben, Slums, die im Meer versinken, und Menschen, die – beispielsweise in Mumbai – an einer Lungenentzündung sterben. Im Slum Dharavi wurde bereits der erste Fall einer Coronavirusinfektion gemeldet. Eine Million Menschen lebt dort auf engstem Raum, mit minimalem Zugang zu sanitären Einrichtungen; Sturmfluten mit riesigen Wassermassen brechen jedes Jahr über den Slum herein. Zudem wird es Flüchtlingslager geben, in denen sich Krankheitserreger wie an einer Zündschnur entlang durch dicht gedrängte Körper fressen. Es wird viel zu heiß und viel zu ansteckend sein, um nach draußen zu gehen. Felder werden unter der Sonne rissig werden, ohne dass jemand sie bestellt.
Dessen ungeachtet aber ging die Coronakrise von Anfang an mit dem Versprechen einher, man werde zur Normalität zurückkehren, und dieses Versprechen war ungewöhnlich laut und glaubwürdig, zumal dieses Übel dem gesellschaftlichen System weitaus fremder zu sein schien als etwa der Crash einer Investmentbank. Das Virus war der Inbegriff eines exogenen Schocks. Man nahm daher an, dass es schon im nächsten oder übernächsten Monat verpuffen werde. Möglicherweise würde es eine zweite Welle erleben, aber damit hätte sich die Angelegenheit auch erledigt. Spätestens ein Impfstoff würde den Keim der Pandemie ersticken. Insofern wurde jede Maßnahme, die zur Eindämmung des Virus ergriffen wurde, gleich einer Straßenabsperrung der Polizei lediglich als vorübergehend angepriesen, damit wir uns mühelos das Bild eines Planeten ausmalen konnten, der geradewegs in den Status quo ante zurückversetzt wird: Straßen, die sich wieder füllen. Einkäufer*innen, die erleichtert ihre Gesichtsmasken abstreifen und in die Einkaufszentren drängen. Und all jene, die den aufgestauten Drang verspüren, genau dort weiterzumachen, wo sie vor dem Virus die Arbeit niedergelegt hatten – sie werden sich geradezu begeistert diesem Bild hingeben: die Rückkehr der Flugzeuge am Firmament, der geradezu nachwinterlich sprießende Baldachin aus weißen Kondensstreifen. Privater Konsum, womöglich verlockender als je zuvor. Niemand, der sich nach alledem noch in einen vollbesetzten Bus oder Zug zwängen wollte. All die ungenutzten Kapazitäten der Auto-, Stahl- und Kohleindustrie, die sich wieder entfalten, all die Lagerbestände, die sich endlich wieder in die Lieferketten einspeisen lassen würden. Und außer Sichtweite: die Ölbohrungen, zurück in voller Funktion, eifrig hämmernd.
Doch bei genauerer Betrachtung stellen sich diese beiden scheinbar gegensätzlichen Zukunftsszenarien als ein und dasselbe heraus. Besteht also überhaupt noch die Möglichkeit eines Auswegs?
Wenn ein Notfall besteht
Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen oder wenigstens zu verlangsamen, ergriffen Staaten auf der ganzen Welt außergewöhnliche Maßnahmen, um ihre Bürger*innen an ihr jeweiliges Zuhause zu ketten. Mit verschiedenen Abstufungen hinsichtlich ihrer Strenge wurden Lockdowns umgesetzt. Die europäischen Restriktionen verboten etwa den Kontakt mit mehr als einer anderen Person (Deutschland), das Verlassen des Hauses ohne Berechtigungsschein (Frankreich), das Verlassen des Hauses ohne Elternteil bei unter 18-Jährigen (Polen), die Ausreise aus der Heimatregion (Italien) oder das Picknicken im Park, Kneipen- und Restaurantbesuche sowie den Empfang von ausländischen Gästen (die meisten Länder). Bis Anfang April hatte sich die Mehrheit der menschlichen Spezies zu der einen oder anderen Variante eines Shutdowns verpflichtet. Und niemals zuvor war das spätkapitalistische business as usual so dermaßen außer Kraft gesetzt.
Alle Bemühungen richteten sich auf die Bekämpfung der Pandemie, wobei zwischen »systemrelevanten« und »nicht systemrelevanten« gesellschaftlichen Funktionen unterschieden wurde. Das palastartige Luxusgeschäft Harrods in London wurde letzterer Kategorie zugerechnet; hatte es selbst während der Bombardierung der Stadt im Zweiten Weltkrieg noch geöffnet gehabt, musste es am 20. März 2020 seine Pforten schließen. »Starbucks ist nicht systemrelevant«, beteuerte währenddessen eine Barista in Philadelphia, die eine Arbeiterpetition zur Schließung aller Läden in den USA unterzeichnete. Italien, ein gepeinigter Vorreiter, befahl, den Betrieb aller »nicht systemrelevanten« Fabriken und Unternehmen einzustellen, und nahm lediglich Verkaufsstellen wie Supermärkte, Apotheken und Postämter davon aus. Noch nie hatte man von einem solchen Prinzip gehört: Während manche Produktions- und Handelsformen menschlichen Grundbedürfnissen zugutekommen, sollen andere über keinen legitimen Anspruch auf ungehinderte Einnahmequellen verfügen und können daher umgehend außer Betrieb gesetzt werden.
Folglich hieß das, dass manche Dinge zu produzieren wichtiger war als andere. Eine jener Branchen, die zu diesem Zeitpunkt am offensichtlichsten systemirrelevant war, war die Automobilindustrie, und zwar nicht zuletzt, da jedwede Fabrik Gefahr lief, dem Virus als Treibhaus zu dienen. Mitte März schalteten deshalb die Autogiganten der Welt, von Volkswagen über Honda bis zu Fiat Chrysler, ihre regulären Fertigungsstrecken ab und schickten die Arbeiter*innen nach Hause. Die Just-in-Time-Produktion war ohnehin bereits unterbrochen. Dabei sollte man nicht vergessen, dass die Automobilherstellung mit ihrer unübertroffenen Fähigkeit, Robotertechnik, Maschinenbau und Fertigungskompetenzen zugunsten der Ausführung neuer Aufgaben zu mobilisieren, Bauelemente in alternativer Kombination zu montieren und in kürzester Zeit modernste Handelswaren zu produzieren, ein Wunder technologischer Gewandtheit darstellt – man erinnere sich etwa an die Umrüstungen während des Zweiten Weltkriegs. Und so ging es dieses Mal zwar nicht um Panzer und Bombenflugzeuge, sondern um Dinge wie Beatmungsgeräte: Maschinen, die Luft in die Lungen pumpen und Sekrete absaugen, um lebensbedrohlich erkrankte Patient*innen mit Sauerstoff zu versorgen. Dem US-Präsidenten Donald Trump gefiel diese Idee zunächst keineswegs – »wir sind kein Land, das auf der Verstaatlichung seiner Unternehmen beruht«, erklärte er –, und auch die U.S. Chamber of Commerce sprach sich vehement dagegen aus. Schlussendlich aber sah sich selbst Trump dazu gezwungen, den Defense Production Act in Anspruch zu nehmen, der es dem Präsidenten erlaubt, privaten Unternehmen zu gebieten, während einer Krise essenzielle Güter bereitzustellen. GM und Ford fingen an, stillliegende Betriebsanlagen von überflüssigen Gerätschaften zu befreien, die benötigten Bauteile herbeizuschaffen und herauszufinden, wie man Beatmungsgeräte en masse produzieren könne, und zwar in einem Tempo, das jenem der explodieren Pandemie gleichkam. GM gelobte sogar, Profit nicht mehr als oberste Maxime zu verfolgen.
Nachdem sie ebenfalls in das Loch der systemischen Irrelevanz gefallen waren, stellten Modemarken wie Prada, Armani, Yves Saint Laurent und H&M einen Teil ihrer Produktionskapazitäten auf Güter um, nach denen der Gesundheitssektor ausdrücklich verlangte: medizinische Overalls, Gesichtsmasken, Schutzanzüge. Keine kurz geschnittenen Bolerojäckchen oder Wildlederstiefel mit Leopardenmuster mehr. Von Kalifornien bis Dänemark rüsteten Branntweinbrennereien ihre Wodka- und Whiskyproduktion auf die Herstellung von Handdesinfektionsmittel um. Es kam zu wohldurchdachten Verlagerungen der Arbeitskraft: In Schweden wurden Flugbegleiter*innen der mit einem Startverbot belegten Scandinavian Airlines zu Pfleger*innen umgeschult und in die Krankenhäuser gekarrt, was Berichten zufolge zu landesweiten Begeisterungsstürmen führte. Nicht länger zollfreies Parfüm und regalweise Schmuck – jetzt ging es primär darum, Leben zu retten.
In der Notfallsituation wurden die Grenzen des Privateigentums eingerissen, als handelte es sich bei ihnen um Strohhütten während eines Hurrikans: Spanien verstaatlichte auf einen Schlag alle privaten Gesundheitseinrichtungen und wies Unternehmen mit potenzieller Kapazität zur Herstellung medizinischer Ausstattung an, sich den Staatsvorhaben anzupassen, während Großbritannien beinahe so weit ging, sein Eisenbahnsystem zu nationalisieren. Italien wiederum übernahm die nationale Fluggesellschaft Alitalia, schließlich stürzte kein anderer Bereich der Kapitalakkumulation mit einem dermaßen ohrenbetäubenden Krach zu Boden wie die Luftfahrt. Bis Anfang April war die Hälfte aller Flugzeuge weltweit in den Hangars verstaut, London Heathrow schloss eine seiner Start- und Landebahnen und Boeing seine Fabriken, der Massenflugverkehr wurde ins Zeitalter v. C., vor Corona, verbannt. Auch die rücksichtslos verschwenderischste aller Sportarten, die Formel 1, lag brach. Der Autosalon Genf wurde abgesagt. Das alljährlich stattfindende riesige CERAWeek-Treffen der Öl- und Gasmanager in Houston fiel aus: Plötzlich wies das fossile Kapital Lähmungserscheinungen auf. Als dann die Nachfrage einbrach, stellten Ölproduzenten den Betrieb ihrer Bohrinseln und Bohrlöcher ein, da die Preise nicht einmal mehr die Kosten insbesondere der nicht konventionellen Produktion deckten. Fracking näherte sich dem Stillstand. ExxonMobil kündigte an, seine Erschließungen im Permbecken im Südwesten der USA, dem Eldorado des Schieferöls und -gases, zu verlangsamen; insgesamt wurden zwei Drittel der für das Jahr 2020 geplanten Investitionen in eine neue Infrastruktur für die weltweite Öl- und Gasförderung auf Eis gelegt. »Nicht nur ist dies der größte wirtschaftliche Schock unseres Lebens, sondern auch kohlenstoffbasierte Branchen wie etwa die Ölindustrie stehen im Fadenkreuz«, kommentierte Goldman Sachs die Lage. »Dementsprechend ist Öl unverhältnismäßig stark betroffen.« Andere Analyst*innen sprachen davon, dass der Ölsektor mit der schwersten Krise seit einem Jahrhundert konfrontiert sei, was praktisch nichts anderes hieß als die schlimmste Krise seiner Geschichte.
Und dementsprechend stark gingen die Emissionen zurück. China, Ursprung des Ausbruchs und Schauplatz der größten Kohlendioxidschwaden der Welt, war das erste Land, in dem der Himmel aufklarte. Im Februar 2020 ging die Verbrennung von Kohle dort um mehr als ein Drittel zurück, diejenige von raffinierten Ölprodukten geringfügig weniger; ein Unternehmen vermeldete den Rückgang des Benzinabsatzes um 60 Prozent und jenen der Dieselverkäufe um 40. Inlandsflüge brachen innerhalb von zwei Wochen um 70 Prozent ein. Als Ganzes betrachtet, nahmen Chinas CO2-Emissionen in einem einzigen Monat um ein Viertel ab, ein rasanterer Rückgang als alles, was je zuvor beobachtet worden war – wobei das letztliche Ausmaß der Senkung gleich allem anderen auch nach wie vor im Ungewissen liegt –, jedoch einer, der sich zwangsläufig wiederholen würde, solange die Pandemie und die Gegenmaßnahmen ihre Bahnen um den Globus zogen.
All das war beherrscht von einer Rhetorik des Krieges. Staatsoberhäupter führten sich auf wie Oberbefehlshaber*innen auf einem Kriegspfad – »Wir befinden uns im Krieg«, verkündete Emmanuel Macron; »Wir befinden uns im Krieg und kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind«, so Donald Trump; »Wir befinden uns im Krieg, und Beatmungsgeräte sind unsere Munition«, so Bill de Blasio, Bürgermeister des US-amerikanischen Epidemie-Epizentrums New York. Parallelen zum Zweiten Weltkrieg drängten sich unwillkürlich auf: »Nennen wir es Kriegsmobilisierung«, schrieb die Los Angeles Times anlässlich der einsetzenden Produktionsumstellung. Die Zeit normaler Politik war abgelaufen, da nun selbst die Unwilligsten dazu verdammt schienen, sich der Situation zu fügen. »Wenn ein Notfall besteht und es wirklich wichtig ist, dass wir zum Kern der Sache vordringen, und zwar unverzüglich, werden wir tun, was zu tun ist«, räumte Trump ein. Zehn Tage, bevor er selbst positiv auf das Coronavirus getestet wurde und sich in die Selbstisolation sowie schließlich ins Krankenhaus zurückzog, berief der britische Premierminister Boris Johnson eine Pressekonferenz ein, auf der er feierlich verkündete: »Gleich jeder Regierung in Kriegszeiten müssen auch wir handeln«, und zwar mit »einem tief empfundenen Gefühl der Dringlichkeit«. Dem Schicksal ins Auge blickend, bekannte er: »Ja, dieser Feind kann tödlich sein, aber er ist ebenso besiegbar. Und wir wissen, dass wir ihn, insofern wir den wissenschaftlichen Ratschlägen Folge leisten, die man uns nun erteilt, besiegen werden.« Manch eine glaubte, sich plötzlich in einem mittelmäßigen, kaum realistischen Fernsehdrama wiederzufinden.
Wir haben einen Feind da draußen
»Ich will, dass ihr in Panik geratet«, mahnte Greta Thunberg wieder und wieder, als sie 2019 durch die Hallen der Weltpolitik tingelte. Führende Persönlichkeiten verschiedener Couleur – aber keineswegs alle – sonnten sich im Glanz ihrer Rechtschaffenheit und versuchten, sie für ein gemeinsames Selfie zu gewinnen. Das eine aber, was sie unter keinen Umständen taten, war, in Panik zu geraten. Und genauso wenig beherzigten sie die Aussage, die Klimakrise stelle eine dem Krieg vergleichbare Notlage dar. Seit Jahren schon handelt es sich hierbei um einen Eckpfeiler der klimawissenschaftlichen und -aktivistischen Agitation, welche die Kriegsanstrengungen der Alliierten gerne als einen faktischen Beleg für eine Gesellschaft anführt, die dem Tode ins Auge geblickt, ihre Überlebenskräfte gebündelt, sich ausschließlich einem Ziel gewidmet und es so geschafft hat, den Feind unter extremem Zeitdruck zu besiegen. Der meistzitierte Aufsatz darüber, wie die US-amerikanische Wirtschaft fossile Brennstoffe zu hundert Prozent durch erneuerbare Energien ersetzen könne, verwies auf die Hundertausenden Flugzeuge, die während des Zweiten Weltkriegs von GMs und Fords Fabriken bereitgestellt wurden. Warum also nicht auch Windturbinen und Solarkollektoren? 2011, das heißt in jenem Jahr, in dem dieser Aufsatz publiziert wurde, drängten NGOs aus allen Bereichen der Umweltschutzbewegung die Führungskräfte der Vereinigten Staaten und Chinas dazu, endlich den Kriegszustand auszurufen – schließlich bezifferte die WHO, die höchste Behörde in Fragen menschlicher Gesundheit, die Zahl der durch die Erwärmung Getöteten auf mehr als 150 000 Menschen pro Jahr.
Nur den wenigsten Minister*innen und hochrangingen »politischen Entscheidungsträger*innen« im Globalen Norden dürfte es gelungen sein, nichts über die Parallele zwischen Klimakrise und Krieg zu vernehmen. In der bis dato detailliertesten Gegenüberstellung Strategies for Rapid Climate Mitigation. Wartime mobilisation as a model for action? analysiert Laurence Delina, ein mittlerweile in Hongkong lebender Nachhaltigkeitsforscher, wie Staaten ihre Ressourcen – Geld, Arbeit, Technologie – bündeln und fossile Treibstoffe mit der erforderlichen Geschwindigkeit abwickeln könnten. Ein Leser dieses Buches, der vor Greta Thunbergs Streik wohl berühmteste Klimaaktivist, Bill McKibben, verbreitete in seinem 2016 erschienenen Essay »A World at War« auf glanzvolle Weise diese Analogie, indem er die jüngste Saison der arktischen Eisschmelze als eine verheerende feindliche Offensive sowie die Feuerstürme und Dürren, über die damals in den Nachrichten berichtet wurde, als überwältigende Attacken beschrieb, nur um im nächsten Moment die Metapher in sich selbst einstürzen zu lassen: »Es ist nicht so, dass die Erderwärmung wie
II. Chronischer Notstand
Bei genauerer Betrachtung stellt sich das Bild eines energischen Vorgehens gegen die Pandemie jedoch als nichts als ein fauler Zauber heraus. Der Gegensatz zwischen der Coronavirus-Wachsamkeit und klimatischer Selbstgefälligkeit ist illusorisch. Seit Jahren schon steht die Möglichkeit eines zoonotischen Spillover im Raum, und die Staaten haben ebenso viel getan, um sich mit dieser Gefahr auseinanderzusetzen, wie damit, den anthropogenen Klimawandel zu bekämpfen: nichts. Der bis vor Kurzem kaum geläufige Begriff »zoonotischer Spillover« verweist auf eine Infektion, die zunächst in einem Tier auftritt und dann auf einen Menschen überspringt. Ein Krankheitserreger schwappt sozusagen über, über die Artengrenzen hinaus. Es kann sich dabei um einen Wurm, einen Pilz, eine Bakterie, eine Amöbe oder um ein Virus handeln; doch welcher Form er auch sein mag, letztendlich ist der Erreger eine winzige Kreatur, die ihre Beute von innen her auffrisst. Als Inbegriff des Parasitären infiltriert das Pathogen einen Körper, in dem es sein Dasein fristet, sich ernährt, vermehrt und dabei dem Wirt Schaden zufügt.
Das »Coronavirus« bezeichnet eine Familie von Viren mit diesbezüglich besonderen Fertigkeiten. Und wie so viele andere seiner Familie entwich auch dieses spezielle Coronavirus, das von der WHO offiziell den Namen SARS-CoV-2 erhielt, seinen ursprünglichen Wirten, zu denen Fledermäuse zählen. Weshalb aber sollte es das überhaupt je tun?
Unter normalen Bedingungen fristen Coronaviren und andere zoonotische Erreger ein unauffälliges Dasein in der freien Wildbahn. Zug um Zug rücken sie von einem auf den nächsten ihrer natürlichen bzw. »Reservoir«-wirte voran – einem Tier, das den Parasiten beherbergt, ihn erträgt und kaum oder gar nicht erkrankt. Über Millionen von Jahren haben sich die Viren mit diesen Wirten gemeinschaftlich entwickelt und einen Modus Vivendi mit ihnen erreicht, der es ihnen erlaubt, deren Körper dauerhaft zu bewohnen, ohne Gefahr zu laufen, sich durch dessen Tötung selbst das Leben zu nehmen. Mitunter kann es auch dazu kommen, dass ein paar Affen oder Mäuse erkranken und auf dem Waldboden verenden, doch bevor der Mensch überhaupt Gelegenheit hätte, dies zu bemerken, wären ihre Kadaver bereits von der üppigen Vegetation überwuchert.
Tropische Regenwälder beheimaten die größte Artenvielfalt, deren Reihen sich zu den Polen hin lichten. In den hohen Breiten, dort, wo es zu geringer Sonneneinstrahlung kommt, setzten Eiszeiten die Zeiger der Evolution phasenweise zurück auf null. Demgegenüber blieben rund um den Äquator Flora und Fauna von der Vergletscherung verschont und gediehen in der von der Sonne her strömenden Energie geradezu prächtig, sodass die Tropenwälder zu Horten von erstaunlichem biotischem Überschwang werden konnten. Zugleich bilden sie jedoch auch die reichhaltigsten pathogenen Sammelbecken. Je näher am Äquator, desto größer die Anzahl der Wirte und unsichtbaren Treiber, von denen sich manche gelegentlich auf neues Terrain vorwagen. Damit ihnen dies gelingt, müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein: Die Reservoirwirte müssen – etwa indem sie Niesen, Husten oder Bluten – den Erreger auf einen anderen besonders infektionsempfänglichen Wirt abstreifen. Hat der Erreger Glück, handelt es sich dabei um einen »Verstärkerwirt«, in dessen Schoß sich der Krankheitserreger in hohem Maße vermehren, neue Genkombinationen ausprobieren, Eigendynamik entwickeln und sich auf den nächsten Schritt vorbereiten kann, der von ähnlich großem Erfolg gekrönt sein muss. Die meisten Übertragungswege stoßen dabei rasch an ihre Grenzen. Von Zeit zu Zeit aber tun sich Öffnungen auf, und die Pathogene finden ihren Weg bis zur menschlichen Population. Dabei gilt, je kürzer die Distanz, desto geringer der hierfür notwendige Kraftakt.
Es ist eine alte Geschichte: Beulenpest und Tollwut etwa sind zwei berüchtigte Beispiele zoonotischer Spillovers. Sie wirken nicht unbedingt wie besonders moderne Viruserkrankungen, die zwischen nach Parfüm riechenden Spültoiletten hausen, weshalb die von ihnen ausgehende Gefahr erst vor Kurzem als Problem der Vergangenheit abgetan wurde. Im goldensten Zeitalter des Kapitalismus, den auf den Zweiten Weltkrieg folgenden Dekaden, konnte man vernehmen, dass »die westliche Welt den Tod durch Infektionskrankheiten praktisch eliminiert« habe. Solch überschwänglich optimistische Diagnosen wurden auf die eine oder andere Weise noch bis ins letzte Jahr des zweiten Jahrzehnts des Jahrtausends beibehalten. In seinem 2018 erschienenen Bahnhofsbuchhandlungsbestseller Aufklärung jetzt ergötzte sich Steven Pinker, die tonangebende Stimme im Chor des kleinbürgerlichen Optimismus, am »Sieg über Infektionskrankheiten« auf der ganzen Welt – Europa, Amerika, allem voran jedoch die Entwicklungsländer –, der den Beweis darstellen sollte, dass »eine reichere Welt […] eine gesündere Welt« oder, weniger umständlich ausgedrückt, dass eine fest im Griff des Kapitals stehende Welt die beste aller möglichen Welten sei. »›Die Pocken [smallpox] waren eine Infektionskrankheit‹«, las Pinker auf Wikipedia – »genau: ›smallpox was‹«; sie existieren nicht mehr, und die noch nicht ausgerotteten Krankheiten werden genauso rasant dezimiert. Pinker schloss das Buch zu diesem Thema mit der zuversichtlichen Vorhersage, dass die Welt in absehbarer Zukunft von keiner Pandemie heimgesucht würde. Hätte er sich die Mühe gemacht, die wissenschaftlichen Aufsätze darüber zu lesen, hätte er gewusst, dass die Wellen einer steigenden Flut bereits damals gegen jene Festung brandeten, die er von ganzem Herzen zu verteidigen suchte.
Beispielsweise hätte er jene Seiten der Zeitschrift Nature aufschlagen können, auf denen ein Team von Wissenschaftler*innen im Jahr 2008 335 Ausbrüche »neu auftretender Infektionskrankheiten« seit 1940 untersuchte und dabei feststellte, dass ihre Zahl »im Laufe der Zeit erheblich angestiegen« sei. In den meisten Fällen handelte es sich um zoonotische Spillovers, deren Ursprung größtenteils in freier Wildbahn lag. Eine sechs Jahre später veröffentlichte Studie nahm den gleichen Trend zur Kenntnis, registrierte jedoch einen Zuwachs in den 1980ern, dem Jahrzehnt von HIV, des bekanntesten von Tieren übertragenen modernen Virus vor SARS-CoV-2. Seitdem hat sich die Liste der aus anderen Spezies eingeschleppten Erreger gleich einem fortlaufenden Kassenbon immer weiter verlängert: das Nipah-Virus, das 1998 erstmals in Malaysia nachgewiesen wurde; das West-Nil-Virus, das 1999 nach New York gelangte; Ebola, das sich 2014 mit verheerenden Folgen über Westafrika hermachte; das Zika-Virus, das 2015 durch Lateinamerika und die Karibik fegte; jenes Coronavirus, das SARS verursachte und 2002 die Welt erschütterte; jenes, das Auslöser von MERS ist und 2012 im Nahen Osten kursierte; ein Haufen alte Krankheiten, die bisweilen mit neuen Stämmen ihr Comeback feiern – Milzbrand, Lyme-Borreliose, Lassafieber –, und eine Reihe von Influenzaviren, die mit der Regelmäßigkeit von Wirbelstürmen auftreten, aber eher gesichtslose Namen tragen: H1N1, H1N2v, H3N2v, H5N2, H5Nx und so fort. 2019 wies die wissenschaftliche Literatur in regelmäßigen Abständen auf die Tatsache hin, dass »Infektionskrankheiten weltweit mit einer nie dagewesenen Geschwindigkeit auftreten« würden, wobei der geschätzte Anteil von Zoonosen daran zwischen zwei Drittel und drei Viertel liege und bei Pandemien auf fast hundert Prozent ansteigen würde. Für sich genommen handelt es sich also bereits um einen lang andauernden Trend.
Dass seltsame neue Krankheiten aus der freien Natur hervortreten, ist in gewisser Hinsicht logisch: Jenseits des menschlichen Herrschaftsgebiets lauern unbekannte Pathogene. Doch könnte dieses Gebiet auch weitgehend in Ruhe gelassen werden. Ohne die von Menschen betriebene Wirtschaft, die konstant auf die Wildnis einstürmt, sich auf sie stürzt, in sie eingreift, sie zerstückelt und mit einem Eifer zerstört, der an Ausrottungslust grenzt, würden diese Dinge nicht geschehen. Die Krankheitserreger würden nicht auf den Gedanken kommen, auf uns überzuspringen, sie wären bei ihren natürlichen Wirten sicher. Werden ebendiese Wirte jedoch in die Enge getrieben, gestresst, vertrieben oder getötet, bleiben den Erregern zwei Optionen: aussterben oder springen. In seinem momentan unbedingt lesenswerten, 2012 veröffentlichten Buch Spillover. Der tierische Ursprung weltweiter Seuchen vergleicht David Quammen diesen Effekt mit dem Abriss eines Lagerhauses. »Wenn Bäume gefällt und die darin lebenden Tiere abgeschlachtet werden, fliegen die zugehörigen Erreger davon wie der Staub«, der durch die Bulldozer aufgewirbelt wird. Die Wissenschaft ist sich einig: Der fortdauernde Trend hat eine sehr allgemeine Ursache in der Ökonomie, die von menschlicher Seite her immer weiter in die Wildnis vordringt. Es führt daher zunächst kein Weg daran vorbei, einen weiteren Umweg über die nichtmenschliche Welt zu machen. Und dieser nimmt seinen Ausgang mit der Ordnung der Chiroptera.
Von Fledermäusen und Kapitalist*innen
Die Welt beheimatet mehr als 1200 Fledertierarten (Stand 2020). Mit einer seit mindestens 65 Millionen Jahren andauernden Speziation stellen sie eine der ältesten Säugetierordnungen dar, insgesamt die zweitvielfältigste – lediglich Nagetiere weisen eine größere Varietät auf –, verantwortlich für ein Fünftel aller rezenten Säugetierarten. Fledertiere sind zugleich die ungeschlagenen Überträger von Krankheitserregern. Während Nagetiere aufgrund ihrer schieren Menge in absoluten Zahlen eine etwas größere Anzahl an Viren fassen dürften, beherbergen Fledertiere weitaus mehr solcher Gäste pro Spezies – und doch scheint es ihnen nichts auszumachen. Sie sind unentwegt infiziert, ohne Anzeichen von Beschwerden. Es liegen keine Berichte über massenhaftes Sterben kranker Kolonien vor. Infolgedessen haben Chiropterolog*innen postuliert, dass Fledertiere über eine einzigartige Toleranz gegenüber Viren, über ein außergewöhnlich starkes Immunsystem verfügten, das aus einem aufgrund der Millionen von Jahren ihrer Evolution erwachsenen gemeinsamen Merkmal entsprungen sei. Worum könnte es sich dabei handeln?
Allen Fledertieren ist eine charakteristische Fähigkeit zu eigen: Sie können fliegen. Während manche Eichhörnchen und Lemuren in der Lage sind, kurze Strecken segelnd oder gleitend zu bewältigen, stellen Fledertiere die einzigen Säugetiere dar, die es mittels frenetischen Flügelschlags zu einem anhaltenden Flug bringen. Derlei Aktivität ist jedoch nicht ohne Einschränkungen zu haben. Um in der Luft zu bleiben, müssen Fledertiere ungeheure Mengen an Energie aufwenden, wodurch ihre Stoffwechselraten an jenen Punkt gelangen, an dem ihre Körpertemperatur mehrere Stunden lang 40 Grad Celsius erreicht – vergleichbar Marathonläufer*innen. Weniger rüstige Säugetiere würden diesen Zustand als Fieber erleben. Wie man weiß, handelt es sich bei Fieber vorrangig um einen Abwehrmechanismus krankheitsgeplagter Körper, was darauf hinzudeuten scheint, dass Fledertiere – für die dies vielmehr einen natürlichen Zustand darstellt – eigentlich dazu imstande wären, ein Fieber auszubilden, um einen Erreger abzuschütteln. Umgekehrt bedeutete es aber auch, dass sich Viren, die sich auf Fledertieren ansiedeln, den fieberähnlichen Temperaturen anpassen müssen. Die Theorie besagt also, dass Fledertiere zu Trägern von Krankheitserregern geworden sind, die zwar ihre körperliche Verfassung nicht beeinträchtigen, dafür aber das schwächere Immunsystem anderer Säugetiere überwältigen können. Die Fähigkeit zu fliegen zeitigt aber auch noch andere Dinge: Sie erlaubt es Fledertieren, weite Strecken zurückzulegen – Dutzende Kilometer pro Nacht zur Nahrungsbeschaffung, Hunderte zwischen Schlafplätzen, mehr als eintausend Kilometer zwischen Sommer- und Winterquartieren – und dabei Pathogene aufzunehmen und zu verbreiten. Fledertiere verbringen wenig Zeit auf dem Boden und dafür aber viel in der Luft, auf Bäumen, unter Dächern, in Positionen, von denen aus sie Speichel und Kot auf alles fallen lassen können, was sich unter ihnen befindet. Wenn Anlass dazu besteht, schrecken sie auch nicht davor zurück, sich Menschen zu nähern, in ihre Obstgärten, Häuser und Ställe, auf ihre Felder vorzudringen.





























