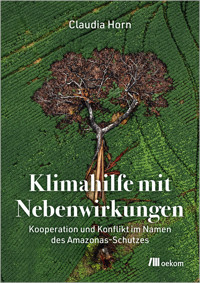
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Klimafinanzierung gilt als zentrales Instrument für eine gerechte ökologische Transformation. Doch was, wenn die Milliardenhilfen für den Globalen Süden neue Ungleichheiten schaffen und koloniale Naturausbeutung unter grünem Vorzeichen fortschreiben? Am Beispiel Brasiliens zeigt Claudia Horn, wie internationale staatliche Gelder für den Amazonas-Schutz – etwa aus Deutschland, Norwegen und Großbritannien – wichtige Umweltmaßnahmen unterstützen. Gleichzeitig tragen sie jedoch dazu bei, die sozioökologischen Risiken von Rohstoffhandel und Agrarwirtschaft zu normalisieren und traditionelle Nutzungsrechte infrage zu stellen. Umstrittene Projekte, die den finanziellen Wert der Natur an erste Stelle setzen, beeinflussen lokale territoriale Konflikte – mit weitreichenden sozialen Folgen. Ein scharfsinniger Blick auf die politischen sowie wirtschaftlichen Mechanismen und Widersprüche der Klimafinanzierung und die zentrale Frage, unter welchen Bedingungen sie wirklich zu mehr Klimagerechtigkeit führen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Claudia Horn
Klimahilfe mit Nebenwirkungen
Kooperation und Konflikt im Namen des Amazonas‐Schutzes
Das Lektorat des Textes und die Umschlagillustration wurden gefördert von der Rosa‐Luxemburg‐Stiftung. Für diese Publikation ist alleine die Herausgeberin verantwortlich. Die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt des Zuwendungsgebers wieder.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2025 oekom verlag, Münchenoekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH Goethestraße 28, 80336 München+49 89 544184 – 200 [email protected]
Layout und Satz: oekom verlagUmschlaggestaltung: Laura Denke, oekom verlagUmschlagabbildung: Pablo AlbarengaDruck: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978‑3‐98726-483-2https://doi.org/10.14512/9783987264832
Menü
Cover
fulltitle
Inhaltsverzeichnis
Hauptteil
Inhaltsverzeichnis
Einführung :
Geld für die Umwelt oder Umwelt fürs Geld?
Kapitel 1:
Grüne Staaten und globaler Extraktivismus
Kapitel 2:
Wem gehört Amazonien?
Kapitel 3:
Anreize für den Agrarsektor
Kapitel 4:
Die Politik der Schutzgebiete
Kapitel 5:
Wertschätzung oder Wertschöpfung
Epilog:
Gerechte Finanzierung für Umwelt und Klima
Literatur
Abkürzungsverzeichnis
Zitierte Interviews
Über die Autorin
Anmerkungen
Einführung Geld für die Umwelt oder Umwelt fürs Geld?
Die meisten von uns haben irgendwann schon einmal ein Versprechen gekauft – zum Beispiel das Versprechen, zur Rettung des Amazonas‐Regenwaldes beizutragen –, indem wir mit dem Kauf eines Gourmet‐Kaffees oder eines teureren Flugtickets den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid kompensieren. Es scheint verlockend einfach, den Amazonas zu retten, indem wir das tun, was wir am besten können: konsumieren. Und selbst wenn wir ziemlich genau wissen, dass dieser Kauf die Entwaldung nicht wirklich stoppt, kann er, so scheint es, zumindest nicht schaden. In ähnlicher Weise setzen Regierungen der Industriestaaten des sogenannten Globalen Nordens seit Jahrzehnten darauf, Steuergelder für Entwicklungshilfe zur Rettung der grünen Lunge der Welt auszugeben, und zwar stetig höhere Summen: Ende der 1980er‐Jahre, als in den Medien weltweit über die alarmierenden Brände in Brasilien berichtet wurde, schrieb sich die Gruppe der sieben reichsten Länder (G7) auf die Fahnen, mit Millionen von US‑Dollar für die Erhaltung und nachhaltige Entwicklung der brasilianischen Regenwälder zu sorgen. In den 2000er‐Jahren spendete Norwegen eine Milliarde für Brasiliens Amazonienfonds. Und jüngst schloss eine Gruppe transnationaler Unternehmen, darunter Amazon, Bayer und Walmart, mit den Regierungen von Großbritannien und Norwegen und dem Gouverneur des Bundesstaats Pará im brasilianischen Amazonasgebiet einen Vertrag über ein milliardenschweres umstrittenes Emissionshandelsprogramm. Belém, die Hauptstadt von Pará – in der ich fünf Jahre lang gelebt habe und die im Herbst 2025 Gastgeber des Klimagipfels COP30 ist – kann die Flut von Partnerschaftsangeboten von Ländern und Unternehmen aus aller Welt zurzeit kaum bewältigen. Das Geschäft mit der Rettung des Amazonas floriert weit stärker als der Amazonas‐Regenwald selbst. Schwere Dürren, Waldbrände, Wasserverschmutzung und Entwaldung durch Bergbau, Gewalt gegen Indigene und Umweltaktivist:innen, Landflucht und Armut in den Favelas der immer größer werdenden Städte sind Merkmale der globalen ökologischen Katastrophe.
Dieses Buch untersucht die Entstehung und die widersprüchlichen lokalen Wirkungen von Interventionen staatlicher Zusammenarbeit der Länder des Globalen Nordens zum Umwelt‐ und Klimaschutz in Ländern des Globalen Südens. Es geht im Folgenden darum, wie staatliche Akteure aus dem Globalen Norden und Brasilien gemeinsam mit internationalen Finanzinstitutionen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) Möglichkeiten entwickeln, den brasilianischen Amazonaswald zu einem Handelsobjekt für sogenannte Emissionskompensationen (Offsets) zu machen, anstatt emissionslastige Wirtschaftsstrategien aufzugeben. Man stelle sich das ökologische Äquivalent zu einer magischen Diätpille vor, die die klimaschädlichsten Industrien sportlich aussehen lässt, ohne dass diese ihren Profithunger und die Verschmutzung der Umwelt stoppen müssen. Dieses Buch führt die Lesenden von den Klimastrateg:innen in Großbritannien, Deutschland und Norwegen über die globalen Klimakonferenzen in Glasgow und Dubai in die brasilianische Hauptstadt Brasília und bis in die Schutzgebiete und Amazonasgemeinden im Bundesstaat Pará. Das Buch untersucht, inwieweit ein Ansatz der Umweltfinanzierung, der Natur als Objekt für den Privatsektor behandelt, die Ursachen von Umweltschäden bekämpfen kann, wie es in Hochglanzbroschüren und offiziellen Reden erklärt wird, oder ob er womöglich selbst Konflikte schürt.
Von der Umwelthilfe zur Klimafinanzierung
Der Klimawandel verschärft die Ungleichheiten zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden ebenso wie die regionalen Ungleichheiten. Sowohl die Auswirkungen als auch die Maßnahmen zur Eindämmung und Anpassung des Klimawandels werden unverhältnismäßig stark von den Menschen im Globalen Süden getragen. Das umstrittenste Thema der internationalen Klimapolitik in den letzten 30 Jahren war die Frage, wer die Kosten für den Klimaschutz, für die Anpassung an den Klimawandel und für die durch ihn verursachten Verluste und Schäden (»Loss and Damage«) tragen soll und wie hoch diese Kosten sind. Auf der UN‑Klimakonferenz in Baku im November 2024 verpflichteten sich die reichen Länder, bis 2035 jährlich 300 Milliarden US‑Dollar für die Klimaschutzmaßnahmen der Entwicklungsländer bereitzustellen, womit sie ihr vorheriges (nicht erreichtes) Ziel von 100 Milliarden US‑Dollar übertrafen. Diese Summe reicht aber bei Weitem nicht an die von den Entwicklungsländern geforderten 1,3 Billionen US‑Dollar heran und entspricht in keiner Weise der historischen ökologischen Schuld der Industrieländer als Verursacher des Klimawandels. Anstatt mehr Hilfe bereitzustellen oder Schulden der Entwicklungsländer zu streichen, fördern die Industrieländer die Verbindung von öffentlicher und privater Finanzierung und sogenannte naturbasierte Lösungen (Nature‐Based Solutions, NBS), insbesondere die Nutzung von Kohlenstoffsenken wie Wäldern und Offsets in Entwicklungsländern.
Klimafinanzierung für den Tropenwaldschutz ist nicht aus dem Nichts entstanden, sondern in die gewachsene institutionelle Struktur der öffentlichen Entwicklungshilfe eingebettet. Diese umfasst Darlehen oder Zuschüsse von Regierungen und staatlichen Organisationen. Traditionell zielen sie auf die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in den Empfängerländern des Globalen Südens ab. Die traditionellen »Geberländer« stimmen ihre Interessen innerhalb des Entwicklungshilfeausschusses der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD‐DAC) ab. Multilaterale, mini‐ und bilaterale Initiativen setzen die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) durch finanzielle oder technische Hilfe um.
Die Umwelthilfe entstand in den 1980er‐Jahren, als die Staaten des Globalen Nordens als Reaktion auf die Forderungen der Zivilgesellschaft begannen, eine ökologische Modernisierungspolitik zu verfolgen. Ein Teil ihrer öffentlichen EZ begann, sich mit ökologischen Problemen in Entwicklungsländern zu befassen. Auf der UN‑Konferenz über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 forderten die Entwicklungsländer, dass die Klimafinanzierung zusätzlich zur EZ in Form von bedingungslosen Zuschüssen gewährt werden sollte. Die Geberländer plädierten hingegen für die Verbindung der Finanzierung von Entwicklung und Umwelt, um zusätzliche Verpflichtungen zu umgehen. Studien zu Schwerpunkten und Verteilung der staatlichen EZ deuten aber darauf hin, dass die sogenannten Geber »globalen Themen« (wie Kohlenstoffvorräten) Vorrang vor lokalen Themen (wie Abwasserentsorgung oder der Verschmutzung von Gewässern) einräumen.1 In der Praxis haben die Geber einen erheblichen Anteil der Klimafinanzierung über bestehende, oft bilaterale EZ‑Budgets und ‑Mechanismen, die sie kontrollieren, kanalisiert.2 Darüber hinaus zeigt der Climate Finance Shadow Report von Oxfam jedes Jahr, dass die Geber ihre Finanzierungsziele nicht erreichen und ihre Klimafinanzierung überbewerten, indem sie Darlehen so ausweisen, als wären es Zuschüsse.3 Bei einer korrekten Angabe würde die Klimafinanzierung der Europäischen Union (EU) von den angegebenen 23,2 Milliarden Euro auf 11,6 Milliarden Euro sinken.4 Kurz gesagt, die Industrieländer sind Rechenkünstler und Strategen, was ihre EZ angeht.
Naturbasierte Lösungen und die Klimapolitik
Die Nord‐Süd‐Klimafinanzierung hat zwei Kernthemen: erneuerbare Energien und naturbasierte Lösungen. Diese Analyse konzentriert sich auf letztere, am Beispiel internationaler Regenwaldschutzprogramme in Brasilien. Länder, die aufgrund ihrer nationalen Klimapolitik und ihrer globalen Führungsrolle im Klimaschutz als »grün« gelten – wie etwa Norwegen, Deutschland oder Großbritannien – haben über Jahrzehnte in multilaterale und bilaterale Pilotfinanzierungsprogramme für Marktmechanismen im Tropenschutz investiert.
Finanzmechanismen zum Schutz der Umwelt, der biologischen Vielfalt und der Kohlenstoffvorräte sind nicht neu. Die Idee der Offset‐Märkte, die in den USA bereits in den 1960er‐ und 1970er‐Jahren aufkam, versprach eine Alternative zu dem, was Unternehmen als Wachstumsverbot durch Umweltregulierung ansahen, und wurde zum bevorzugten Mechanismus der führenden politischen und wirtschaftlichen Akteure der USA und der EU.5 Befürworter behaupteten, dass Marktmechanismen, die den »Umweltgütern« einen bestimmten Wert beimessen, im Vergleich zu regulatorischen Maßnahmen die kosteneffizienteste Lösung seien, um alle Sektoren einzubeziehen und die Finanzierung zu erweitern, die Transparenz und Rechenschaftspflicht der Waldbewirtschaftung zu erhöhen und die Entwicklungsländer durch finanzielle Anreize einzubinden.6
Anfang der 2000er‐Jahre entstand der umstrittene Mechanismus für die Reduzierung von Emissionen durch Entwaldung und Walddegradierung (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD+). Ursprünglich wurden insbesondere Zahlungen für vermiedene Entwaldung von den marktbasierten Mechanismen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen ausgeschlossen, da es erhebliche Bedenken dagegen gab. So könnte sich die Entwaldung in andere Gebiete oder Länder verlagern (Leakage), es besteht die Gefahr, dass Wälder ohne Intervention gerodet oder unrealistische negative Szenarien prognostiziert werden, um eine Finanzierung zu erhalten (Additionality). Bäume speichern Kohlenstoff nur vorübergehend, bis sie absterben und ihn freisetzen, wodurch Wälder zu Nettoemittenten werden, wie dies derzeit für den Amazonas befürchtet wird (Permanence). Der in Wäldern gespeicherte Kohlenstoff ist schwer zu messen, und die Daten dazu sind unzuverlässig (Measurement).7 Während Emissionsminderungen durch fixe Infrastrukturen für Solar‐ und Windenergie dauerhaft sind, kann ein geretteter Baum am nächsten Tag gefällt werden. Darüber hinaus befinden sich die meisten der verbleibenden Primärwälder der Welt im Globalen Süden, wo indigene und traditionelle Völker leben. Die Agrarindustrie und der Bergbau bedrohen diese Wälder und machen Entwaldung zu einem wesentlichen Faktor globaler Emissionen. Klimawandel und Naturschutzmaßnahmen haben weitreichende Auswirkungen auf globale und lokale Machtverhältnisse sowie auf die Ungleichheit beim Zugang zu Land und Natur. Der Status von Wäldern als globalem Gemeingut auf Kohlenstoffmärkten steht im Widerspruch zu nationalen Souveränitätsansprüchen einerseits und indigener, traditioneller und gemeinschaftlicher Nutzungsrechte andererseits.
Gegner sehen in der Kommerzialisierung von Kohlenstoffsenken einen grünen Landraub (green grab) und eine Verletzung der unveräußerlichen Rechte indigener und traditioneller Völker und der Prinzipien globaler Klimaschutzmaßnahmen.8 Der Emissionshandel kann Verschmutzungsrechte und sogar Prestige und Gewinne für Unternehmen generieren.9 Dabei stoßen die sehr intransparenten Kohlenstoffprojekte oft auf den Widerstand lokaler Gemeinschaften.10 Die Forschung weist auf die gravierenden Zielkonflikte zwischen der kostengünstigen Maximierung von Emissionsreduktionen und den Vorteilen betroffener Gemeinschaften hin.11 Auch Jahrzehnte nach dem Aufstieg von REDD+ und ähnlichen Programmen ist die Gerechtigkeit ein heikles Thema, da lokale Gemeinschaften noch immer wenig finanzielle Unterstützung für den Naturschutz bekommen, während Landwirt:innen und Plantagenbesitzer:innen, die die Entwaldung vorantreiben, ein grünes Image erhalten können.12 In dieser Hinsicht untersucht das Buch, inwieweit staatliche Umwelthilfen des Globalen Nordens zu sozialökologischer Gerechtigkeit beitragen bzw. womöglich ein Greenwashing der Naturausbeutung und die Marginalisierung betroffener Gemeinschaften in Brasilien ermöglichen.
In den letzten Jahrzehnten hat es bei der Entwicklung naturbasierter Lösungen Rückschläge und Neuanfänge gegeben. Zunächst erlebten die Kohlenstoffmärkte im Jahr 2009 aufgrund der Finanzkrise einen erheblichen Abschwung. Die geringe Nachfrage nach Kohlenstoff‐Assets stellte die Wirksamkeit eines Systems infrage, bei dem vor allem Unternehmen aus dem Globalen Norden ihre Netto‐Null‐Emissionsziele kostengünstig erreichen können. Zwischen 2018 und 2022 wurde der weltweit größte REDD±Mechanismus, der brasilianische Amazonienfonds, durch die Demontage demokratischer und umweltpolitischer Institutionen unter der umweltfeindlichen Regierung Jair Bolsonaros lahmgelegt. Im Jahr 2021 wurde bekannt, dass der Amazonas‐Regenwald – damals regelmäßig wegen Entwaldung und Bränden in den Nachrichten – einen Kipppunkt erreicht hat. Dies hat zur Folge, dass er sich von einer Kohlenstoffsenke zu einem Nettoproduzenten von Kohlenstoffemissionen wandelt. Dadurch werden die Ökosysteme des gesamten Kontinents in Mitleidenschaft gezogen, darunter auch die landwirtschaftliche Produktion, die das Herzstück der Wirtschaft von Brasilien, Argentinien und Paraguay bildet.
Der Hype um naturbasierte Lösungen ist dennoch ungebrochen. Selbst frühere Gegner wie die brasilianische Regierung sprechen sich inzwischen dafür aus. Im Jahr 2023 erzielten die globalen Kohlenstoffmärkte Rekordwerte. Im Jahr 2021 verabschiedeten die Länder in Glasgow das Regelwerk des Pariser Klimaabkommens einschließlich Artikel 6. Dieser sieht flexible Handelsmechanismen vor, die es Industrieländern und Unternehmen ermöglichen, einen Teil ihrer Emissionen durch den Kauf von Zertifikaten bzw. die Finanzierung von Klimaschutz‐ und Waldschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern zu kompensieren. Die Waldländer müssen dann entscheiden, ob sie die Emissionseinsparungen zur Erfüllung ihrer Klimaziele (NDCs) verwenden oder sie als »international übertragbare Minderungsergebnisse« (ITMOs) zum Handel anbieten. Dieser Aspekt ist eine Gefahr für die Klimagerechtigkeit, insofern es für die Länder des Globalen Südens teurer wird, ihre NDCs zu erfüllen.
Weder die Verbreitung von Normen noch das Aufzwingen von Vorgaben aus dem Globalen Norden könnten die Verbreitung marktbasierter Ansätze zum Tropenwaldschutz und deren Fortbestehen trotz unzureichender Ergebnisse, menschenrechtlicher Bedenken und Widerstand durch die Zivilgesellschaft erklären. Die genauen Mechanismen und deren Auswirkungen in Brasilien werden in diesem Buch analysiert. »Finanzialisierung« bedeutet die Schaffung neuer Anlageklassen und staatlicher Institutionen zu deren Sicherung. Die private Finanzierung von Klimamaßnahmen in Entwicklungsländern ist trotz vieler Win‐win‐Versprechen unzureichend. Laut Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) der 37 reichsten Volkswirtschaften hat der Privatsektor lediglich 14,4 Mrd. US‑Dollar für Klimamaßnahmen in Entwicklungsländern beigetragen.13 Welche Rolle spielt die öffentliche Klimafinanzierung der Industriestaaten dabei, diese grünen Märkte zu fördern, und was sind ihre lokalen Wirkungen? Dieses Buch konzentriert sich auf die Schaffung dieser institutionellen und politischen »Umwelt«, bzw. der Rahmenbedingungen, durch strategische Pilotinitiativen in Brasilien.
Die unsichtbare Hand der Umwelthilfe
Die Umwelt‐ und Klimafinanzierung ist ebenso neutral wie die Entwicklungszusammenarbeit, und kritische Autor:innen wie Arturo Escobar und der verstorbene Samir Amin argumentieren, dass Letztere eben gar nicht neutral ist, sondern mitschuldig an der Aufrechterhaltung global ungleicher Entwicklung.14 Der »Entwicklungsapparat«, bestehend aus Geberorganisationen und NGOs, versucht, die negativen Kosten des globalen Kapitalismus, der Ausbeutung der Natur und der ungleichen Entwicklung zu lindern, und vertieft sie gleichzeitig, beharrend auf dem Mantra des Wirtschaftswachstums.15 Wenn die Klimafinanzierung die Muster und Risiken dieses globalen, ökologisch ungleichen Austauschs widerspiegelt, hat dies bisher unberücksichtigte, aber wesentliche Auswirkungen auf ihre Wirksamkeit und die Klimagerechtigkeit. Was sind die Strategien des »Klimaapparats«, wie ich den neuen alten Komplex von Organisationen und Akteuren bezeichne?
Die Analyse stützt sich auf Ansätze der politischen Ökonomie, der Entwicklungsstudien und der Staatstheorie.16 In Anlehnung an Nicos Poulantzas ist der Staat weder ein autonomer Akteur mit seinen bürokratischen Interessen noch ausführendes Organ im Dienste von Eliteninteressen, sondern ein strategisches Feld, in dem sich gesellschaftliche Klassenbeziehungen verdichten.17 Staatliche Institutionen und Projekte sind keine neutralen Gebilde, sondern strategische Strukturen, die einige Akteure oder Akteursgruppen gegenüber anderen privilegieren und gesellschaftliche Konflikte verwalten und stabilisieren.
Auf der Grundlage dieses allgemeinen Verständnisses von staatlichem strategischen Handeln werden in diesem Buch Maßnahmen zur Kontrolle knapper Ressourcen des Globalen Südens sowie deren Einbindung in globale Märkte und umweltpolitische Maßnahmen untersucht. Die wirtschaftliche Expansion beruht aus kritischer Perspektive auf der ständigen staatlich geförderten Konsolidierung von Privateigentum und der Erschließung neuer Räume und Märkte im Globalen Süden.18 Brand und Wissen argumentieren, dass »unter kapitalistischen Bedingungen Knappheiten und damit zusammenhängende Probleme durch eine Mischung aus Beherrschung sowie räumlicher und vorübergehender Externalisierung bewältigt werden können«. 19 In diesem Zusammenhang betrachtet diese Studie zwei strategische Dimensionen und Funktionen der internationalen Zusammenarbeit. Erstens reguliert sie das staatliche Handeln zwischen verschiedenen Ländern über die Regierungsebene hinaus sowie wirtschaftliche und ökologische Krisen durch Externalisierung, insbesondere durch die Förderung von Emissionsmärkten, Geoengineering und die Übertragung der Lasten von Emissionsminderungen auf bestimmte Gruppen und Regionen. Zweitens errichtet die internationale Zusammenarbeit Institutionen und Technologien, die sich direkt auf soziale Beziehungen und Zugang zu Land und natürlichen Ressourcen auswirken. Kritische Entwicklungstheoretiker schreiben den verschiedenen Entwicklungshilfeagenturen eine solche konstitutive Dimension zu. Arturo Escobar betont beispielsweise die Produktion von Wissen und Praktiken, insbesondere von kolonialen Diskursen und Kontrolle über die »Kunden« der Entwicklungshilfe, z. B. Frauen, Bauern und die Umwelt.20
Ich verwende den Begriff des Klimaapparats, um diese konstitutive Dimension zu beschreiben, und verbinde damit insbesondere die gängigen Konzepte des Staatsapparats und des Entwicklungsapparats. Der Apparat – im Gegensatz zu dem gängigen Begriff der Assemblage – ist ein Netzwerk verschiedener Elemente, das in Bezug auf die historischen Machtverhältnisse und Verhaltensweisen bestimmter Subjekte strategisch wirkt.21 In Anlehnung an den Foucaultschen Begriff des Dispositivs umfasst der Apparat eine heterogene Reihe von Diskursen, Gesetzen, Paradigmen und Politiken.22 Er ist innerhalb spezifischer historischer Machtverhältnisse angesiedelt und strategisch auf die Verhaltensweisen bestimmter Subjekte ausgerichtet. Wie polymorph und multifunktional sie auch sein mögen, die institutionellen Arrangements des kapitalistischen Staates konvergieren oft zu bestimmten Strategien und Projekten. Staatliches Handeln (re)produziert emergente Strukturen, die bestimmte Ereignisse wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher machen.23 In diesem Buch wird untersucht, inwieweit der Klimaapparat hegemoniale Positionen, Allianzen, Ansätze und Diskurse in Bezug auf den Regenwaldschutz durch komplexe, unvollständige, umstrittene und nichtlineare Strategien vorantreibt.24
Wie funktioniert die Einflussnahme auf lokale Machtgefüge und Waldpolitik? Diese Mechanismen betreffen Wissen, Macht und territoriale Kontrolle.25 Während Antonio Gramsci die Bedeutung des Diskurses, der Ideologie und der Rolle der Intellektuellen bei der Stabilisierung der Machtverhältnisse, d. h. bei der Sicherung der Hegemonie der Kapitalistenklasse, betont, beschreibt Michel Foucault mit dem Begriff Gouvernementalität eine dezentrierte und »positive« Macht und Selbstregierung, zum Beispiel durch moralische Normen.26 Arun Argawals Konzept der »Environmentality« beschreibt in Anlehnung an Foucault Machtdynamiken in der Gestaltung von Wissen, Institutionen, Politik und sogar Subjektivitäten von Menschen in der Umweltregulierung.27 Diese Studie geht ebenfalls vom Wirken beider Dimensionen von Macht auf verschiedenen Ebenen aus und konzentriert sich auf die Strategien und Einflussnahme mächtiger Akteure bei der Gestaltung von Umweltmaßnahmen im Laufe der Zeit – wie etwa Politiken und Technologien, die den ländlichen Antagonismus durch Multi‐Stakeholder‐Politik entschärfen, marktorientierte zivilgesellschaftliche Gruppen fördern und aufbauen oder Anreize für einige Akteure schaffen und andere ausschließen oder disziplinieren. Einflussnahme hat dabei viele Gesichter und Spielstätten jenseits des Zwangs, einschließlich der Entscheidungsfindung, dem Agenda‐Setting, dem Unterdrücken von Entscheidungen, dem diskursiven Framing von Umweltproblemen und Lösungen sowie der Natur selbst, der Wissensproduktion, der Kuratierung von Partizipation sowie der Unterdrückung von alternativen Strategien und Ansätzen.28 Durch diese, so Gramsci, »hört die Wirtschaftsstruktur auf, eine externe, einschränkende Kraft zu sein, und wird zu einer Quelle der Initiative und der subjektiven Freiheit«.29
Während kritische Studien über den Entwicklungsapparat das antagonistische Verhältnis zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern hervorheben, deutet die internationale Zusammenarbeit im Umweltbereich – insbesondere zwischen Ländern des Globalen Nordens und Schwellenländern wie Brasilien – auf neue Konstellationen zwischen Zentrum und Peripherie hin, wobei der Rohstoffhandel und die Kommodifizierung von Ökosystemdienstleistungen eine zentrale Rolle spielen.30 Die Analyse stützt sich auf lateinamerikanische Konzepte wie den (Neo‑)Extraktivismus und Maristella Svampas Begriff des Rohstoffkonsenses.31 Diese beschreiben die neue wirtschaftliche und politisch‐ideologische Ordnung in Lateinamerika und dem Globalen Süden, die durch den Boom der internationalen Rohstoffpreise und die Nachfrage der zentralen Länder und aufstrebenden Mächte, insbesondere Chinas, gestützt wird. Das neo‐extraktivistische Entwicklungsmodell führt in globalen Peripherien zu Wirtschaftswachstum und neuen Ungleichheiten, sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und politisch‐kulturellen Konflikten sowie Krisen der Demokratisierung.32 Der grüne Extraktivismus von Mineralstoffen zur Dekarbonisierung (z. B. Lithium und Gold) sowie die von Ländern wie Brasilien vorangetriebene Bioökonomie, die auf den Handel mit Ökosystemdienstleistungen und Biotechnologien abzielt, drohen, diese Dynamik zu wiederholen.
Die vorliegende Analyse untersucht ebenfalls, inwieweit die Strategien der internationalen Zusammenarbeit für den Regenwaldschutz den Widerspruch zwischen »grünem« Extraktivismus und der Ausweitung der Bürgerrechte und der Umweltpolitik widerspiegeln, abschwächen oder verstärken. In dieser neuen strategischen Beziehung für das Klima erscheinen die Industrieländer womöglich weniger antagonistisch, obwohl sie weiterhin ihren Einfluss als Vermittler und Gatekeeper nutzen, um Institutionen im Ausland zu kontrollieren und zu durchdringen.33
Eine Fallstudie von Umweltinitiativen im Amazonasgebiet
Im Folgenden analysiere ich die Entwicklung von Initiativen der Industrieländer zur Erhaltung der brasilianischen Regenwälder seit Ende der 1980er‐Jahre.34 Die komplexe Fallforschung betrachtet Zusammenhänge und Pfadabhängigkeit zwischen Faktoren, Prozessen, Personen, Institutionen und Diskursen. Die Studie zielt nicht auf eine detaillierte, vollständige Darstellung ab, sondern nutzt qualitative Techniken, um Muster zu untersuchen, Macht und Einfluss bei der Entscheidungsfindung zu identifizieren und die Schnittpunkte internationaler, bilateraler und lokaler politischer Ökonomien zu untersuchen. Es wird insbesondere untersucht, 1) welche Ansätze internationale Initiativen verfolgen, 2) woher Konzepte und Politiken kommen und wer sie entwirft und weiterführt, 3) inwieweit diese Ideen in lokale politische Debatten einfließen, 4) wie Diskurse und Technologien die Organisation von Raum und Zugang gestalten, 5) in welcher Beziehung sie mit lokalen Machtungleichheiten stehen und 6) inwieweit Hilfsprojekte sozial‐ökologische Phänomene in die Logik des Finanz‐ und Wirtschaftssystems übersetzen.
Kein Land ist in der umstrittenen globalen politischen Ökonomie naturbasierter Lösungen ein so bedeutsamer strategischer Akteur wie Brasilien. Seine Artenvielfalt, Biome und Kohlenstoffsenken sind entscheidend für das Klima der Erde.35 In diesem Sinne ist eine Fallstudie zu den Initiativen im brasilianischen Amazonasgebiet außerordentlich relevant. Brasilien ist ein Beispiel für die Widersprüche zwischen postkolonialer Entwicklung und Umwelt – mit einer der höchsten Raten an sozialer Ungleichheit und anhaltender Landkonzentration. Das Land ist der weltweit führende Exporteur von Soja und gilt als Kornkammer der Welt, taucht aber andererseits auf der Karte der globalen Ernährungsunsicherheit auf.36 Die EU importiert den – nach China – zweitgrößten Anteil des Soja‐ und Palmöls, das die Abholzung im Amazonasgebiet verursacht. Der brasilianische Fall steht somit exemplarisch für die widersprüchlichen strategischen Partnerschaften zwischen nördlichen und Schwellenländern, wobei erstere versuchen, ihr Netto‐Null‐Ziel zu erreichen, sowie gleichzeitig das Wirtschaftswachstum und den hohen Lebensstandard ihrer Gesellschaften aufrechtzuerhalten und den internationalen Handel zu intensivieren.37
Seit der UN‑Konferenz für Wirtschaft und Entwicklung im Jahr 1992 in Rio de Janeiro ist das brasilianische Amazonasgebiet ein strategisches Ziel für Klimafinanzierung und ‑politik. Die historische COP30 in Belém, Pará, und der G20‐Prozess in Brasilien im Jahr 2025 zeigen die globale politische Bedeutung des Regenwalds. Der Amazonas ist ein Labor für zahlreiche Initiativen, die Länder wie Deutschland und das Vereinigte Königreich in anderen Tropenwaldländern zu reproduzieren versuchten. Obwohl viele Geber die Eignung Brasiliens als Empfänger von Entwicklungshilfe seit den 1990er‐Jahren überdacht haben, ist das Land aufgrund seiner geostrategischen Bedeutung ein Hauptempfänger von Klima‐ und REDD±Finanzierungen.38 Die Analyse betrachtet zwei zentrale »Pilotinitiativen« zum Testen neuer Formen der Umweltfinanzierung im Zeitraum von 1989 bis zum Jahr 2024: das Pilotprogramm der G7 zur Erhaltung des brasilianischen Amazonasgebiets (PPG7, 1990–2009) und den Amazonienfonds als ersten nationalen REDD±Fonds (2008 gegründet). Diese Pilotprogramme wurden von führenden Umweltstaaten sowie der Weltbank gefördert: Deutschland, Norwegen und das Vereinigte Königreich. Auch wenn die G7 andere Finanziers wie Japan und die Niederlande einbezogen haben, widmet sich die Analyse nicht deren äußerst geringen Beiträgen.
Die Studie stützt sich auf interviewbasierte, archivarische und ethnografische Feldforschung zwischen 2017 und 2024. Von 2018 bis 2023 lebte ich in Belém, Pará, und arbeitete als Gastforscherin an der Bundesuniversität von Pará. Von 2021 bis 2022 arbeitete ich außerdem als reguläre Vollzeitangestellte für die Stadtverwaltung von Belém. Ich habe diese Forschung in Brasilien (ein Jahr lang reiste ich zwischen Brasília, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís, Belém), Deutschland (Berlin, Bonn, Frankfurt), Großbritannien (London), den USA (New York und Providence) und auf der COP24 in Wrocław, Polen (2018), auf der COP25 in Madrid, Spanien (2019), sowie der COP26 in Glasgow, Vereinigtes Königreich (2021), durchgeführt.
Für dieses Buch habe ich 165 qualitative Interviews auf Portugiesisch, Englisch und Deutsch geführt, um die historischen Ereignisse zu verstehen und zu rekonstruieren. Ich befragte aktuelle und ehemalige Vertreter deutscher, britischer, norwegischer und internationaler Agenturen (z. B. der Weltbank), brasilianische Umweltverwalter auf Bundes‐ und Landesebene, Politiker, Diplomaten, Berater, Forstingenieure, Forscher, Umweltanalysten, Anwälte, Nichtregierungsorganisationen und sozio‐ökologische Graswurzelgruppen. Ich wählte und rekrutierte die Interviewpartner nach dem Kriterium der ausgewogenen Repräsentation verschiedener Akteursgruppen in den Fallinitiativen. Ich habe die Interviewpartner durch die Schneeballmethode (durch die Frage, ob die Befragten einen anderen Kontakt empfehlen würden) und durch Recherchen in Projektdokumenten, Gästelisten von Sitzungen, Artikeln und Berichten usw. ermittelt. Durch diese Empfehlungen und Kontakte zeigten sich Allianzen, gemeinsame bzw. gegensätzliche Positionen in Bezug auf bestimmte Themen wie Emissionsmärkte. Ich befragte die Personen zur Bedeutung der Umweltfinanzierung, des Pilotprogramms der G7 zur Erhaltung der brasilianischen Regenwälder (PPG7) und forderte sie auf, das PPG7 mit dem Amazonienfonds zu vergleichen. Ich wollte wissen, was ihrer Ansicht nach an diesen Pilotprogrammen hinsichtlich der Ideen, Aktivitäten und Maßnahmen neu war und lokalen Einfluss hatte. Außerdem erkundigte ich mich nach Ereignissen, Bündnissen, Konflikten und spezifischen Entscheidungen und deren Gründen. Mit diesen Fragen sammelte ich Informationen über ideologische Unterschiede und über die Form, wie staatliche Akteure bestimmte Ideen, Technologien und Verbündete strategisch förderten.
Darüber hinaus führte ich teilnehmende Beobachtungen bei Workshops, Seminaren und Veranstaltungen durch, um mein Verständnis für die Machtdynamiken, Einstellungen, Strategien und Anliegen der verschiedenen Akteure bei ihrer Interaktion zu vertiefen.39 So etwa bei zivilgesellschaftlichen Konsultationen für Brasiliens REDD±Schutzmaßnahmen und Planungsworkshops für das Amazonas‐Schutzgebietsprogramm (ARPA) in Brasília, Strategietreffen und Veranstaltungen während der internationalen Klimakonferenzen (COP) sowie regionalen und nationalen Treffen der Nationalen Vereinigung für Agrarökologie (ANA), etwa in Abaetetuba, Pará. Ich arbeitete mit FASE Amazônia zusammen, einer der ältesten NGOs Brasiliens. Außerdem nahm ich an verschiedenen Kampagnen mit lokalen Erzeugerverbänden teil und organisierte Veranstaltungen auf dem Panamazonischen Sozialforum (FOSPA) 2020. Dieses Buch stützt sich auf meine Erfahrungen als Projektmanagerin für die Vereinten Nationen und den Globalen Süden und Verantwortliche für Planung, Monitoring und Evaluierung bei der durch das Bundesentwicklungsministerium geförderten Rosa‐Luxemburg‐Stiftung in New York (2012–2016), einer der deutschen politischen Stiftungen.
Darüber hinaus sammelte ich Projektdokumente aus privaten und öffentlichen Archiven (brasilianisches Außenministerium in Brasília, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn). Ich habe Tausende von Seiten aus Diplomatendepeschen, Veröffentlichungen in kleiner Auflage, Sitzungsunterlagen, Teilnehmerlisten, Zeitungsartikeln, Briefen und anderen Dokumenten gescannt. Diese Dokumente dienten der Vorbereitung von Interviews, der Überprüfung von Aussagen aus Interviews und der Identifizierung von Übereinstimmungen und Unterschieden zwischen offiziellen und inoffiziellen Äußerungen.
Die Interviewtranskripte, ethnografischen Aufzeichnungen und Archivdokumente wurden mit der qualitativen Datenanalysesoftware NVivo und Atlas.ti analysiert. Zunächst wurden markante Themen identifiziert, anschließend unterschiedliche Positionen von Akteursgruppen und ihre Entwicklung im Laufe der Zeit. So verfolgte ich zum Beispiel die Entstehung des Diskurses über Schulden, naturbasierte Lösungen, Zahlungen für Umweltleistungen und Kohlenstoffsequestrierung in offiziellen Dokumenten. Diese Ergebnisse habe ich mit Interviewaussagen über dieselbe Zeit und die gleichen Themen verglichen. Zweitens wurden im Rahmen der Analyse Zeitleisten erstellt und Veränderungen (wie die Wahl des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva von der Arbeiterpartei), Kontinuitäten, Wirkungen und Muster (wie Investitionen in Überwachungstechnologien) ermittelt.
In den Jahren 2018 und 2019 sammelte ich die meisten Interviewdaten, und von 2018 bis 2023 war ich in Belém, Pará, ansässig. In diesem Zeitraum habe ich die meisten kritischen analytischen Erkenntnisse gewonnen, da ich mich während der COVID‑19‐Pandemie und des Bolsonaro‐Regimes in Belém aufhielt. Während dieser Zeit ist die Umweltpolitik in Brasilien noch kontroverser geworden, insbesondere die internationale Zusammenarbeit für den Naturschutz und den Amazonienfonds. Obwohl meine Gesprächspartner der Veröffentlichung ihrer offiziellen Interviews mit Kennzeichnung zugestimmt haben, habe ich beschlossen, ihre Namen vertraulich zu behandeln. Angesichts der sensiblen Natur des umstrittenen Themas, der Gewalt gegen und der Kriminalisierung von Aktivisten sozialer Bewegungen sowie der Bedrohung von Umwelt‐ und Oppositionsaktivisten werden alle Interviewpartner durch ihre allgemeine Position und nicht durch ihren Namen identifiziert, um sie nicht in Gefahr zu bringen.
Der Aufbau dieses Buchs
Im Folgenden untersuchen die einzelnen Kapitel bestimmte Einflussbereiche internationaler Umweltprojekte. Das erste Kapitel skizziert die theoretischen Konzepte des modernen »grünen« Staats und der ökologischen Modernisierung, die der Umwelthilfe und der Klimafinanzierung zugrunde liegen. Es werden die Fälle der Umweltstaaten Deutschland, Großbritannien, Norwegen und Brasilien betrachtet. Daraus ergibt sich folgende Frage für die nächsten Kapitel: Wie sind konkrete Kooperationsprojekte mit diesem Widerspruch in Bezug auf Landnutzung und Entwaldung umgegangen? In Kapitel 2 wird analysiert, wie die Umwelthilfe Ende der 1980er‐Jahre im Kontext der Verschuldung des Globalen Südens entstand und wie sie sich bis hin zur heutigen Klimafinanzierung entwickelt hat. Dabei wird auch untersucht, inwieweit Finanzialisierungsprozesse die Rolle des Emissionspeichers Amazoniens und die Kooperation in Brasilien verändert haben. In Kapitel 3 wird untersucht, welchen Einfluss die internationalen Umwelthilfen seit den 1990er‐Jahren auf die bundesstaatliche Umweltpolitik und Regulierung von Landnutzung in Brasilien hatten und inwieweit die Zusammenarbeit mit dem Agrarsektor das Greenwashing von Entwaldung begünstigt. Kapitel 4 analysiert, welchen Einfluss die internationalen Interventionen auf die umstrittene Politik der Demarkierung indigener Territorien und Schutzgebiete im brasilianischen Amazonasgebiet hatten und wie sie mit lokalen gewaltsamen Konflikten umgehen. In Kapitel 5 wird das Verhältnis der Akteure internationaler Zusammenarbeit zu kleinen ländlichen Erzeugergemeinschaften und ‑vereinigungen beleuchtet. Dieses Kapitel betrachtet die Förderung von Zahlungen für Umweltleistungen und die Kritik, die organisierte Bewegungen traditioneller Kleinproduzenten im brasilianischen Amazonasgebiet in den letzten Jahrzehnten daran übten.
Der Epilog diskutiert die Erkenntnisse der Analyse für die Umweltwissenschaften und für Debatten über Klimafinanzierung und Klimagerechtigkeit. Dabei kehre ich zu den allgemeinen Fragen zurück, die in diesem Buch gestellt werden. Was sind die politischen Ökonomien, die die Nord‐Süd‐Klimafinanzierung für Wälder vorantreiben? Wie beeinflusst die Förderung naturbasierter Lösungen die Waldpolitik und lokale Machtgefüge? Ich schlage Antworten auf diese Fragen vor sowie Alternativen für eine gerechte Finanzierung des globalen Umweltschutzes.
Kapitel 1Grüne Staaten und globaler Extraktivismus
Die jährlichen Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen (Conference of the Parties, COP) sind ein einzigartiges Spektakel. In den zwei Wochen am Ende eines jeden Jahres erlebt man politische Reden und Entscheidungen von globaler Bedeutung, aber auch ermüdende Sitzungsmarathons über technische Details und angespannte Delegationsmitglieder, die sich zwischen Meetings durch überfüllte Gänge drängen. In den letzten Jahren haben Unternehmen aus der Energiewirtschaft, der Agrarindustrie, dem Finanzwesen und der IT‑Branche immer stärkeren Einfluss auf die Konferenzen gewonnen. Vertreter fossiler Brennstoffe und transnationaler Unternehmen, die teilweise sogar offiziellen Delegationen angehören, spielen hier eine wachsende Rolle. Die Konferenzen fanden in den letzten Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Aserbaidschan statt, wo repressive Regime die Zivilgesellschaft kontrollieren. Inmitten dieses Klimas der Kooptation, Repression und Negierung der Klimakrise ist es faszinierend, die Präsentationen der Mitgliedsländer in ihrem jeweiligen Pavillon in der sogenannten blauen Zone der COPs zu verfolgen. Für die Regierungen ist dies der zentrale Anlass, um ihre Klimafinanzierungsinitiativen vorzustellen, illustrierte Projektbeschreibungen und Handreichungen auszuteilen, ein eigenes kuratiertes Veranstaltungsprogramm mit Expertenpanels zu Klimalösungen zusammenzustellen und Akteure aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik zusammenzubringen. Während es in den Verhandlungen frustrierend technisch zugeht, dreht sich in der Pavillonzone alles um Zusammenarbeit, Wissensaustausch, technische Innovation und Erfolgsgeschichten. Die teuren Pavillons spiegeln auch den Reichtum und die strategische Dominanz der Länder bei den Klimaverhandlungen wider. Reiche Länder wie Deutschland oder Frankreich bieten frischen, fair gehandelten Espresso, Snacks und bequeme Sofas an, während die Stände einiger Länder fast improvisiert wirken. Was zeigen diese performativen Räume und was verbergen sie?
Deutschland
Groß‐britannien
Norwegen
Brasilien
Bevölkerung (Millionen)
83,13
67,33
5,41
213,99
BIP pro Kopf (US‐Dollar)
46.252,69
41.098,08
67.329,68
6.814,88
Gesamte Emissionen (Mt CO2e)
681,18
411,12
31,33
1.469,64
Platz / globaler Anteil
13. Platz/globaler Anteil von 1,39 %
23. Platz/globaler Anteil von 0,83 %
109. Platz/globaler Anteil von 0,07 %
6. Platz/globaler Anteil von 3,07 %
Emissionen pro Kopf (tCO2e/Person)
Bevölkerung (Millionen)
8,19
6,13
5,82
6,91
Emissionen pro BIP (tCO2e/Millionen US‑Dollar BIP)
177,09
149,13
86,51
1.014,55
Kumulierte Kohlendioxid‐Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe von 1850 bis 2022 in Milliarden tCO2
93,1
78,8
keine Daten
16
Climate vulnerability index (ND‐GAIN)
0,29
0,28
0,26
0,37
Tabelle 1 Klimadaten für Deutschland, Großbritannien, Norwegen und Brasilien Quelle: www.climatewatchdata.org; Global Carbon Project; https://www.carbonbrief.org/
Theoretisch gibt es ein sogenanntes Kohärenzgebot, wonach alle Politiken im Sinne der globalen nachhaltigen Entwicklungsziele gestaltet werden sollen, anstatt diese zu behindern. Obwohl das Prinzip vielfach verankert ist, beispielsweise im EU‑Vertrag, weisen EU‑Agrarsubventionen, Waffenexporte oder die Rohstoffpolitik auf erhebliche Inkonsistenz in Bezug auf Klimaziele und Menschenrechtsförderung hin. Dieses Kapitel untersucht vor diesem Hintergrund die Umwelthilfe sogenannter »grüner« Staaten und die zugrunde liegende Idee der ökologischen Modernisierung vor dem Hintergrund neoliberaler Globalisierung. Am Beispiel Deutschlands, Großbritanniens und Norwegens und ihrer strategischen Finanzierung von Waldschutz in Brasilien skizziert es die Struktur, die Widersprüche und die Machtverhältnisse der Entwicklungszusammenarbeit (EZ), in die die Klimafinanzierung eingebettet ist.
Grüne Staaten und Globale Ungleichheiten
Um die Jahrhundertwende entwickelte sich eine Debatte über »grüne« Staaten wie Deutschland, Norwegen und Großbritannien, in denen sich zivilgesellschaftliche Umweltbewegungen und die Regulierung von Umweltrisiken als staatliche Verantwortung etablierten.40 Die meisten »grünen« Ansätze beruhen auf der Idee der ökologischen Modernisierung, der Auffassung, dass sich ökologische Probleme innerhalb bestehender Institutionen lösen lassen und Wirtschaftsstrukturen nicht grundlegend transformiert werden müssen.41 Zu typischen Umweltreformen gehört die Gründung von Regulierungsbehörden, Umweltministerien, Naturschutzgebieten und Verfahren wie Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie die Einführung von Emissionsstandards.42 Darüber hinaus soll die Erhaltung der Natur durch die Privatisierung, Finanzialisierung und Vermarktung von Ökosystemleistungen neue wirtschaftliche Möglichkeiten schaffen.43
Staatliche Umweltfinanzierung in Entwicklungsländern gilt in diesem Sinne als wohlwollende Politik von »grünen« Staaten, für die Verbreitung von modernen Umweltnormen und ‑institutionen aus den Industrieländern in Richtung Entwicklungsländer. Diese »soft power« zum Schutz globaler Güter wird der »harten« geostrategischen Macht entgegengestellt.44 Umweltschäden werden, wie im nächsten Kapitel beschrieben, oft auf rückständige Politik und Armut in Entwicklungs‐ und Schwellenländern zurückgeführt, während neoliberale Globalisierung nicht als Problem, sondern als Lösung gilt.45 Staatliche Entwicklungsorganisationen des Globalen Nordens – die als externer, rationaler und progressiver Faktor dargestellt werden – gelten aus liberaler Perspektive ausschließlich als Verbündete ökologischer Aktivist:innen in Ländern des Globalen Südens.46
2019/20 Durchschnitt
2021/22
Insgesamt
632
1.265
Privat
310
625
Kommerzielle Finanzinstitute
122
235
Gesellschaft
124
192,2
Mittel
5
6,2
Haushalte/Einzelpersonen
55
184,5
Institutionelle Anleger
3
6,3
Staatlich
321
640
Bilaterale Entwicklungsinstitutionen
35
32,6
Exportkreditagentur
1
1,8
Regierung
38
99,6
Multilaterale Klimafonds
4
2,9
Multilaterale Entwicklungsinstitutionen
65
93,1
Nationale Entwicklungsinstitutionen
120
238,4
Staatliche Fonds
2
0,2
Staatseigene Einrichtungen
13
110,3
Staatliche Finanzinstitute
45
60,9
Tabelle 2 Aufschlüsselung der globalen Klimafinanzierung nach staatlichen und privaten Akteuren (in Mrd. US‑Dollar) Quelle: Initiative Klimapolitik. Globale Landschaft der Klimafinanzierung 2021; 2023
Die Nord‐Süd‐Kooperation für Umwelt und Entwicklung ist von anhaltenden Ungleichheiten geprägt, die im Hintergrund grüner Reformen stehen. Der Entwicklungshilfeausschuss der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD‐DAC) vertritt die Interessen der wichtigsten sogenannten Geberländer der Welt (aktuell 32 Mitglieder) in Fragen der Armut, der Umwelt und der Entwicklung im Globalen Süden. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) – die 1946 gegründeten internationalen Finanzinstitutionen (IFI) – arbeiten für die Stabilisierung des globalen Währungssystems und die Ausweitung des Welthandels. Sie überwachen und beeinflussen wirtschaftliche Entwicklungen und Maßnahmen weltweit. Ihre Steuerung wird von den reichsten Ländern dominiert und geprägt. Nur einige Mitgliedsländer – die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Japan und China – werden von ihrem jeweiligen Exekutivdirektor vertreten. Alle anderen Mitglieder sind in Stimmrechtsgruppen zusammengefasst. Dies bedeutet, dass die IFI in erster Linie gegenüber ihren Geldgebern und nicht gegenüber ihren »Kunden«, den Ländern, in denen die Projekte durchgeführt werden, rechenschaftspflichtig sind. Da die Klimafinanzierung projektbezogen und nicht bedingungslos oder bedarfsorientiert ist, knüpfen reiche Länder sie an Konditionen und bewahren die Kontrolle über deren Umsetzung.
Die Klimafinanzierung ist außerdem in die Geschichte und die Bedingungen der Kreditvergabe und Umschuldung des IWF eingebettet. In den 1980er‐ und 1990er‐Jahren führte der IWF 196 bzw. 346 Strukturanpassungsprogramme in 64 bzw. 98 Ländern durch – vorgeschriebene Reformen zur Wirtschaftsliberalisierung, einschließlich Haushaltskürzungen, Handelsliberalisierung, Privatisierung von Staatsvermögen und Unternehmen sowie die Gewährleistung und Ausweitung von Eigentumsrechten.47 Die Flexibilisierung der Arbeits‐ und Umweltvorschriften sollte zusammen mit der Haushaltsdisziplin ausländische Investitionen anziehen und Exporte ankurbeln, was auch geschah. Doch obwohl Wirtschaftswachstum die Armut als angebliche Ursache der Umweltzerstörung verringern sollte, führten die Strukturanpassungsprogramme zu steigender Armut und Entwaldung, insbesondere durch die Umstrukturierung der ländlichen Wirtschaft zur Steigerung der Einnahmen aus Agrar‐ und Primärgüterexporten.48
Dieser Widerspruch steht im Zentrum der Umwelthilfe der 1990er‐Jahre und ihrem Motto der »nachhaltigen Entwicklung«. Als Reaktion auf die ihrer Meinung nach unzureichenden strukturellen Anpassungen förderten die internationalen EZ‑Organisationen »good governance« im Globalen Süden. Ausgehend von einem ähnlichen kulturellen Determinismus früherer Modernisierungsansätze argumentierten US‑Ökonomen wie Douglas North und Jeffrey Sachs, dass der Erfolg der sogenannten kapitalistischen Kerninstitutionen von kulturellen Rahmenbedingungen abhängt, die angeglichen werden müssten.49 Strukturell behielt die EZ in den späten 1990er‐ und 2000er‐Jahren dieselbe Geld‐ und Handelspolitik bei, wobei Kapazitätsentwicklungsmaßnahmen für Multi‐Stakeholder‐Governance, Umweltschutz und Armutsbekämpfung die externe Überwachung und Einmischung in die Verwaltung der Empfängerländer sogar noch vertieften.50 Gleichzeitig hat der Ansatz der »Strukturanpassung mit menschlichem Antlitz« den Aufstieg einer kuratierten Zivilgesellschaft – zunehmend professionelle und marktorientierte Interessengruppen als Entwicklungsagenten in partizipatorischen und »Empowerment«‐Projekten – gefördert.51 Die folgenden Kapitel untersuchen diese Formen der Einbindung der Zivilgesellschaft am Beispiel der Amazonashilfe in Brasilien.





























