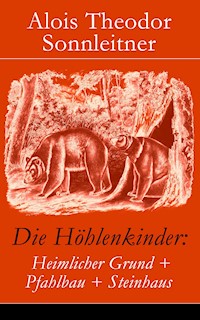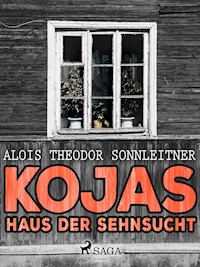Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Kajetan Lorent, genannt Koja, ist neun Jahre alt, als das Schicksal seine Familie abermals trifft. Dabei hat er schon genügend eigene Probleme: Er hat der Sattler-Roserl den Zopf ins Tintenfass gesteckt und dem Eckel-Poldi, der ihn verspottet hat, die Geige über den Kopf geschlagen, so dass sie zerbrochen ist, und er weiß, wenn sein Vater von diesen Schandtaten erfährt, wird er Koja schwer züchtigen. Wieder kommt der Vater betrunken nach Hause, und nachts wird Koja Zeuge eines Streits der Eltern, bei dem die ältere Schwester Agi dazwischengeht. Am nächsten Morgen erfährt er von Agi endlich den Grund, warum Mutter jeden Tag ein verheultes Gesicht hat: Der Vater hat durch schlechtes Wirtschaften, Trinken und Spielen die Mühle mit so hohen Schulden belastet, dass das Gericht ihren Besitz nun verkaufen lässt. Erneut muss die Familie Lorent ihr Heim verlassen. Sie ziehen ins Prokop-Haus, wo sie sich mühsam eine neue Existenz aufbauen. Hühner und eine Mutterziege machen den Anfang. Der Leser begleitet Koja in seinem neuen Leben durch zahlreiche Abenteuer und Entwicklungsstationen hindurch. Koja befreundet sich mit Kater Dummerl, lernt, seine Angst vor der Dunkelheit zu überwinden und überhaupt das Fürchten zu verlernen, spielt Robinson im Eisenbahngraben, wird Waldläufer und beginnt schließlich zu studieren und Handel zu treiben. "Kojas Waldläuferzeit" eröffnet dem Leser einen bildreichen Einblick in das abenteuerliche Leben der Kinder einfacher Leute in der Zeit gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Der Band bildet zusammen mit dem Vorgängerband "Kojas Wanderjahre" und dem Nachfolger "Kojas Haus der Sehnsucht" Sonnleitners berühmte Koja-Trilogie, in der der Autor, stark autobiografisch gefärbt, die Kämpfe seiner Hauptfigur und seiner Familie beschreibt, bis "Koja" schließlich ein erfolgreicher Naturforscher und Autor wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alois Theodor Sonnleitner
Kojas Waldläuferzeit
Der Vorgeschichte zum„Haus der Sehnsucht“2. Teil
Mit Bildernvon Professor Fritz Jaeger
Dreizehnte Auflage
Saga
Kojas Waldläuferzeit
© 1923 Alois Theodor Sonnleitner
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711570043
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Baum und Mensch
Es steht ein Baum auf schroffer Höh,
Umkost von milder Lüfte Wehn.
Doch schau Dir’n an im Sturmgetös:
Du siehst ihn auch den Sturm bestehn.
Weil er von Keimlings Zeiten an Gerungen um den festen Stand,
Ward er ein Baum, der stark in sich —
Der Stürme Wüten überwand.
Ein freies Wesen ist der Mensch,
Nicht fest gewachsen in dem Grund,
Doch lichtwärts strebt er wie der Baum,
Den Halt in sich, zu jeder Stund.
Das rauhe Schicksal bringt ihm Sturm,
Die Liebe gibt ihm Sonnenschein;
So wächst er wie der tapfre Baum
Ins Leben stark und froh hinein.
Koja und Agi
In der Kleinen halbkreisförmigen Donaubucht, die oberhalb des Pöchlarner Römerturms ins Ufer greift, sass der neunjährige Kajetan Lorent in einer Zille,a) deren Kette festgebunden war am Uferpfahl. Er wartete auf seine Schwester Agathe, die aus der Strickschule kommen sollte.
Spielend trieb er das Boot mit leichten Ruderschlägen hin und her, soweit es die gespannte Kette zuliess. Seine blauen Augen glitten über das schwere lehmgelbe Stromwasser westwärts gegen Marbach zu, über dem von hoch oben die Wallfahrtskirche Maria-Taferl niedergrüsste. Der frische Märzwind fegte ihm das flachsfarbene Haar ins Gesicht; aber der kleine Kajetan merkte es nicht. Zeitfern träumte er von den Nibelungen, die auf der Fahrt ins Hunnenland nach der Meinung seines alten Oberlehrers Schönberger wohl in dieser Bucht angelegt hatten. — Hier mochte Rüdiger sie begrüsst haben. Der Knabe stellte sich die Nibelungen in Rüstung und Lederkoller vor, ihre Schiffe mit Eichenlaub umkränzt. Dann wieder erinnerte er sich, dass der Oberlehrer bald in den Ruhestand gehen wollte und erging sich in Mutmassungen, ob der Unterlehrer Pointner die Oberklasse übernehmen werde oder ein Fremder. Ein heller Ruf, der von der Höhe der Strasse kam, weckte ihn aus seinem Sinnen: „Koja! Kooja!“ — Da sprang er auf, fuhr mit den Armen in die Riemenschleifen seines kalbsfellenen Schulranzens, raffte den Geigenkasten vom Boden der Zille auf und sprang die Böschung hinan. — „Grüss dich Gott, Agi! —“b) — „Grüss dich Gott, Koja!“ — Und nun stapften sie Hand in Hand die Strasse stromaufwärts, der sinkenden Sonne nach. Vertrauensvoll begann der Bub von den Ereignissen seines Schultages zu berichten. Er war schon zufrieden, wenn ein Aufleuchten in Agis grauen Augen ihm verriet, dass sie ihm zuhörte, oder wenn der wechselnde Ausdruck ihres von dunkelblondem, glatt gescheitelten Haar umrahmten Gesichtes ihre Teilnahme zeigte. — Mit ihren schmalen, fest aufeinandergepressten Lippen und dem versonnenen Ausdruck ihres blassen Gesichtes war Agi kein Kind mehr, obwohl sie nur um zwei Jahre älter war als Koja. Der Bub erzählte nicht ungeschickt die äusseren und inneren Erlebnisse seines Tages, fast Stunde für Stunde. Als sie durch das Dorf Brunn auf den Weg gelangt waren, der querfelds nach der Neuda führt, war er gerade bei der Schönschreibstunde angelangt: „... Der Oberlehrer sitzt beim Tisch und schreibt aus der Partiturc) der neuen Schubert-Messe die Stimmen heraus, seine Gansfeder scharezt, und sonst ist es still. Der Busch-Edi geht von Bank zu Bank, malt da einem ein schönes B vor, dort einem ein K und passt auf, dass sich keiner rührt. — Ich schreib und schreib. Die Sattler-Roserl, die erst seit heuer in der Bubenklass’ ist, weil’s in der Klosterschul’ keine Ruh’ geben hat, sitzt vor mir und wetzt herum, wie wann’s d’Ameisen hecken täten; der dicke braune Zopf hängt ihr über die weisse Bluse. Auf einmal gibt’s dem Zopf einen Schupfer, da liegt er auf mein’ Heft. Sie dreht den Kopf hin und her, der Zopf verwischt mein Geschriebenes, als ob eins mit einem Besen drüber gefahren wär! I mucks’ mi nit. Aber den Zopf steck’ ich ihr in mein Tintenglasel bis zu der roten Maschen. Dann schieb ich’s Pult ’nauf und zwick’ den Zopf ein. Wie sie das g’spürt, macht sie mit dem Kopf einen Ruck nach vorn, und vom Zopfend’ rinnt ihr die Tinten über die weisse Jacken. Sie fasst mit der Hand den Zopf, die Tinten rieselt ihr in den Ärmel, da spreizt sie die schwarzen Finger weit auseinand und fahrt auf: ‚Bitt’! der Koja!‘ — Die ganze Klass’ lacht wie nit g’scheit; der Oberlehrer schiebt seine Brillen auf die Stirn, mit einem Satz ist er vom Katheder herunten und steht vor uns. Sein G’sicht wird rot, aber reden kann er nit. — Auf einmal packt er mi bei den Schultern, hebt mich aus der Bank und tragt mi bis in’ hintersten Winkel auf der linken Seit’, wo die alten verschnitzelten Bänk’ stehn. Dort setzt er mi nieder: ‚Da bleibst jetzt sitzen in der Eselbank — du — du!‘“— Mit angehaltenem Atem hat Agi zugehört. — Jetzt vertritt sie ihrem Bruder den Weg, dass er stehend hören muss: „Koja, ich bitt’ dich, erzähl’ der Mutter heute nix von dem. — Der Roserl bring ich meine neue weisse Bluse und mit dem Oberlehrer red’ ich gleich vor’m Hochamt morgen, dass er dem Vater nix sagt.“ Koja hatte Angst vor der unmenschlichen Art, in der ihn der Vater schon für harmlosere Streiche mit dem Leibriemen zu züchtigen pflegte, wenn er auch nur ein wenig übers Mass getrunken hatte. Meist glückte es dem Buben nicht, sich durch Ausreden oder Entstellungen der Tatsachen vor den väterlichen Hieben zu retten; und manchmal trugen ihm die Lügen, wenn der Vater nachträglich hinter den wahren Sachverhalt kam, eine neue Tracht Prügel ein. — Da war es wohl echte Dankbarkeit, in der Koja seine Augen zur Schwester emporhob, die in ihrer Vorsorge weiter auf ihn einsprach: „Ich will nicht haben, dass du vor dem Vater wimmerst und lügst und um Gnad’ bettelst, ich will nicht haben, dass die Mutter auch noch um dich Kummer hat. — Du weisst nit, was sie grad jetzt wieder druckt ... Du weisst nit, warum die Mutter bei Tag mit verweinten Augen herumgeht, du weisst nit, warum sie in der Nacht seufzt und bet’t, weil s’ nit schlafen kann.“ — „Du aber weisst es, Agi, und sagst mir nix?“ erwidert der Junge betroffen. — „Das wär’ nix für dich; frag mi nit!“ versetzte das Mädel; ihre Lippen schlossen sich fest und schmal.
Die Sonne ist hinter der Gollinger Höhe hinabgesunken. Die Kinder nähern sich durchs Wiesenland dem Erlafsteg. Schweigend geht nun Koja an der Hand Agis dahin. Er hat noch etwas zu beichten, aber er traut sich damit nicht heraus. Wie Tropfen blassen Goldes leuchten die geschlossenen Blüten der schaftlosen Primeln aus dem dämmerdunklen Grase, zwischen dem als lichtloses Band der Pfad in sanfter Krümmung zur Uferböschung ansteigt.
Die beiden gehen einzeln über den schmalen, schwingenden Brettersteg, an dessen keilförmig gegen die Strömung gerichteten Pfeilern die Scheiter des Schwemmholzes anprallen, eh’ sie, einander drängend und schiebend, sich vom schweren Wasser des geschwellten Flusses weitertragen lassen, hinunter zum Rechensteg. Agi ist längst am anderen Ufer angelangt. Koja aber steht noch inmitten des Steges; ans Geländer geklammert, schaut er der Strömung nach. — Er weiss, wo die Hölzer herkommen. Von den Hängen der Bergwälder an der Lassing und Erlaf. In der Klausen wird das Schmelzwasser der Firnfelder gestaut, ehe die Holzknechte die Hölzer zu Tal bringen. Koja vergisst Agis Sorge und der Mutter verweintes Gesicht, er stellt sich vor, wie ungeheuer wuchtig das Wildwasser mit den springenden, drängenden, splitternden Scheitern dahintost, wenn die Schleusen der Klausen geöffnet werden. Dort möcht’ er jetzt sein, dort wo die Tormäuer - Schlucht den Fuss des sagenhaften Ötschers säumt, des „Hetscherlbergs“, wo das Geldloch ist, die Taubenhöhle, die Eis- und Tropfsteingrotten, von denen der Lehrer Eggenberger in der Gaminger Schul’ erzählt hat, dort ... — „Koja! so komm’ doch,“ hallt es angstvoll herüber, das Rauschen des Wassers und Poltern des Schwemmholzes übertönend.
Da reisst sich der Träumer los vom Schauspiel der gischtenden und tragenden Wogen und eilt zur Schwester hinüber.
Fest umklammert Agis magere Hand seine Linke. Sie zieht ihn vorwärts durch die Dämmerung der Au auf frühlingsfeuchtem, tief ausgefahrenem Wege, an Pfützen vorbei, die kaum wahrnehmbar glänzen. Wie aus weiter Ferne blinzeln zwei gelbe Lichter durch den dünnen Nebelschleier, der zwischen den hageren Stämmen der Silberpappeln und Weiden steht. Zeitweise verschwinden die Lichter hinter den Bäumen, dann werden sie grösser und grösser, es sind die Fenster der Wohnstube in der Neudamühle. Von dort her schallt wie hastiges Atmen das rasche Auf und Ab der Brettersäge. Das gleichmässige Rauschen des Wassers ist begleitet vom Schlagen der Zapfen und Radschaufeln der Mahlmühle. Koja und Agi sind daheim. — Im dunklen Hausflur entledigen sie sich der feuchten Schuhe und vertauschen sie mit den bereitstehenden Filzschuhen. Dann erst betreten sie die Wohnstube, deren frisch gescheuerte Dielen mit rotgesäumten Läufern aus Sackleinwand belegt sind.
Mit Kuss und Handkuss begrüssen sie die Mutter, die im Lichtkreis der Lampe eine Anzahl Rechnungen und gerichtlicher Einläufe vor sich auf der Tischplatte ausgebreitet hat. — Die stattliche Müllerin, deren nussbraunes Haar an den Schläfen von Silberfäden durchzogen ist, beantwortet Agis angstvoll fragenden Blick mit einem stummen Kopfnicken, sie zeigt auf einen mit Zahlen beschriebenen Bogen. „Wirst mir nachrechnen, gelt, wenn ihr Kaffee getrunken habt; ich muss in die Küche.“ Agi holt aus dem Rohr des Kachelofens die warmgestellte Jause für sich und Koja; sie schneidet Brot vor. Kaum haben die Kinder ihren Milchkaffee ausgelöffelt, nimmt Agi die gerichtlichen Zuschriften her und vertieft sich in das Lesen der langen, schwer verständlichen Sätze; sie starrt auf den blassen Abklatsch einer vielleicht leserlich gewesenen Kanzleischrift; sie will und muss verstehen, wovon die Klage handelt, um welche Summen es sich dreht, wann die Tagsatzung ist. — Koja, der mit seinem Aufgabenheft der Schwester gegenüber Platz genommen hat, schaut unverwandt unterm Lampenschirm zu ihr hinüber. Das Gesicht der Schwester erscheint ihm mägerer und älter als sonst, der Ausdruck ihrer Augen ist härter, die zusammengekniffenen Lippen sind dünner, ihr Nasenrücken wird weiss; was sie nur hat? Mutter und Agi wissen alles und er ist der „dumme Bub“. Trotzig stosst er die Feder ins Tintenfass und beginnt zu schreiben. Im Ofen knistern und knacken die buchenen Scheiter, im Bratrohre singeln eingelegte Äpfel und entsenden einen herbsüssen Duft. Vom Brunnen her schallt das Rasseln der blechernen Milchkannen, die von der Magd gescheuert werden; fast im gleichen Takt mit dem Ticken der Standuhr tönt gedämpft das Klatschen des Mühlrades, hastiger das Sirren der Brettersäge. Da wird fernher von hoch oben ein rauhes, dumpfes Tuten hörbar, wie der Schrei eines Nebelhorns, zu dem sich ein schriller Oberton gesellt. Die Dampfsäge am Rechen macht Feierabend. Das Schlagen des Mühlrades verstummt und die Brettersäge steht still. Auch die Neudamühle hat ihr Werk abgestellt. Sie macht heute vor dem Sonntag früher Feierabend. Von der Gesindestube her werden Stimmen hörbar, die Knechte sammeln sich, um noch vor dem Abendmahl zu plaudern und zu rauchen.
Tiefer beugt sich Agi über die Zifferreihen, sie vergleicht die von der Mutter aufgestellte Übersicht der eingeklagten Forderungen und die der einzutreibenden Ausstände. Ihre Augen sind gross geworden, ihre Nase ist spitz, die Wangenmuskeln sind gespannt, die Mundwinkel herabgezogen. Da holt Koja die zwei gargebratenen Äpfel aus dem Ofenrohre und hält sie der Schwester hin: „Welchen magst?“ — „Keinen, kannst beide haben, mach’ mich nit irr.“ — So hat er’s erwartet.
Im Ofenwinkel huschelt sich der kleine Genussmensch neben den dickköpfigen Kater Matz auf den Boden und beginnt vorsichtig die von gebranntem Zucker klebrige haut eines Apfels abzulösen. Er geniesst bedächtig. Sachte streichelt er den Kater, es ist ihm ein Bedürfnis, ihn schnurren zu hören. Dabei träumt er schon vom morgigen Tag. — Wenn der Steininger Sepperl kommt und der Wieser Franzel, können die Palisaden vor der Farm fertig werden, bevor die Indianer angreifen. Er, Koja, ist der Farmer und die zwei Kameraden sind als Trapper zu Gast. Farm ist die am Rand einer Au-Lichtung vom Waldheger aus Blockholz und Rasenflözen errichtete „Puhu-Hütte“, die seit einem Jahr unbenützt ist. Der Uhud) ist nämlich eingegangen. Ihr Inneres ist so anheimelnd klein und ihr urtümliches Äusseres übt auf die Kinder einen romantischen Reiz aus. Und Koja sehnt sich nach der kleinen Hütte in der Einöde; er denkt an die Möglichkeit, die Sattler-Roserl zu versöhnen, dass sie mitspielt als Farmerin.
Nacht und Tag
Kaum war das Abendmahl vorüber, das die Müllerin und die Kinder gemeinsam mit dem Gesinde eingenommen hatten, so zog sich die Mutter mit Agi ins Wohnzimmer zurück. Sie hatten Briefe zu schreiben. Sie wollten die Ausstände eintreiben und von der Sonnleitner-Grossmutter in Böhmen Hilfe erbitten. Koja blieb in der Gesindestube, wo ihm der Schweizera) Flori behilflich war, aus einem im alten Eisen gefundenen hohlen Torschlüssel eine Kanone herzustellen zur Verteidigung der Farm gegen die Indianer. Beim Ausfeilen des Zündloches vertraute Koja dem verschwiegenen Flori an, dass er eine Tüte Schiesspulver vom Steininger Sepperl, dem Buben des Waldhüters, eingetäuschelt hatte. Dann aber begann das Erzählen von Gespenstergeschichten. Die garnumwickelte Pfeifenspitze zwischen den zahnlosen Kiefern, erzählte Flori dem gespannt lauschenden Gesinde, was er bei nächtlichen Gängen gesehen oder von anderen Geistersehern erfahren hätte. Auf den feuchten Brunner Wiesen war ihm der feurige Mann erschienen, in der Au hatte ein Hund mit glühenden Augen sich an seine Fersen geheftet, beim Mühlsteg lauerte der Wassermann ... und auf dem Gollinger Berg, wo früher der Galgen gewesen war, seufzten in stürmischen Nächten die Geister der Gerichteten. Abergläubisch wie das Gesinde, horchte Koja gierig und gruselnd den Gespenstergeschichten. Noch war er mit dem Abschmirgeln der dicken Rostschichte seiner Schlüsselkanone nicht fertig, als Agi mit einer brennenden Kerze erschien, um ihn zum Schlafengehen aufzufordern.
Zögernd folgte er der Schwester, die ihn über die knarrende Stiege in die ungeheizte Bodenkammer hinaufführte. Seit der Vater spät nachts heimzukommen pflegte, war die Kammer Koja angewiesen, während Agi auf dem Sofa in der warmen Wohnstube bleiben durfte, neben der Schlafkammer der Eltern. Teils, um die Schwester mit dem Lichte länger bei sich zu haben, teils, um sich noch etwas von der Seele zu reden, was ihn beunruhigt, fängt Koja an: „Agi, ich muss dir noch was sagen.“ — „Noch eine Dummheit?“ fragt sie zurück. „J—a“ und schon hat er den Geigenkasten geöffnet. — Agi schlägt vor Bestürzung die Hände zusammen: „Was ist denn mit der Geigen gschehn? — — Die ist ja zersprungen, geleimt und mit Spagatschnüren zusammengebunden!“ — Das war so: „Nach der Geigenstund, kaum, dass der Oberlehrer bei der Tür drauss’t war, fangt der Eckel-Poldi an, mich zu frozelnb):
„Roserl, Roserl, Tintenfass!
Koja, Koja, du bist blass!
Koja, Koja, drah di um,
In der Neuda geht der Scheckel um!“
Da heben die andern Buben ein G’lachter an und singen ihm das Trutzliedel nach. Und der Eckel-Poldi springt dabei hin und her und lacht und lacht. — Ich Krieg einen Zorn, pack die Geigen beim Hals und hau ihm’s ’nauf. — Auf einmal war’s still. Der Eckel aber fangt an zu bitten: „Nix sagen, nix sagen.“ Dann rennt er mit mir zum Tischler; der hat’s g’leimt und fest verschnürt; am Montag darf ich die Schnür’ wegnehmen; er sagt, das Blatt wird besser halten als vorher.“ —
Agi seufzte tief auf. „Auch von der Dummheit sag’ der Mutter nix. Später kannst ihr’s erzählen. Nur jetzt nit.“ Dann half sie ihm beim Aufschnüren der Schuhe, während er sich der Kleider entledigte. Erst als sie den Bruder zu Bette gebracht, mit ihm das Nachtgebet verrichtet, und ihm mit dem Daumen in mütterlicher Art das Kreuzeszeichen auf Stirn, Mund und Brust gemacht hatte, sagte sie ihm gute Nacht und trug die brennende Kerze davon.
Und jetzt Kam für den Buben, der noch immer nicht ans Alleinschlafen gewöhnt war, die schrecklichste Stunde des Tages. Er fürchtete sich im Finstern. Das Dunkel in seinem Stübchen war kein vollkommenes. Das Licht der Lampe, bei der unten Mutter und Agi die Briefe schrieben, drang durch die unverhängten Fenster und beleuchtete die mit „Palmkätzchen“ reich besetzten Kronen der hohen Weiden jenseits des Weges, und diese warfen einen Schimmer des Lichtes in Kojas Kammer, so dass die verschwommenen Umrisse und Schatten des Zimmergerätes gespenstisch wirkten.
Koja verkroch sich unter die kalten Federbetten, um nicht die sonderbaren Geräusche zu hören, die er sich nicht zu erklären vermochte. Und doch musste er immer wieder die Decke lüpfen, um dem Rätselhaften zu lauschen. Im alten Schrank, der nie geöffnet wurde, tickte etwas, wie eine Taschenuhr, die manchmal von unsichtbarer Hand zum Stehen gebracht wurde und dann plötzlich wieder unheimlich rasch zu gehen begann. — Die Totenuhr. — Wer sollte jetzt im Hause sterben? — Auf dem Dachboden trippelte es von kleinen Füssen, beim Mühlsteg unten klatschte etwas. Der Wassermann? Kojas Pulse hämmerten, in seinen Ohren war ein Sausen, das war nicht vom gleichmässigen Rauschen des Überfallwassers unterm Mühltrog. Erst, als sein Körper das Bettzeug gleichmässig durchwärmt hatte, begann seine Aufmerksamkeit zu erschlaffen, seine Einbildungskraft sprang von einem Gegenstand zum andern; Wassermann, Palisaden, der tintige Zopf, der Hund mit den feurigen Augen, Roserl in der Puhu-Hütte; alles stellte sich ihm kunterbunt vor; seine Hände falteten sich vor dem Munde, dann war ihm, als ruhten Agis graue Augen in Mütterlichkeit auf ihm und er schlummerte ein. — Mitten in der Nacht aber erwachte er von einem Knacken der Diele über sich auf dem Oberboden, dann hörte er ein Schlurfen von blossen Füssen, ein Rieseln zwischen Diele und Decke, dann ein Knarren, als öffne jemand das Dachfenster, und plötzlich einen langgedehnten, rauhen, zitternden Ton, wie vom Reiben eines gespannten Seiles — dann ein dumpfes Aufprallen eines schweren Körpers — und wieder das Schlurfen der nackten Füsse. — Als das kaum hörbare Schleichen und Tasten die Stiege herabkam und sich seiner Kammertür näherte hätte er schreien mögen vor Angst; wenn der Kerl jetzt da hereinkäme! — aber er biss die Zähne aufeinander und hielt den Atem an. Es ging vorbei —, dann wurde es stille. — Einschlafen konnte Koja nicht. Da scholl beruhigend von der Donauseite her das Pusten und Räderschlagen eines mühsam gegen den Strom arbeitenden Frachtendampfers. Wieviel Schlepper mit ungarischem Mehl der wohl hinter sich herzog? Das gleichmässige Geräusch wirkte auf Koja einschläfernd, aber schwere, unsicher tappende Schritte unten an der Hauswand entlang liessen ihn wieder gespannt aufhorchen. Ein Klirren von Eisen auf Stein. Der Haustorschlüssel war aus einer unsicheren Hand auf den Mühlstein vor der Türschwelle gefallen. Ein unverständlicher Fluch, ein Schnappen des schweren Türriegels, ein kurzes, freudiges Anschlagen des Hofhundes — der Vater war nach Hause gekommen.
Koja schob die Bettdecke von seinem Gesicht, strich sich das Haar sorgfältig hinter die Ohren, stützte sich auf den linken Ellbogen und lauschte angestrengt hinunter. Erst fiel die Türe der Wohnstube krachend ins Schloss, dann hörte er die tiefe Stimme des Vaters. Es war eine unwillige Frage, die Koja nicht verstand. Und jetzt hörte er die Mutter etwas sagen, dann redeten Mutter und Vater zugleich und dann sprach Agi darein. So angestrengt Koja lauschte, er vermochte nichts zu verstehen.
Plötzlich aber hörte er einen durchdringenden Schrei, dann wieder einen. Die Mutter schluchzte. Koja setzte sich im Bette auf. Und wieder vernahm er Agis hohe Stimme. Sprach sie der Mutter zu oder dem Vater? Der war still geworden. Das Weinen der Mutter wurde schwächer und schwächer, bis es verstummte. Alles war wieder still. — Der Lichtschimmer auf den Weiden verschwand. In der Kammer wurde es finster. Kojas Zähne schlugen vor Kälte und Angst aneinander, wieder verkroch er sich unter die Tuchent.c) Wieder vernahm er das Ticken im Holz des alten Schrankes; übermüdet vom Wachen und Lauschen schloss er die Augen und schlummerte ein.
Als er morgens in der durchwärmten Küche mit entblösstem Oberkörper vor dem Wasserschaff kniete und Agi mit einem eingeseiften Wollsocken ihm Rücken und Hals rieb, fiel sein Blick auf ihre Linke, die sich auf den Schaffrand stützte. Über den Rücken ihrer Hand ging eine rote Strieme. Koja drehte sich nach der Schwester um; da sah er eine breitere Strieme schräg über ihren Hals verlaufen. — Jetzt wusste er, was geschehen war: Agi hatte sich zwischen Vater und Mutter gestellt. Da schossen ihm die Tränen in die Augen: „Bitte, sag mir, liebe Agi, was war heut’ nacht?“ — Sie aber schüttelte nur den Kopf. „Mach’ die Augen zu!“ — Und schon begann sie ihm das Gesicht und die Haare einzuseifen. Dann goss sie ihm einen Krug Wasser über Kopf und Hals und entfernte sich. — Kaum abgetrocknet und angekleidet, eilte Koja mit hochklopfendem Herzen in die Wohnstube, wo das Frühstück bereit stand. Auf dem Divan, wo sonst Agi zu schlafen pflegte, sah er den Vater angekleidet liegen, den Kopf mit dem rotbraunen Vollbart zurückgeklinkt, den Mund weit offen, laut und regelmässig atmend; das rechte Bein mit dem kotigen Stiefel lag auf dem weissen Bettzeug, das linke hing über den Sofarand zur Diele nieder, auf dem Boden lag die aus Lederriemen geflochtene Hundepeitsche. Zögernd schlich Koja am Vater vorüber zu seinem Sessel. Auf einem Schemel dem Sofa gegenüber kauerte Agi, die Ellbogen auf die Knie, den Kopf auf die geballten Fäuste gestützt; sie starrte dem Schlafenden ins Gesicht. Draussen war die Stimme der Mutter zu hören, die dem Kutscher des Milchwagens einschärfte, auf dem kürzeren Feldweg zum Krummnussbaumer Bahnhof zu fahren. Der Zug nach Wien müsste in zwanzig Minuten da sein. Als der Wagen fortrollte, erhob sich Agi und schenkte den Kaffee ein. Die Mutter kam herein und setzte sich zu Tische. Koja erschrak: auf ihrer linken Wange war eine kaum verharschte Wunde. Da warf er sich vor der Mutter auf die Knie, und seine hervorbrechenden Tränen netzten ihre Kleider. Sie aber hob ihn auf, setzte ihn sich quer auf den Schoss, drückte seinen Kopf an ihre Brust, tätschelte ihm den Rücken und strich ihm beschwichtigend über das flachsfarbene Haar. — Dabei wiegte sie den Oberkörper sanft hin und her, als wollte sie ein Kind einschläfern. Keiner der drei sprach beim Frühstück ein Wort. Als Agi den Tisch abgeräumt hatte, rüsteten sich die Kinder zum Kirchgang. Agi nahm ihre breite Boa aus grauen Kaninchenfellen um den Hals, um vor Neugierigen das Schlagmal zu decken; dann holte sie ihre weisse Flanelljacke aus dem Kasten, packte sie in Seidenpapier und umschnürte sie mit einem roten Band wie ein Festgeschenk. — Auf den fragenden Blick der Mutter flüsterte sie nur bittend: „Später, Mami; ich sag’ dir’s später.“ — Die Müllerin übergab Agi fünf Briefe und küsste ihre Kinder zum Abschied. Erst führte Agi den Bruder in den Garten. „Wir müssen der Roserl ein Sträusserl bringen.“ Sie pflückten die halbverblühten Dolden der braunroten Aurikeln von den Beeträndern und liessen sie im Strauss von den duftenden Blütenständen des Gelbveigels überragen. Als die Kinder an der Bachseite des Hauses an die Stelle unterm Bodenfenster kamen, zeigte Koja einen weissen Fleck auf dem Uferpflaster. Es war eine dünne Schichte Mehl, die Spur eines heftig aufgestossenen Mehlsackes. Und dann begann er von dem nächtlich Erlauschten zu erzählen. — Und Agi erklärte ihm mit der Sicherheit einer Erwachsenen: „Glaub doch nicht an Gespenster. Der alte Flori erzählt, was er selber nit glaubt. Die andern hören nix lieber als gruselige Geschichten. Die ‚feurigen Männer‘ sind ‚Irrlichter‘, leuchtende Dünste, wie sie aus dem Sumpfboden aufsteigen, wo irgend ein Aas in der Erde verwest. Der Wassermann ist die Fischotter, die bei Nacht fischt oder im Wasser ihr Spiel treibt. Das Ticken im alten Schrank, das machen die Holzwürm’. Das Schleichen, Tappen und Tasten, das machen die Dieb’, Vom Bodenfenster hat ein Knecht einen Mehlsack am Strick hinuntergelassen und unten, wo der Sack hingefallen ist, siehst du die Mehlspur. Dort hat ein zweiter Dieb gewartet. — Seit die schlechten Freunde den Vater soweit gebracht haben, dass er die Nächt’ in Wirtshäusern zubringt bei Kartenspiel, Bier und Schnaps, haben’s die Diebe leicht. Ich glaub’, alle unsere Dienstboten haben stehlen g’lernt.“ Koja nickte. Und nun begann er die Schwester auszufragen, was unten gewesen wäre. Eine Weile liess sie ihn auf sich einreden. In tiefem Nachdenken ging sie neben ihm her. Ihre Augen hefteten sich auf den feuchten Auboden, wo die Grashalme zwischen dem braunen Laub sich empordrängten und wo vereinzelt hoch aufgeschossene, zum Teil verblühte Schneeglöckchen schimmerten. Sollte sie reden? Erst als die Kinder die Au und den Erlafsteg hinter sich hatten und im freien Felde der Sonne entgegengingen, begann sie: „Koja, du warst bis heut’ ein kindischer Bub, ich wollt’ und durft’ nit reden mit dir, wie’s um den Vater steht. Von heut’ an ist’s anders. Was du heut’ nacht erlauscht hast, hat dich wohl ernster gemacht. Du sollst versteh’n, warum die Mutter dem Vater so oft verzeiht. Geh’ doch langsamer und hör’ gut: Erinner’ dich doch, was uns die Grossmutter erzählt hat, als du noch klein warst: Wie unser Vater zehn Jahr alt war, sind ihm beide Eltern innerhalb sechs Wochen gestorben. Damals war die Cholera in Böhmen, wo wir früher zu Haus waren, weisst, dort, wo die Mutter unserer Mutter daheim ist, die ‚Sonnleitnerin‘, die uns zu Weihnachten immer einen Sack gedörrte Zwetschgen schickt. — Und wie der Vater verwaist war, hat ihm das Gericht einen Vormund gegeben an Eltern Statt, der hat ihn anhalten sollen zum Lernen und Bravsein. Der hat das Elternhaus des verwaisten Buben sparsam bewirtschaftet, aber zum Lernen angehalten hat er den kleinen Vincenz nicht. Nur dass er ihn auf Tausch nach Herrnskretschen gegeben hat, damit der Bub deutsch lernt. Dann aber hat er ihn Küh’ hüten lassen, statt ihn in die Schul’ zu schicken. Und dann ist der Vater Knecht gewesen beim Vormund. Und vom Gesind hat er in der Wochen das Fluchen gelernt und am Sonntag das Trinken. Und wie er gross war, hat ihm der Vormund das Haus mit Wald und Feld und Wiesen übergeben müssen als Erbstück von den Eltern. Und dann hat der Vater die Mutter g’heirat’, die hat von ihren Leuten ein Wirtshaus bekommen als Heiratsgut. Und da war der Vater auf einmal ein zweifach reicher Mann und hat viele Freund’ g’habt. Die haben mit ihm getrunken und Karten g’spielt um hohe Einsätz’. Und weil er gut war, hat er Geld hergeborgt, viele Tausend Gulden. Er hat nicht nein sagen können, wenn ihn die Leut’ gelobt und recht gebeten haben. Und oft hat er im Rausch gekauft, was man ihm verkaufen wollt’, wenn er’s auch nicht gebraucht hat; schöne Pferd’, Kaleschen,d) Holz zum Bauen, Schmucksachen, Bilder. Auf die Jagd ist er gangen mit anderen reichen Herren, so wie er’s da macht, in der Neuda, seit er vom Onkel Lorent die Mühl’ geerbt hat. Zwei schöne Jagdhund’ hat er g’habt; denen hat er in den Wirtshäusern Frankfurter-Würstel, Kalbsbraten und Schweinsbraten auf dem Teller vorsetzen lassen; so hat er das Geld vertan, weil der Vormund ihn nicht gelehrt hat, mit dem Geld richtig umzugehen. Der Vater könnt’ nix dafür, sagt die Mutter, schuld an allem wär’ der Vormund, der nicht gewusst hat, was er damit anrichtet, wenn er den Waisenbuben so aufwachsen lasst. Und die Mutter hat g’hofft, sie könnt’ den Vater anders machen. Aber sie konnt’ ihm nit wehren, weil er jeden Tag angetrunken war und grob mit ihr. Und just wie du vier Jahr alt warst und ich sechse, hat uns das Gericht alles verkauft, den Bauernhof, das Wirtshaus, die Wiesen, die Felder und den Wald.“ Koja nickte; er erinnerte sich daran. „Und dann ist unser Wandern angegangen. Du weisst doch, dass der Vater als Bremser bei den Schotterzügen angestellt war, wo gerade eine neue Bahn gebaut worden ist; in Alt-Paka, droben in Böhmen, dann in Leobersdorf, dann in Gaming, im Österreichischen.“ — „Das weiss ich doch!“ warf Koja ein. — „Aber dann ist grad unser Grossonkel g’storben, der uns nie hat helfen mögen und den wir nie gesehen haben, weisst, der Onkel vom Vater, der die Neuda-Mühl’ g’habt hat. Und der Vater hat die Mühl’ bekommen und war wieder ein reicher Mann. Jetzt sind wir das zweite Jahr da. Der Vater hat eine Zeit lang gut getan, solang er nicht allerhand Freund’ gehabt hat, die ihn zum Kartenspiel ang’lernt haben, zum Jagen geh’n und zum Trinken. Und weil er mehr Geld ausgibt, als wir fürs Mahlen und Bretterschneiden, für Milch und Eier kriegen, hat er wieder Schulden gemacht, jetzt verlangen die Leut’ ihr Geld und haben den Vater verklagt. Gestern ist vom Gericht die Vorladung gekommen und zwei Advokatenbriefe. Die Mutter und ich haben gerechnet und gerechnet. Was wir haben, wird nicht langen; das Gericht wird uns die Mühl’ verkaufen und wir werden wieder arm sein. Und das hat ihm die Mutter gestern nacht g’sagt, weil er bös war, dass sie schon wieder verweinte Augen ghabt hat. — Er hat ihr die Schuld gegeben, sie hätt’ sollen besser haushalten. — Da hab’ ich ungefragt dreing’redt. Und was dann geschehen ist, das frag’ mich nit. — Die Mutter will nit haben, dass es laut wird. Und sie sagt, der Vater wird wieder so gut, als er eigentlich ist — wann er wieder arm sein wird und nimmer so viel trinkt.“ — Trotz allen Leides, von dem Koja jetzt erfahren, hatte er ein zages Frohgefühl in sich, das ihm aus den Augen sah: Er kam sich wichtiger vor als je; Agi hatte zum erstenmal mit ihm geredet wie mit einem Grossen. Er war nimmer der dumme Bub von gestern. Agis Wort: „Wir werden arm sein,“ hatte auf ihn wenig Eindruck gemacht. Das Armsein dachte er sich ungefähr so, wie das Leben in Altpaka, wo er so glücklich gewesen war mit der kleinen Julie, oder wie das Spielen in der Puhu-Hütte, wo das Bänklein wackelte und die Spinnweben in den Ecken hingen.
Schon im Dorfe Brunn gesellten sich andere Kinder zu den Geschwistern; sie schwatzten sorglos wie die Sperlinge. Und Koja wunderte sich, dass seine Schwester lächeln konnte, wenn die andern lachten. Und als sie vor dem Garten des Brunner Müllers stehen blieb, um dort die erblühten Herzchenblumene) zu bestaunen, nahm er sie bei der Hand und schaute in Andacht die seltsamen Blüten mit an, lauter rote Herzen an langem, schwanken Stengel niederhangend, die grossen zutiefst und dann immer das folgende kleiner als das vorhergehende.
In Pöchlarn nahm Roserls Mutter von Agi die Jacke an und versprach, über die Sache nicht weiter zu reden. Dann trug Agi die Briefe zur Post und jedem gab sie einen Augensegen mit auf den Weg, bevor sie ihn in den schwarzgelbenf) Kasten warf: der Mutter Worte sollten Wunder tun bei denen, die sie lesen würden. Auf dem Chor sang Koja mit Roserl aus demselben Notenblatt und zwischen den einzelnen Strophen des Messgesanges flüsterten sie miteinander vom Amerika-Spielen. Roserl versprach, nachmittags in die Neuda zu kommen. Agi suchte den Oberlehrer auf und erbat von ihm die Zusage, dass er Koja beim Vater nicht verklagen werde. Jetzt war ihr leichter. Nach der Messe traf Koja seine Kameraden vor dem Kirchentor, darunter einige arme Buben von Gollinger Kleinhäuslern, die sich mit Bogen und Pfeilen als Indianer einfinden wollten, um die Farm zu belagern. Auf dem Heimweg holte Herr Sigismund Sacht, der Branntweinschänker aus Krummnussbaum, mit seinem Steirer-Wägelchen die Geschwister ein, liess sie mit aufsitzen, und so fuhren sie unter lustigem Peitschenknall durch die sonnige Frühlingslandschaft dem Heim zu, auf dem ungewohnten Umweg über die Rechenbrücke, ober der sich das von der Erlaf angeschwemmte Holz staute, Scheiter und Baumstämme in wirrem Durcheinander. Und als sie über die primelübersäeten Wiesen dem Haus zugingen, meinte Koja unvermittelt: „Vielleicht wird’s nit so schlimm; vielleicht kommt’s ganz anders.“ — „Ja“, versetzte Agi, „vielleicht helfen noch einmal die Briefe der Mutter; und wenn nit, wird’s mit dem Vater besser, wenn er nimmer reich sein wird; er wird nit so viel Freund’ haben.“ —
Die bange Stimmung wich von den Kindern, als sie beim Mittagessen staunten, dass die Mutter freundlich war, als war’ nichts Ungut’s geschehen. Die Wunde unterm Aug’ hatte sie mit einem gelben Mehl bestäubt;g) der hässliche Schurf war verdeckt. Der Vater ass wenig und vermied es, seinem Weib ins Gesicht zu sehen. Er bereute, dass er sich so weit vergessen hatte — zum ersten Mal. Schon um zwei Uhr fand sich die Roserl ein; sie brachte Agi die Jacke zurück und schleppte sich mit einem Korb Geschirr und Esswaren ab zum Spielen in der Farm.
Von der Müllerin erbat sie sich einen Polster, von Koja zwei alte Hosenträger, dann fing sie den Kater ein, der sich ohne viel Sträubens darein fand, als Wickelkind eingeschnürt zu werden. Bald kam auch der Wieser Franzel mit dem Steininger Sepp. Die sollten als Trapper die Farm verteidigen helfen. Als Waffen trugen sie lange Stäbe, die sie mit Spagatschnüren wie Flinten umgehängt hatten. Der Zug ordnete sich zum Aufbruch. Agi blieb bei der Mutter zu Haus. Der Farmer Koja trug am linken Arm den Proviantkorb, wo zwischen Speck, Brot und Kaffeeflasche auch die geladene Kanone und die Pulvertüte verstaut war; in der Rechten hielt er ein kleines Küchenbeil, um damit durch die „Lianen“ des Urwaldes einen Pfad zu bahnen. Die Farmerin Roserl hielt aber mit mütterlicher Sorgfalt ihr Wickelkind im Arm, das mit grossen staunenden Augen in die Welt sah und manchmal einen unwilligen Laut von sich gab. Die Wandernden wichen dem leicht gangbaren Pfad im Weidenwald sorgfältig aus und Koja bahnte mit vielen Axthieben den Weg durchs ärgste Gestrüpp von Waldreben und Brombeeren.
In der Farm angekommen, legte Roserl das Wickelkind in einen Winkel auf Laub, dann baute sie vor der Hüttentüre aus Steinen einen Herd und fing an zu kochen, d. h. den mitgebrachten Kaffee im Blechtopf zu wärmen. Den zwar schon geräucherten Speck hängte sie auf einer grünen Rute in den Rauch. Die drei Männer aber begannen mit fieberhafter Hast den Bau der Palisaden, die vor der Farm einen Hofraum von zwei Schritten im Geviert einschliessen sollten. Das Bauholz musste wegen der Indianer mit grosser Umsicht vom Erlafufer herbeigetragen werden, wo manche der bei Hochwasser verschwemmten Scheiter im Ufergebüsch hangen geblieben waren. Zwischen starken Weidenstöcken, die in den Boden gerammt worden waren, wurden die Hölzer wagrecht aufeinander gelegt, so dass eine fast kniehoche Schutzwehr entstand, hinter der die Schützen in liegender Stellung gedeckt waren. Für die Kanone aber wurde durch Auftragen des Mulmsh) einiger Maulwurfshügel ein erhöhtes Fort geschaffen, von dem aus das Geschütz die ganze Prärie bestreichen sollte.
Kaum waren die Verteidigungsmassnahmen getroffen, als sich in der Lichtung schon ein Indianer zeigte, dessen Gesicht in seiner Rötel-, Russ- und Kreidebemalung ganz fürchterlich wirkte. Ein Zielen mit dem Stecken und ein geschrienes „Bumm“ wirkte wie der Schuss einer Riffle und der Späher fiel der Länge nach ins Gras. — Dann aber stürmte eine Schar von vier Rothäuten heran, stiess ein entsetzliches Kriegsgeheul aus, und schoss die Pfeile ab; Bum auf Bum, Fall auf Fall folgte. Zwei Indianer fielen. Mit Todesverachtung drangen die zwei Überlebenden zum Handgemenge vor, die hölzernen Tomahawks schwingend. Koja nahm mit seiner Kanone den vorderen aufs Korn, aber das Zündholz verbrannte ihm zwischen den Fingern, die Zündung versagte; beim Tragen war Pulver aus dem Zündloch gerieselt. Da holte er sich vom niedergebrannten Feuer ein glimmendes Holzstäbchen, neigte sich über die Kanone und bohrte die Glut ins Zündloch. Ein Knall erfolgte, dann ein Schrei; aber nicht der Indianer schrie, der tot hingestürzt war: nein der Farmer selber. Beide Hände hielt Koja sich vors Gesicht und jammerte: „I siach nix, i siach nix, i bin blind.“ — Da liessen die Trapper den zweiten Indianer los, der über die Palisaden eingedrungen war, die toten Rothäute draussen in der Prärie wurden lebendig, sie kamen in langen Sprüngen von der Lichtung herein, und alle umstanden anteilnehmend den jammernden Farmer.
Roserl zog ihm die Hände vom Gesicht. Er hatte die Augenlider krampfhaft geschlossen, die Wimpern und Brauen waren etwas versengt, das Gesicht von Russ. Pulverkörnern und Tränen versudelt. „So mach’ doch die Augen auf!“ schrie Roserl den Jammernden an. Er folgte und dann jubelte er auf: „I siach schon, i bin nit blind.“ Da holte der Wieser Franzel einen Hut voll Bachwasser und Frau Roserl wusch dem verwundeten Mann das Gesicht. Es gelang ihr aber nicht, alle Spuren des Schusses zu tilgen. „Dank du dem Herrgott, dass die Augen sich dir rechtzeitig zugemacht haben. — Hättest können blind sein für immer.“ In der allgemeinen Freude wurde Friede gemacht, die Indianer trugen dürres Holz herbei, dass das Feuer besser genährt werden konnte, die Farmerin verteilte Brot und Speck an alle Versöhnten und befreite ihren Säugling aus dem Wickel. Der Kaffeetopf ging von Mund zu Mund und das Farmerkind nahm teil am Friedensmahl. Und wo war die Kanone? — Die hatte mitsamt ihrer Lafette einen Sprung gemacht, niemand wusste wohin. — Alles Suchen nach ihr blieb vergebens. Sollte sie vielleicht einer der Indianer eingesteckt haben?
Die Sonne sank hinter der Gollinger Höh’ und die Spielgefährten zerstreuten sich.
Nach dem Abendmahl nahm Koja den Spagatverband von seiner Geige, schabte die vorgequollenen Leimklümpchen