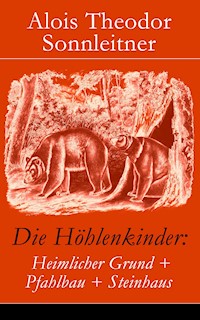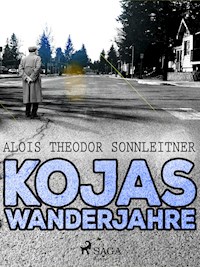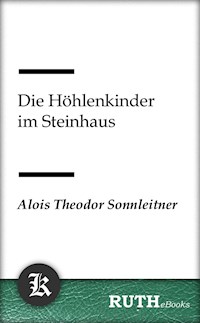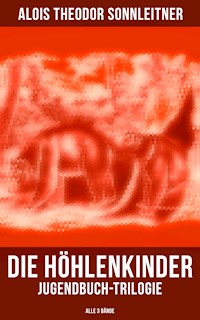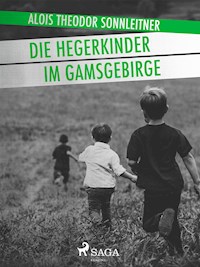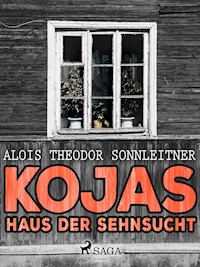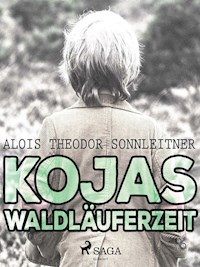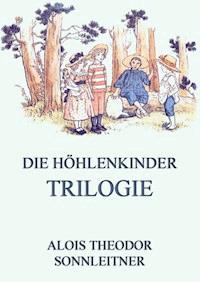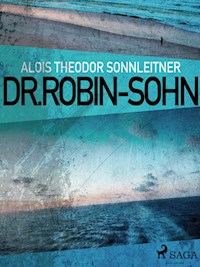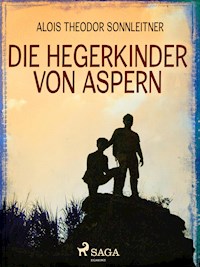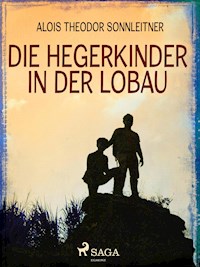
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Nicht ruhig wie das klare Sickerwasser der Donauarme sind die Jugendtage / der Hegerkinder; ihre hellen Freuden, sie wechseln ab mit Kummer und mit Plage." Die Lobau ist ein Auengebiet an der Donau in Österreich, das heute zum größten Teil zur Gemeinde Wien gehört. Zur Zeit der Hegerkinder war es noch ein wildes, urwüchsiges Wald- und Sumpfgebiet. Die Hegerkinder, das sind zunächst Bertel und Liesel. Ihr Vater ist Förster in der Lobau, zu dessen Aufgaben es unter anderem gehört, Wilddieben nachzustellen. Ihre Mutter kümmert sich fürsorglich um die beiden Kinder. Da ereilt die Familie die traurige Nachricht, dass der Bruder des Hegerförsters gestorben ist. Seine beiden Söhne, Franzel und Sepperl, werden von der Hegerfamilie aufgenommen, so dass es fortan also vier Hegerkinder gibt. Doch es muss erst einmal Platz für die beiden Neuankömmlinge geschaffen werden, und so wird in mühevoller Arbeit der Dachboden ausgebaut und dort eine Stube für die beiden eingerichtet. Zu viert erleben die Hegerkinder allerlei Abenteuer und sonstige Erlebnisse, die, wie das vorangestellte Motto schon deutlich macht, nicht nur Freude und Glück bringen, sondern oft auch mit Kummer, Leid und Anstrengung verbunden sind. Im Vordergrund stehen die Erlebnisse mit der Natur: Tiere, Pflanzen, Landschaften, Menschen, die ganze urwüchsige Welt der Lobau entfaltet sich vor dem Leser und er erhält, ganz im Nebenbei, neben allerlei Aufregendem und Spannendem, eine interessante und lehrreiche Einführung in die Naturkunde, lernt Raubvögel und Fische, seltene Pflanzen und Bäume, auch Bräuche und landwirtschaftliches Gerät kennen und geht fortan mit wacheren Augen durch die Welt. A. Th. Sonnleitners zweiter Band der Hegerkinder-Reihe ist ein wunderbares Buch über Natur und Mensch für Jung und Alt!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alois Theodor Sonnleitner
Die Hegerkinder in der Lobau
Saga
Die Hegerkinder in der LobauCopyright © 1929, 2019 Alois Theodor Sonnleitner und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711570074
1. Ebook-Auflage, 2019 Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Die Hegerkinder in der Lobau.
Nicht ruhig wie das klare
Sickerwasser
der Donauarme sind die
Jugendtage
der Hegerkinder; ihre hellen
Freuden,
sie wechseln ab mit Kummer
und mit Plage.
Doch muss der Kummer fliehn vor lieber Hilfe, was einen drückt, das wollen alle tragen; so wird es leicht den guten Kameraden; die Plage wird im Schaffen zum Behagen.
Und kommt ein schöner Tag mit Sang und Blüten, teilt eins des andern Lust mit frohem Sinne, auf dass der Kampf mit Widerwärtigkeiten so nach wie vor mit Zuversicht beginne.
A. Th. Sonnleitner.
Die Wilderer-Buben.
Wenn auch das Hochwasser in der Lobau täglich sank, hatte der Heger doch noch immer verschärften Nachtdienst.
Bertel und Liesel waren längst zu Bette gegangen. Auch die Hegerin; aber sie schlief nicht. Sie lauschte den ruhigen Atemzügen ihrer schlummernden Kinder und dem gedämpften Brausen des Sturmes, der von Stadtl-Enzersdorf über den Lobauer Pappelwald herübertobte. Der brach aus den Kronen der uralten Bäume abgestorbene Zweige, führte sie mit sich und warf sie da und dort prasselnd gegen die Stämme. Die Hegerin dachte mit Bangen an ihren Mann, der im Pflichteifer seine nächtliche Runde machte, um den Wilddieben die Meinung zu benehmen, dass bei bösem Wetter „die Luft rein“ sei. Jetzt, wo die Wildenten und Fasane schon brüteten und wo die Rehgeissen und Hirschkühe vor dem Werfen waren, sollte kein Nestplünderer und Schlingenleger den Wildstand schädigen; es galt, die Bruten und die Muttertiere zu schützen. Das Weib des Hegers fürchtete weniger, dass ein Wilderer ihn meuchlings anfiele, als vielmehr, dass ein vom Sturm gebrochener Ast ihn im Fallen träfe.
Die windgejagten Wolken gaben den Mond frei, in der Stube wurde es silberig helle. Da setzte sich die Hegerin in ihrem Bette auf und sah zu den Kindern hinüber. Bertel schlief mit offenem Munde, hörbar atmend, sein dunkles Haar hob sich deutlich vom weissen Polster ab, während seine rechte Wange auf den gefalteten Händen ruhte. Neben Liesels Blondkopf lag das Porzellanköpfchen ihrer Puppe, die sie mit der Rechten umklammert hielt. Plötzlich verfinsterte sich das Zimmer, eine Wolkenwand hatte sich unter den Mond geschoben. Dann vernahm die Hegerin von den Fenstern her das Trommeln einzeln angeworfener Tropfen; der Sturm liess nach, der Regen nahm zu. Sein eintöniges Geräusch wirkte einschläfernd. Nur wie im Traume vernahm die Hegerin die Heimkehr ihres Mannes, der die Stubentüre leise zuzog und dann erst in der Küche Licht machte. Als er sich des durchnässten Lodenrockes entledigte, meldete sich ihm leise knisternd die in der inneren Brusttasche vergessene Jagdzeitung. Die hatte der Briefbote schon vor zwei Tagen für ihn auf dem Forstamt abgegeben, aber noch hatte der Heger nicht Musse gehabt, sie zu lesen. Als er die Anschriftschleife abnahm, fiel eine Postkarte heraus, die den Stempel „Gaming“ trug. Die Schrift war fremd. Sollte die verwitwete Schwägerin schon aufgebraucht haben, was er ihr vor wenig Wochen an Geld geschickt hatte? Warum schrieb sie nicht selbst? Hatte sich ihre Krankheit verschlimmert? Mühsam entzifferte er die klobigen Schriftzüge:
Mein lieber Gschaider!
Bin als Flösser des öftern vom Pöchlarner Rechen bis zu die Weissgerber in der Weanerstadt gfarn. Drum trau i mirs zu, dass i di find. I bring dir di zwoa Buam von dein Brudern, wie’s die Gschaider Maria wollen hat, eh vor’s gstorben is. Mittwoch bin i bei enk. Dein alter Schulkamerad
Leopold Neunteufel, kennst mi eh.
Der Heger legte die Karte auf den Tisch. Die Todesnachricht traf ihn wie ein Vorwurf. Heute, da er im Forstamt erfahren hatte, dass infolge der Fröste im Quellgebiet der Donau die Hochwassergefahr einstweilen vorbei war, hatte er sich den Urlaub ausgebeten, um die Witwe mit ihren zwei Buben zu holen. Halblaut sprach er vor sich hin: „Versäumt; sie braucht meine Hilf’ nimmer.“ Und heute war Mittwoch; die Waisen waren unterwegs. Er überlegte: Ob der Neunteufel mit den Kindern den Weg von der Reichsbrücke über den Regulierungsdamm kam oder von der Asperner Seite? Ob er nicht gescheiterweis’ mit ihnen in Wien übernachtete? Aber gescheit war der nicht immer. Wenn er einige Gläschen Schnaps getrunken hatte, wie er’s bei der Flösserarbeit gern tat, war er verwegen. Bei der Vorstellung, dass der Flossknecht vielleicht mit den Kindern im Regen und Sturm den langen Dammweg zurücklegte oder gar durchs Wasser watete, befiel den Heger ein Frösteln. Er kleidete sich still an und stellte sich lauschend vors Fenster. Da wars ihm, als hätte er eine rufende Stimme gehört. Dann wieder, als wär’s nur der Schrei der Sumpfeule gewesen oder das Knarren windgedrückter Äste. Der Hund schlug an. Der Heger trat auf die Türschwelle und horchte gespannt hinüber zum Damm. Und deutlich, wenn auch vom Wind abgeschwächt, klang es herüber: „Herr Heeeger! Herr Heeeger!“ Es war eine hohe Knabenstimme, die Stimme des Sohnes vom Wirt Turnovsky, den die Leute den „Roten Hiasel“ nannten. Gschaider zündete die Kerze in der Stalllaterne an und ging in den strömenden Regen hinaus. Als er drüben an der Dammböschung anlangte, vernahm er die Stimme Hiasels aus der Nähe: „Herr Heger, i bring’ die zwoa Buam.“ Und schon vermochte er die Umrisse der drei Knaben zu unterscheiden, die nach ihm hintasteten. „Wo ist denn der Neunteufel?“ „Der sauft bei uns,“ gab Hiasel zur Antwort; „er hat uns alle wachgepumpert. — Und i hab’ mir’s vom Vater ausbeten, dass i die zwoa Buam herweisen därf. Hiazt aber ,Guate Nacht‘ alle miteinander!“ — Und er verschwand in der Finsternis, als hätt’ ihn der Erdboden verschluckt. Der Heger rief ihm seinen Dank nach, dann wendete er sich seinen zwei Bruderskindern zu: „Von heut an sagt ihr Vater zu mir, und zu meinem Weib Mutter.“ Durch den strömenden Regen führte er sie still hinüber zum Hegerhaus. Er brachte die Kinder in die noch warme Küche, legte sachte Holz auf die glimmenden Herdkohlen und goss Wasser auf den Kaffeesud in der Kanne, die er zustellte. Jetzt erst besah er sich die Knaben, die unbeweglich an der Tür standen und verlegen die durchnässten Lodenhüte in den Händen hielten. Von den Rändern der Wettermäntel, die sie über ihre mächtigen Rucksackhöcker gezogen hatten, tropfte das Wasser und die nassen Haare hingen ihnen tief ins gebräunte Gesicht. Ihre Augen irrten über die Gegenstände der Küche. „Der welche von euch ist denn der Franzel?“ Der kleinere und stämmigere trat einen Schritt vor. Scheu sah er zum Heger auf. Seine dunklen Augenbrauen zogen sich finster zusammen. — „Dann bist du der Sepperl.“ Der grössere nickte: „Alleweil“ und lächelte gutmütig. — „Müssts euch umg’wanden,“ sagte der Heger und entledigte sich seiner Stiefel. Sie streiften die Wettermäntel ab. Und nun half er ihnen die überfüllten Rucksäcke ablegen, deren gespannte Schulterriemen tief einschnitten. Als er Sepperls Rucksack niederstellen wollte, traf ihn ein bittender Blick aus den graublauen Augen des Kindes: „Bitt, nit gach niederstellen; san unsere Kaffeehäferln drein und aa das von der Muatter.“ Dem Heger fiel auf, dass aus Franzels Rucksack ein verrosteter, allem Anschein nach auf halbe Länge gekürzter Flintenlauf ragte. Er zog ihn heraus, fand auch inmitten der in den Rucksack gestopften Hemden und Kleider den Kolben dazu und vereinigte beide Stücke der Waffe mittels der Schnappfeder. Franzel sah ihm misstrauisch zu, dann aber griff er nach dem Wildererstutzen und riss ihn an sich. „Den gib i nit her, der is von mein’ Vadern. Den andern haben die Schandarm g’nummen.“ Der Heger schmunzelte: „Willst du epper aa wildbrateln gehn?“. Der Bub gab keine Antwort. Sein Gesicht nahm den Ausdruck trotziger Entschlossenheit an. Gschaider besah sich den stämmigen Buben genauer: „Vielleicht überlegst dir’s noch und wirst a richtiger Jager, du Rabuzzel, du.“ — Dann schlich er auf den Socken in die Stube, zog zwei seiner Flanellhemden aus der Truhe und kehrte damit zu den Kindern zurück. Er lispelte ihnen zu: „Ausschälen!“ und half ihnen aus den völlig durchnässten Kleidern, um sie in die weiten und weichen Hemden zu hüllen, deren Ärmel ihnen viel zu lang waren. Er hängte ihre Gamslederhosen, ihre Lodenjacken, die grünwollenen Kniestutzen und die groben Hausleinwandhemden über das Gerähm um den Ofen herum und stopfte die zerweichten Stiefel mit geknülltem Papier aus. Dann schob er ihnen zwei Sessel nahe zum knisternden Feuer. Da glitt ein Lächeln über die Gesichter der Waisen und auch aus Franzels braunen Augen leuchtete den Heger etwas wie erwachende Zuneigung an. Die strahlende Wärme des Herdfeuers tat so wohl! Die Knie bis zum Kinn heraufgezogen, das Hemd darüber gespannt, die Hände von den hangenden Ärmel-Enden verhüllt, sassen sie da und ihre Augen folgten gespannt jeder Bewegung des Hegers. Er mengte die heissgewordene Kaffeebrühe reichlich mit Milch, zuckerte sie und füllte sie in grosse Töpfe. Gerne griffen die Knaben darnach und umklammerten sie mit beiden Händen. Der Pflegevater strich noch für jeden ein grosses Butterbrot. Als er fragte: „Mögts no an Reanken?“ nickten sie: „Bitt schön.“ In stiller Freude sah ihnen der Heger beim gierigen Essen zu. Als sie gesättigt waren, fragte er sie flüsternd: „Habts an Hunger g’habt?“ Die Knaben zögerten mit der Antwort. „Hat er euch nix geben, der Neunteufel?“ „O ja, Brot in Schnaps getunkt hat er uns antragen! Das wär gegen die Kälten gewesen, hat er g’sagt.“ „Hat’s euch g’schmeckt?“ forschte der Heger weiter. Da schüttelten sie die Köpfe: „Wir durften’s nit nehmen. Die Leut haben g’sagt, der Vater wär’ vom Bam derschlagen worden, weil er b’soffen g’west wär’. Da hat die Mutter, wie’s mit ihr zu End’ gangen is, uns aufboten, wir dürften nia nit an Schnaps verkosten.“ „Und da habts lieber g’hungert?“ fragte der Heger. „Wir hab’n Brot mitg’habt.“
Was der Heger nicht aussprach, war der Gedanke: „Die Kinder geraten dem Vater doch nicht nach; Gott und der braven Mutter sei Dank!“ Er erinnerte sich an einige seiner Schulkameraden, die Söhne von Trinkern und doch tüchtige Menschen waren, nur weil die guten Mütter sie zur Enthaltsamkeit vom Alkohol erzogen hatten und zur Arbeitsfreudigkeit. Da fiel ihm das Sprichwort ein: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“ Und halblaut sprach er vor sich hin: „Der Apfel fällt oft weit vom Stamm.“ Leise schlich er in die Stube zurück, breitete als Lager für sich einen alten Pelz auf den Fussboden und schob sich die Jagdtasche als Kopfpolster zurecht. Dann legte er die Kinder eins nach dem andern in sein eigenes Bett. Er musste in sich hineinlachen, als er bemerkte, dass Franzel seinen Stutzen ins Bett mitnahm. Das alte Schiesseisen war wohl in des Buben Augen ein grosser Schatz, den er dem Pflegevater nicht gleich anvertrauen mochte. Von seinem Lager aus lauschte der Heger hinüber zu den zwei Kindern, die schlaftrunken ihr Nachtgebet zu lispeln begannen; aber sie kamen darin nicht weit. Bald verrieten ihre hörbaren Atemzüge, dass sie fest eingeschlafen waren, erschöpft vom langen nächtlichen Marsche durch Sturm und Regen und vom Schleppen ihrer Habseligkeiten. Da fand auch der Heger Ruhe in dem Trostgedanken: „Was ich an der Mutter versäumt hab’, werd’ ich gutmachen an den Kindern.“ Und im Einschlummern musste er lächeln, da ihm vorschwebte, was für Gesichter Liesel und Bertel machen würden, wenn sie beim Erwachen wahrnähmen, dass sie in der Nacht zwei neue Geschwister bekommen hätten, zwei stramme, wohl ausgewachsene Buben.
Um ein nochmaliges Zusammentreffen der Söhne des Wilderers mit Neunteufel zu verhindern, verliess der Heger im Morgengrauen das Haus und marschierte, vom kühlen Ostwind getrieben, auf dem Damme zum Wirtshaus, dem „Roten Hiasel“. Der Regen hatte aufgehört; die prickelnde Morgenkühle war dem Heger lieb. Er suchte den ehemaligen Schulkámeraden im Heustadl auf, wo er übernachtet hatte, und sagte ihm Dank. Dabei erfuhr er, dass die Witwe des Wilderers in der Zeit ihrer Krankheit all ihr Hab stückweise verkauft hätte, nur nicht die Kleider am Leib und das Strohlager, statt jemand um Hilfe zu bitten. Das Geld, das sie von ihrem Schwager erhalten hätte, wäre auf die Begräbniskosten daraufgegangen. So hätten die Kinder kein Erbe zu erwarten. Eilig nahm der Heger von Neunteufel Abschied. Nun hatte er das Gefühl, dass die Waisen ganz ihm und seinem Weibe gehörten. Waren bisher zwei Hegerkinder dagewesen, so waren es von nun an vier.
Nür die eine Frage beschäftigte ihn: „Wo tu’ ich die Buben hin?“ Die Wohnstube hatte bisher der Hegerfamilie als Schlafraum genügt. — Im Heustadl oder im Stall wollte er die Wildererbuben nicht nächtigen lassen. Er befürchtete, Franzel könnte sich nächtlicher Weile hinausschleichen und das Wild im Revier beunruhigen. Der Dachboden im Haus war aber zu lüftig. Da musste etwas geschehen.
Die Dachstube.
Als der Heger vom „Roten Hiasel“ heimkehrte, fand er sein Weib schon wach und mit dem Kochen des Frühstücks beschäftigt. Ihre Augen waren gerötet, sie hatte Neunteufels Karte gelesen und dabei geweint. Aber ihr rundliches Gesicht zeigte keine Trauer mehr, nur hausmütterlichen Eifer. Aus der Stube schollen gedämpft die Stimmen der vier Kinder herüber, die schon miteinander vertraut schienen. Liesel schlüpfte in die Küche, angekleidet, gewaschen und gekämmt. Helle Freude im Gesichte, übernahm sie es, den grossen Küchentisch zum Frühstück zu decken. Ihr nach kam Sepperl, mit des Hegers langem Hemde angetan, und holte für sich und seinen Bruder die übertrockneten Kleider vom Ofengerähm.
Als die ganze nun sechsköpfige Familie beim Frühstück vereint war, warf die Hegerin die Frage auf: „Wo werden’s denn schlafen, unsere zwei neuchen Kinder?“ Sepperl, der zutraulichere der beiden Brüder, machte den Vorschlag: „Im Kuhstall wär’s schön warm.“ Und Franzl, der mit zusammengezogenen Brauen dasass, warf seine Meinung in die Beratung: „Mir legen uns in a Heuhütten.“ Der Heger ging darauf nicht ein: „Nit lieber auf’n Hausboden?“ Dann aber redete er mit seinem Weibe von den bevorstehenden Arbeiten im Garten und die Kinder schwiegen. Nach dem Frühstück lud er die Knaben ein: „Kommts mit, dass wir uns die G’legenheit anschaun!“ Als sie über die steile Holztreppe hinaufstiegen, meinte der Heger mit einem Seitenblick auf Franzel: „Gut, dass die Bretter knarrezen bei jedem Tritt. I hab’ an leisen Schlaf und höret’s glei, wann si oans ’nauf oder ’nunterschleichen wollt!“
Der geräumige Boden hatte von zwei Seiten her Licht: von der offenen Giebelluke und von einem Dachfenster, dessen starke Scheiben in Blei gefasst waren. Es wurde durch eine Eisenstütze offen gehalten als Durchlass für die Katze. Ein kleiner Vorrat von ungehobelten Brettern, Polst erhölzern, Latten, Kisten und alten Fassreifen war in den Dachwinkeln verstaut. Mitten im Raum lag ein Haufen Gerste und eine hölzerne Wurfschaufel dabei. „Wann wir da heroben vorm Fenster einen Bretterverschlag machen, habts a liachts Kammerl, und so oft’s enk einfallt, könnts das Körndl umschaufeln, dass ’s nit muffig wird und dass d’Kornwürm koa Ruah hab’n.“ Er nahm etwas Gerste auf, ging damit zum Fenster und liess die Körner aus einer Hand in die andere laufen. „Da is aner, schauts enkn guat an.“ Was er den Kindern zeigte, war ein winziger schwarzer Rüsselkäfer, dessen schmaler Leib nach vorn in einen nadeldünnen Rüssel ausging. „Der bohrt mit’n Rüssel die Körndel an, legt Eier hinein und aus denen werden dann die Kornmaden; die fressen die Körndl hohl aus. Ungeziefer!“ Er zerquetschte den Käfer an einem Dachbalken und munterte die Knaben auf: „Gehn m’r ’s an, das Bauen! Langts mir vier Polsterhölzer her.“ In erwachter Schaffenslust schleppten die Knaben die schweren Hölzer herbei, die der Heger im Geviert von 3 Metern Länge auf den Boden legte. Wo sich ihre Enden kreuzten, machte er mit dem Bleistift Querstriche. „Da müssen m’r ’s durchschneiden.“ Bertel holte von unten drei Sägen herauf. Eine Spannsäge, eine Bogensäge und einen breiten Fuchsschwanz. Dann zog der Heger eine Spagatschnur aus der Tasche, zwickte sein grobes Taschenmesser an eines ihrer Enden, nahm das andere Ende in die Hand und liess das Messer an der gestreckten Schnur niederbaumeln. Mit diesem Lote ermittelte er den Abstand jedes Eckpunktes des Bodenrahmens vom senkrecht darüberliegenden Ort der Dachsparren, wo der Eckständer anstehen sollte. So bekam er die Masse der Randhölzer, die er heraussuchte, anriss und den Buben zum Abschneiden übergab. Die vier Punkte an den Dachsparren, wo die Ständer anstehen sollten, bezeichnete der Heger mit einem weichen Ziegelbruchstück, das er vom Boden aufgelesen hatte, und nahm gleich die Masse ab für die Längen der Polsterhölzer zum oberen Rahmen, der dem Dache anliegen sollte. Als auch an diesen die Endschnitte angezeichnet waren, überliess er es den drei Jungen, alle Hölzer auf die richtige Länge zu bringen.
Da holte Bertel den Holzbock herauf, um seine Werkhölzer auflegen zu können. Sepperl und Franzel halfen sich, indem sie ihre Hölzer auf Bodenbalken legten und mit dem linken Knie fest niederdrückten. Indessen brachte der Heger sein Werkzeugkistchen, und Liesel schleppte sich mit der kleinen Lade ab, in der allerlei Schrauben und verbogene Nägel beisammen waren. Gerne willfahrte sie dem Befehl des Vaters: „Du wirst uns Mannsbildern die Nägel vorrichten. Legst jeden verbogenen Nagel hohl auf den Dachbalken und haust mit’n Hammer auf’n Bug, drehst und hämmerst einen jeden Nagel so lang, bis er g’rad ist.“ Die Kinder hatten den Plan des Stubenbaues erfasst: es sollte eine Hütte im Haus werden. Und aus dem lustigen Sägen und Klopfen klang die Schaffensfreude aller heraus.
Als der Heger anfing, die Bretter für die Seitenwände vom Stoss zu heben, fragte Liesel zu ihm hinüber: „Aber Vater, wird’sda nicht kalt sein in der Nacht, wenn der Wind zwischen den Dachziegeln hereinkann?“ — „’s wär’ grimmig kalt, du hast recht; wir werden das Stückl Dach einwendig mit Brettern verschalen.“ — „Aber zwischen den Brettern kann ja wieder die Luft durch!“ — „Da tragen wir halt Mörtel auf.“ — „’s Malter wird nit halten am Holz,“ meldete sich Franzel. — „Zu was wär denn nachher das Rohr da“, mischte sich Bertel in die Rede, „das Stukkaturrohr? — Der Vater maht’s im Winter und verkauft’s dem Stadlauer Baumeister.“ — „Das muss verbunden und angenagelt werden,“ meinte Sepperl. „Wer’n m’r ’s halt annageln; wir sind ja viere; da geht’s g’schwind“, versetzte Bertel. Der Heger beeilte sich, mit Hilfe der Lotschnur die Länge der Seitenbretter festzustellen und anzuzeichnen, dann holte er ein Stück Kreide aus der Werkzeugkiste, riss die Schnittlinien an und bezifferte die Bretter. Ausser den vier Eckständern wurde noch ein Ständer für den rechten Teil des Türrahmens und dazu ein oberes Querholz gesucht. Links sollte die Türe am Eckständer anliegen. Als das geschehen war, nahm der Heger die von den Knaben geschnittenen Polsterhölzer vor: „Wir müssen’s an den Enden anblatteln. Vom untern Holz die Hälfte der Dicken weg und vom obern auch; legt man die Enden aufeinander, müssen sie genau so dick sein wie das Polsterholz. Die Eckständer werden von aussen angeblattelt.“ Dann zeigte er an einem Ende, wie er’s meinte. Erst führte er in der Entfernung der Polsterholzdicke einen Querschnitt bis in die Mitte der Dicke, dann vom Kopf des Polsterholzes den Gegenschnitt in der Richtung der Flader, bis sich die Schnitte trafen und ein Klötzchen von halber Holzdicke abfiel. „So, jetzt sagelts drauf los! I muss Dienst machen gehn.“ Mit diesen Worten überliess er die Kinder ihrer Werkfreude.
Als er eine Stunde vor Mittag heimkehrte, waren alle Polsterhölzer zum Anblatteln fertig, die zugeschnittenen Läden in der Reihenfolge nach den Ziffern gelegt, und Liesel prahlte mit einem grossen Vorrat geradgebogener Nägel aller Grössen.
Das Zusammennageln des Bodenrahmens und des Deckenrahmens war eine Kleinigkeit. Dann wurde der Deckenrahmen genau über dem Bodenrahmen mit wenigen Nägeln an die Dachsparren festgemacht, dazwischen sollten die zwinglich eingespreizten Ständer nach oben und unten ihren Druck ausüben. Liesel klatschte in die Hände, als das Gerüst festgefügt stand: „I siach schon das Kammerl im vorhinein.“ Jetzt ging ein lustiges Hämmern an. Das Annageln der oberen Enden der Seitenbretter nahm der Heger auf sich, während gleichzeitig Franzel unten nagelte. Bertel und Sepperl nahmen die niedre Rückwand in Arbeit. Liesel reichte Bretter und Nägel zu. Durch solches Zusammenarbeiten aller wuchsen die Wände schnell. Als die Hegerin zum Mittagmahle rief, war auch die Vorderwand fertig bis auf den breiten Einlass, in den die Tür hineinkommen sollte. — Beim Essen wusste diesmal keines, was es auf dem Teller hatte. Ein jedes schaute innerlich, was noch zu schaffen war und wie das Ganze aussehen sollte. In das Hin und Her der einander drängenden Vorhersagen der Kinder brachte der Heger Ordnung. „Zweierlei muss zugleich g’schehn: Stukkaturrohr muss g’schnitten werden und Sand und Kalk muss eingetragen werden; vom gelöschten Kalk is nit g’nug in der Gruben. Da holt eins mit dem Schubkarren ein Schaffel voll gebrannten Kalk vom Roten Hiasel; der hat ung’löschten im Schuppen.“ Bertel meldete sich: „Der Franzel und i schaffen Sand und Kalkher;“ und Liesel: „I geh’ Schilf schneiden mit’n Sepperl.“ — Nach dem Essen rückten die Kinder aus. Und lange vor der Jause hatten sie alles beisammen. Bertel, der schon öfter seinem Vater bei der Maurerarbeit Handlangerdienste geleistet hatte, übergoss in einem Trog den gebrannten Kalk mit Wasser, horchte ein Weilchen, ob die Brocken singelten, und überliess den Kalk der Einwirkung des Wassers, bis er an der Dampfentwicklung merkte, dass er sich erhitzte. Dem Franzel gab er ein langgestieltes Scharreisen in die Hände und stellte ihn zum Umrühren an. Unter Brodeln und Spritzen bildete sich schön weisse Kalkmilch.
Bertel rief die Schwester und den Sepperl zu sich und zeigte ihnen, wie sie die Rohrhalme mittels alter Drähte flach aneinanderbinden sollten, damit beim Aufnageln mit den Nägeln gespart werden konnte. Sie flochten handbreite Streifen und begannen, das Innere der Seitenwände damit zu bekleiden.
Er selbst übernahm das Stukkaturen der Decke. Auf umgestülpten Kisten stehend, hämmerten die drei Kinder drauf los. Und als Franzel mit der Meldung heraufkam ,,die, Milchsuppenʻ is ang’richt,“ ging Bertel mit ihm hinunter: „Jetzt mach’n m’r a Griaskoch draus. Ein Schaffel Kalk hab’n m’r drin, jetzt noch drei Schaffel feuchten Sand dazu; rühr’alles fein durcheinand und dann bring’ mir ein Schaffel voll hinauf!“ Wieder oben angekommen, trieb er die Hämmernden an: ,, Tummelts enk, tummelts enk, der Franzel bringt glei’s Malter.“ — Da schrie Liesel auf. „ Au weh!“ und steckte den Daumen der Linken in den Mund. Sie hatte sich mit dem Hammer darauf geschlagen. Bertel besah die entstandene Blutblase, hauchte darauf und gab ihr den Rat: „Tu so, als ob’s nix wär’; bei der Arbeit vergisst d’ drauf.“ — Und weiter ging das Klopfen um die Wette. Auf einmal aber lagen die Hämmer stille. Die Stiften waren ausgegangen. Jetzt stülpte Bertel das Nagelkistchen um und alle drei krabbelten die kürzesten Nägel heraus und hämmerten die krummen gerad. Weiter ging die Klopferei. Die Decke und der grösste Teil der Wände waren mit Schilfhalmen benagelt, da kam auch schon Franzel angekeucht mit dem Mörtelschaff. In der Werkzeugkiste fand sich wohl ein Maurerpinsel, eine Schöpf- und eine Anwerfkelle, auch ein Polierholz. Aber das langte nicht zum gleichzeitigen Arbeiten aller; da mussten noch zwei rostige Blechlöffel herhalten, mit denen Sepperl und Liesel arbeiten sollten. Bertel machte aus je zwei steil aufeinander genagelten Paaren von Lattenabfällen noch zwei Polierhölzer und traf die Vorbereitung zum Anwerfen des Mörtels. Er holte sich einen Topf Wasser und besprengte damit reichlich die Stukkatur, damit der Mörtel gut hafte. Und den Franzel lernte er an, wie er mit dem Polierholz ihm nacharbeiten sollte, dass der am Rohr haftende, es umschliessende Mörtel glatt verrieben würde.
Im Eifer der Arbeit hatten die Kinder überhört, dass sie zur Jauf e geruf en worden waren. Da kam die Hegerin über die Stiege herauf und brachte ihnen auf einem Tragbrett die Kaff eehäf erln und Butterbrote. „ So fleissige Zimm’rer und Maurer hab’ i no nit g’s ehn, die auf die Jaus en vergess en. — G’schwind Händ’ was chen und ess en! — Schön wird das Kammerl, wohl. Aber euer G’wand! Wie schaut denn das aus!“ — Sie holte vier von ihren alten Schürzen und band sie den Kindern vor, dass sie ihnen vom Hals e bis zu den Knien niederhingen. Nun sa ssen die kleinen Hand-werker auf einem Trambaum nebeneinander und liessen sich’s schmecken. Dann aber gingen sie die Arbeit mit erneutem Eifer an. Als alle Wände mit Rohr benagelt waren, teilten sich die drei Knaben ins Bemörteln und Glätten, und Liesel reichte ihnen in alten Blechtöpfen den Mörtel zu. Aber s o flink sie auch Hand in Hand arbeiteten, sie konnten das Stübchen am s elben Tage nicht f ertigbringen. Es fehlte die Türe.
Die Dämmerung machte aller Arbeit ein Ende. Als beim Abendmahl die Frage der Nächtigung beraten wurde, vers uchte Franzel mit seinem Vorschlag durch- zudringen: „Wir schlafen im Heustadel.“ Der Heger aber blieb dabei, sie sollten auf dem Hausboden schlafen. Zwei Strohsäcke wurden mit Heu gefüllt und auf dem Boden mit Kisten s o umstellt, dass ein wind- geschützter Winkel entstand. Überdies befestigte der Heger einen alten Bilderrahmen s amt Glas mittels Reiberschrauben s o vor der Giebelluke, dass ei n ge- schloss enes F enster, entstand. Mit F ederpolstern unter den Köpfen, Sepperl mit einer Tuchent1 , Franzel mit des Hegers altem Pelz zugedeckt, schliefen die Brüder vor Müdigkeit, dass sie das Rascheln und Knuspern der Mäuse am Korn nicht hörten. Nicht einmal das Miauen der Hauskatze, die vor dem ungewohnterweise geschlossenen Dachfenster Einlass begehrte, weckte die Schläfer. Schon frühmorgens stand der Heger mit den Knaben an der Hobelbank im Holzschuppen. Er bezeichnete die Schnittlinien der Bretter und Querlatten, aus denen die Tür gefertigt werden sollte, und unterwies die Knaben im Gebrauch des Hobels. Aber nur Bertel und Sepperl teilten sich in die Herstellung der Tür. Franzels Aufgabe war, aus alten Fassreifen die Angelbänder für die Tür herzustellen. Er hatte in den Hammerwerken an der Erlaf den Schmieden genug abgeguckt und vom Vater viel Bastlervorteile erlernt, dass er sich zu helfen wusste. Mitten im Hof entzündete er zwischen Ziegeln ein Holzfeuer, das zum Anglühen eines alten, drei Finger breiten Fassreifens dienen follte. Und Franzel begann seine Schmiedearbeit. Er schleppte sich den Hackstock ins Freie und legte den an einer Stelle angeglühten Fassreifen darauf. Während ihm Liesel denselben mit der Zange hielt, setzte er einen Breitmeissel an und schlug mit dem Hammer darauf, dass der Reifen zerschnitten wurde. So zerlegte er ihn geschickt in sechs Bänder von halber Armlänge. Diese erhitzte er in der Mitte und bog sie so um, dass jeder im Umbug einen federstieldicken Eisennagel umklammern konnte. Er glühte die aufeinandergelegten Hälften eines Bandes an, setzte den Nagel mit der Spitze darauf und schlug ein Loch durch beide Bandhälften. So brachte er in jedem der drei Bänder je drei durchgehende Löcher an. Zwei dieser Angelbänder wurden in der Nähe des oberen Randes der Tür, zwei unten an die Tür geschraubt, und zwar so, dass zwischen je zwei Bandbügen ein dritter Raum hatte. Das dritte Band aber wurde nach genauer Einpassung der Türe in den Rahmen so an den rechten Türständer angeschraubt, dass der Umbug als Nagelöse genau zwischen die Ösen der Türbänder passte. Dann steckte Bertel durch die oberen drei Ösen den Nagel und einen zweiten durch die unteren drei. Und jetzt war die Freude gross! Die Türe liess sich richtig in ihren Angeln drehen, sie ging auf und zu, auf und zu! — Das war eine Freud’!
Nun aber galt es, die Türe verschliessbar zu machen, wenn auch nur, um dem Luftzug den Weg zu verlegen. Franzel kramte im Eisenvorrat des Hegers, fand aber keinen Riegel, keine Klinke, nichts, was zum Gebrauch fertig gewesen wäre. — Da half er sich mit einem Holzriegel: In eine zwei Spannen lange Latte aus Hartholz schnitt er auf einer Schmalseite seichte Kerbe ein. Er brachte an der Tür und am Eckständer winkelig gebogene Bänder an, zwischen denen und der Tür der Riegel leicht hin und her geschoben werden konnte. Eine Handbreite über der Mitte des Riegels bohrte er ein Loch in die Türe. Jetzt galt es, einen Haken herzustellen, der, von aussen durchs Loch gesteckt, den Riegel schieben sollte. Dazu taugte wohl ein rechtwinkelig gebogener starker Draht, den Franzel mit einer ringförmigen Handhabe versah. Mit dem so entstandenen Hakenschlüssel waren vom Loche aus die Zähne des Riegels erreichbar. Aber es ging nicht, wie der kleine Erfinder wollte. Zwar schob der Haken den Riegel einen Zahn weit, dann aber spielte er in der Luft. Nun beguckten die vier Kinder ziemlich ratlos das offenbar misslungene Schloss. „Jetzt stehn m’r da wie die Eseln am Berg,“1 meinte Bertel. Da griff Liesel nach dem Schlüsselhaken, zog ihn heraus, steckte ihn hinein und drehte ihn spielend herum. Und siehe da: Bei der zweiten Umdrehung schob er den zweiten Zahn, bei der dritten den dritten; und der Riegel bewegte sich weiter. Und ebenso liess er sich zurückschieben. Da gingen die drei Buben in die Kammer, um zu beobachten; und Liesel blieb draussen, um das Zu- und Aufsperren auszuproben. Der Riegel griff hinter den Eckständer, die Tür war verschlossen. Dann sperrte sie auf. „Es geht, es geht!“ riefen alle und freuten sich so, als wäre jeder einzelne der Erfinder des Schlosses gewesen. Das war ein Ereignis! Sie brauchten jemand, der ihre Freude teile. Da rief Liesel die Mutter herauf. Die musste alles liegen und stehen lassen und die Erfindung bewundern. Jetzt erst war das Dachstübchen fertig. Die Kinder zappelten schon darauf, es wohnlich einzurichten. Aber es musste noch geweisst werden. Da verdünnte Bertel gelöschten Kalk mit Seifenwasser, band den Maurerpinsel an eine lange Stange und begann damit die Wände zu streichen. Der erste Anstrich war nur ein fahriges Hin und Her von grauen Pinselstrichen; der Grund schimmerte durch. „Oajeh! häst es liaber lass en wia’s war,“ meinte Sepperl verächtlich. Bertel fuhr herum: „Siehst denn nit, dass das erst grundiert ist?“ Die Hegerin rief die Kinder zum Essen: „Werkleuť, kommts, heut’ gibt’s G’selcht’s mit Sauerkraut und Knödeln.“ Die Kinder stürmten die Stiege hinunter. Jetzt erst wussten sie, dass sie Hunger hatten. Vorher war es keinem eingefallen, dass diesmal das zweite Frühstück ausgeblieben war. Da kam auch schon der Heger heim und lobte, was die Kinder gearbeitet hatten. Beim Mittagessen sprach er wohlgelaunt den Pflegekindern seine Anerkennung aus: „Findig seids und d’ Arbeit g’freut euch; da is mir nit bang, dass ihr als richtige Gschaider in d’ Höh’ kommt.“ Bertel und Franzel nahmen die Arbeit früher auf als Liesel und Sepperl, die der Mutter zur Hand gingen. Als sie nach einer Weile den andern auf den Boden folgten, war der zweite Anstrich beinahe fertig. „So bleibt’s?“ fragte Sepperl, noch immer nicht zufrieden. „Schau dir’s in ein paar Tagen an, wann’s trocken is,“ versetzte Bertel etwas gekränkt. „Js ja ’s Malter drunter no feucht.“ Jetzt wurde alles aus der fertigen Stube geräumt, was an Werkzeugen und Geräten herumlag. Liesel fegte den Boden rein. Und die Brüder wollten schon mit ihren Strohsäcken einziehen. Da kam der Heger die Stiege herauf: „Vom Einzieh’n is noch lang ka Red’. Es is no zu viel Feuchtigkeit im Anwurf. Wollts doch nit krank werden?“ Dabei stocherte er mit der Stiefelspitze im brüchigen Lehmbelag des Bodens, dass der Staub aufflog. „Und so kann der Boden nit bleiben; sonst fressen euch die Flöh’!“ „Wie denn das?“ fragte Sepperl. „Aus’n Staub werden doch die Flöh’,“ belehrte ihn Franzel und dachte dabei: „Die Mutter hat’s g’sagt.“ Aber das Gedenken tat ihm so weh, dass er verstummte. „Es is was dran, was der Franzel sagt,“ erklärte der Heger. „In den Staub legen nämlich die Flöh’ ihre Eier.“
Nachdenklich sahen alle den geringen Rest von Brettern an, der noch da war. „Zum Bretterboden langt’s nit,“ äusserte sich Bertel. „Und Zement wär’ jetzt schwer zu haben,“ sagte der Heger. — „Lahm tuats aa und er springt nit, wann m’r an kurzen Kuhmist drunter mischt. I hab’ zuag’schaut, wias beim Pichlbergbauern die Tenn herg’richt’ haben zum Haberndreschen,“ erklärte Franzel. „Dann gehn m’r ’s an,“ riet Bertel. Im selben Trog, der zum Mörtelanmachen gedient hatte, rührte er Lehm mit Wasser an, Sepperl und Franzel brachten in Kübeln Kuhfladen aus dem Stall und dann rührten alle vier Kinder mit Latten den dicklichen Brei sorgfältig durcheinander, bis er zähe und bindig wurde. Der Dachstubenboden wurde mit Wasser besprengt, der Lehmbrei schaffelweis darauf geschüttet, mit den Polierbretteln glattgestrichen, geschlagen und wieder geglättet, bis er schön eben war und fugenlos den Wänden anlag. Indessen war die Dämmerung angebrochen, das Tagwerk war zu Ende.
Als die Hegerin mit der Zubereitung des Abendmahls beschäftigt war, sammelte sich alles im Lichtkreis der Lampe. Die Kinder unterhielten sich damit, die Hautporen ihrer Hände durch Bertels Vergrösserungsglas zu begucken. Huscherl, die Hauskatze, sass vor dem Alschenloch im Bereich der strahlenden Wärme. Neben ihr lag Treff; seine Augen folgten den Bewegungen der Hegerin; er war darauf gefasst, dass sie ihn wegjagte. Wieder hörte er sie schelten: „Müssts denn ausgerechnet grad mir im Weg sein, ihr Viecher?“ — Der Hund tat, als ginge ihn die Frage nichts an. Ab und zu kratzte er sich mit einer Hinterpfote, was ihm die Drohung eintrug: ,,I wer’ di glei’ stampern, du Flohbeutel, du.“ Dann nahm er wieder eine seiner Vorderpfoten ins Maul und biss daran herum. Das fiel dem Heger auf; er wendete sich zu seinem Buben: ,,Geh, Bertel, hol’ mir die Teersalbe aus dem Werkzeugkammerl; weisst die, mit der wir den alten Küon eingerieben haben; nimm auch das Petroleumkandel mit.“ Bertel brachte das Verlangte. Der Heger verdünnte die Salbe mit etwas Petroleum und begann dem Hunde damit die Pfoten zu bestreichen.
„Beim Küon hat die Räude zwischen den Zehen angefangen. Da in den Hautfalten haben die Milben ihre beste Zuflucht gehabt.“ — „Wie schaun denn die Milben aus?“ fragte Liesel. — „Garstige, borstige, winzige Viecherln sind’s, viel, viel kleiner als die Flöh’; man kann s’ nur durch ein starkes Vergrösserungsglas sehn. In der Jagdzeitung sind s’ aufgezeichnet.“ — Der Heger brachte das Heft und schlug den Aufsatz über „Ungeziefer als Krankheitserreger“ auf. Brrr, wie hässlich waren da die vergrösserten Bilder der Krätzmilben, der Flöhe, der Flohlarven, der Federläuse! Da erinnerte sich Sepperl, dass der Heger gesagt hatte, die Flöhe legten ihre Eier in den Staub. Er verliess die Stube und brachte aus der Hundshütte eine Handvoll Strohzerreibsel und Staub; das gab er auf ein Stück Papier und rückte die Lampe heran. „Das ist aus der Hundshütten; da müssen Floheier drin sein.“ — Liesel hatte sich des Vergrösserungsglases bemächtigt, die anderen Kinder zappelten vor Ungeduld. Franzel aber sah schon mit freiem Auge gleich dreierlei. Eine erbsengrosse Zecke. „Der Zeck ist so dick, weil er sich sattgesoffen hat mit Blut vom armen Treff; und der da, der magere, ist noch hungrig. Und da ist ein Weberknecht, der ist tot, den hat der Treff zerdruckt.“ Der Heger schob das langbeinige Spinnentier aus dem Zerreibsel aufs reine Papier: „Der Weberknecht ist kein Ungeziefer. Der ist als guter Freund zum Treff in die Hütten gekommen. Der hat wollen die Milben wegfressen.“ — „Der is ja über und über voll rote Punkterln!“ rief Bertel und nahm der Liesel das Glas aus der Hand. „Und die roten Punkterln sind lebendig!“ Jetzt nahm der Heger das Glas. „Das sind ja lauter junge Samtmilben, ,Glücksspinnen‘ nennen s’ die Leut. Als Schmarotzer haben sie Blut gesaugt am Weberknecht. Seine Aufgab’ist’s, die Milben zu fressen, und wenn er ihrer nicht Herr wird, plagen sie ihn.“ Das Glas ging von Hand zu Hand. Die forschenden Augen der Kinder entdeckten im Staube winzige borstige wurmartige Tierchen. „Das sind die Jungen von den Flöhen, so wie die Raupen die Jungen sind von den Schmetterlingen.“ Auch weissliche Kügelchen fanden sie im Staube, kleiner als Grieskörner. „Das sind die Floheier.“ Liesel war entsetzt. „Der arme Treff! Wie könnt’ mer ihm helfen von dem Ungeziefer?“ — Mach’ ihm die Hütten rein!“ gab der Vater zur Antwort. „Ausreiben?“ fragte Liesel. „Noch besser auskalten. Weisst, liebe Liesel, die Kalkmilch ist eine gar scharfe Lauge, die bringt das Ungeziefer um. Es gibt allerhand, von dem das Ungeziefer hinwerden muss. Da ist einmal die Seifenlauge, dann Teer, Karbol, Lysoform, Petroleum; aber übers Auskalten geht nix; das macht auch keinen üblen Geruch.“ — „Drum kalk’ ich ja auch den Hendeln die Legnester aus, dass die Milben nicht überhandnehmen,“ mengte sich die Mutter ins Gespräch. „Und ich streich’ doch in jedem Herbst die Obstbaumstämm’ mit Kalkmilch, damit die Ungeziefer-Eier und Puppen hin werden,“ bemerkte der Heger und holte zu einer Belehrung aus, wie er sie bei jeder Gelegenheit den Kindern zu geben pflegte. — Er hob das Vergrösserungsglas und begann: „Schaut euch einmal das Vergrösserungsglas an. Wer’s erfunden hat, weiss ich nicht. Geschliffen hat’s irgendein Glasschleifer in einer böhmischen Glasfabrik. Mit dem Glas habt ihr das winzige Ungeziefer gesehen, das ihr mit freiem Auge nicht hättet sehen können. Und jetzt wisst ihr, wie dem Hund zu helfen ist.“ „Ich kalk’ ihm die Hütten jede Woche einmal aus,“ unterbrach Bertel.
„Die gelehrten Herren, die Doktoren und Professoren, die Naturforscher, haben, noch viel bessere Vergrösserungsgläser. Damit haben sie herausgebracht, was für winziges Ungeziefer auf Menschen und Tieren, ja sogar in ihnen lebt, und sie sind darauf gekommen, dass Menschen und Tiere vom Ungeziefer krank werden.“ — „Die Gelsen impfen den Leuten das Sumpffieber ein,“ warf Liesel dazwischen. „Ja,“ fuhr der Heger fort, „und Läus’, Flöh’, Milben, Wanzen, Fliegen, auch andre noch viel, viel kleinere Schmarotzer wandern von Kranken auf Gesunde und machen sie krank. Die Doktoren sagen: Sie infizieren die Gesunden mit der Krankheit. — Da hilft nix, als die Schmarotzer umbringen mit allerhand scharfen Mitteln; das heisst desinfizieren. Auf schmutzigen Händen, besonders im Schmutz unter den Fingernägeln gibt’s allerhand Schmarotzer und Gi fte, die Krankheiten erregen. —
So mancher Mensch ist an Blutvergiftung
gestorben, weil er sich ein Wimmerl aufgekratzt hat.“
„Aha! jetzt versteh’ ich, warum der Oberlehrer
agner s o scharf darauf schaut, dass die Kinder
rein in die Schul’ kom- men,“ warf Liefel ein.
„Erst vorgestern hat er einem zugesiedelten Buben
mit Seife und Bürste die Händ’ gestriegelt, dass der
geflennt hat. Und wenn ein Mädel Ungeziefer im
Haar hat, ladet der Oberlehrer die Mutter vor; er
duldet nicht, dass von einer die anderen das
Ungeziefer kriegen könnten.“ — „Und jetzt verstehst du
auch, liebe Liefel, warum wir jede Woche am
Samstag die Wohnung gründlich rein machen,“
sprach die Hegerin darein, ,, und warum ich als
Mutter gar s o versessen bin auf eure Reinlichkeit.
Die Reinlichkeit ist ja die halbe Gesundheit. — Jetzt
aber ist’s genug
mit dem Diskurs. Jetzt wird aufgedeckt zum Nachtmahl. — G’schwind, g’schwind die Händ’ waschen vorm Essen!“ Da knüllte Bertel das Papier mit dem durchforschten Staub zusammen und steckte es ins Herdfeuer.
Während des Händewaschens mahnte Liesel den Franzel: „Seif’ die nur die Händ’ brav ein; hast ja g’hört, dass die Seif’ desinfiziert.“ —
Nach dem Abendmahl aber trugen die Kinder die Hundshütte in die Mitte des Hofes, fegten alles alte Stroh samt dem Staube heraus und zündeten es an. Liesel wusch den Boden der Hütte mit Seifenwasser ab, rieb ihn trocken und machte dem Treff ein reines Bett von frischem Stroh. Morgen sollte die Hütte gekalkt werden.
Als die Kinder in aller Frühe die Dachstube betraten, waren sie entzückt von dem freundlichen Raum. Da Bertel am Vorabend das Fenster geöffnet hatte, war die Luft frei durch den Raum gestrichen. Die Wände zeigten beim Trocknen grosse, lichte, gleichmässig weisse Flecke, und Sepperl hatte nichts mehr zu tadeln. — Wiewohl die Kinder wussten, dass die Dachkammer erst in einiger Zeit bezogen werden sollte, brannten sie doch schon darauf, dieselbe mit dem notwendigsten Gerät auszustatten, ehe der Weg nach Aspern wieder gangbar wurde und das Schulgehen einsetzte. Liesel aber bestand darauf, dass zuerst Treffs Hütte ausgekalkt wurde, damit sie trockne, während er mit dem Vater Dienst machte. Da taten sie ihr den Willen. Dann aber überlegten sie, was alles notwendig war; zwei Bettgestelle, ein Tischchen, zwei Sitzgelegenheiten, zwei Wandbretter, zwei Kleiderrechen und etwas zum Unterbringen der wenigen Wäsche. Aber an Brettern war schon Mangel, da mussten Rundhölzer dran. Davon gab es hinterm Haus einen grossen Vorrat, da der Heger das selbst geschlagene Holz frei hatte. Und Bertel wusste, dass er davon nehmen konnte, was nötig war. Nun suchte er zunächst armdicke, gut ausgetrocknete Rundhölzer hervor zur Herstellung der Bettgestelle, die wegen des kleinen Raumes nur 7 Dezimeter breit werden sollten. Auch brauchten sie nicht hoch zu sein, nur musste der Bettrost so angebracht werden, dass darunter hervorgewischt werden konnte. Mit dem Vormessen wartete Bertel nicht auf den Vater. Er bezeichnete zunächst die Schnittstellen für die meterhohen Ständer, dann für je zwei Querhölzer am Kopf- und Fussende und für je zwei Langhölzer von 2 Meter Länge. Er dachte voraus, dass Franzel und Sepperl die Betten benützen sollten, auch wenn sie schon grosse Männer geworden wären. Kaum hatte er die Schnittmarken mit dem Taschenmesser eingekerbt, als das Sägen um die Wette begann. Weil aber nur drei Sägen da waren, ging Liesel leer aus. Ihr blieb Zeit, die Frettchen zu füttern, die im Kuhstall ihre Wohnkiste hatten.
Wenn drei Sägen zugleich arbeiten, geht es geschwind. Und in der Morgenkühle hat jeder Lust an hurtiger Bewegung, denn die hält warm. Ehe eine Stunde verging, lagen die 16 Hölzer zugeschnitten und so aneinandergereiht auf dem Erdboden, wie sie gefügt werden konnten. „Erstmüss’n m’r in die Ständer der Kopf- und Fussteile Querfalze einschneiden,“ begann Bertel seine Erklärung und zugleich das Anzeichnen mit dem Taschenmesser. „In jeden Ständer aussen auf der Schmalseite zwei Querfalze bis zur halben Dicke tief zum Einlassen der Breitenhölzer, dann einen Fuss hoch überm Boden je einen Querfalz zum Einlassen der Langhölzer.“ Das Ansägen der Falze besorgten Franzel und Sepperl. Zum Ausstemmen des Angesägten legte sich jeder Meissel und Hammer zurecht. Bertel schleppte die Hanselbank1 aus dem Schuppen, klemmte ein Breitenholz auf und zog mit dem zweigriffigen Schnitzmesser auf drei Seiten jedes Endes die Rundung ab, so dass es in der Dicke der Falzbreite rechtwinkelig gekantet in den Falz passen musste. Er fuhr fort, bis alle Breiten- und Längenhölzer gekantet waren. Von Liesel verlangte er, dass sie wieder Nägel zurichte. Da zeigte sich aber, dass viel zu wenig lange Nägel vorhanden waren. Es blieb also nichts übrig, als alles mit Holznägeln zu verbinden. Dazu taugte aber nur Eichenholz. Liesel musste aus dem Brennholzvorrat glattfaserige Scheitchen heraussuchen, die auf fingerlange Klötzchen zersägt werden sollten. Indessen war die Zeit des zweiten Frühstücks gekommen, die Hegerin rief die Kinder in die Küche. Sie war gerade beim ,,Schmalzauslassen“ und hatte das flüssige Fett von den Grieben gesiebt. „Heisse Grammeln aufs Brot!“ — „Meine Leibspeis’,“ liess sich Sepperl vernehmen und lachte übers ganze Gesicht. „Die meine aa, meine aa!“ scholl es von allen Seiten. Es schmeckte den Kindern so, dass sie sich darnach die Finger leckten.
Die Reste der Brote in den Händen, kehrten sie auf ihren Werkplatz zurück. Als sie wieder in voller Arbeit waren, kam der Heger auf einen Sprung nach Hause. Auf der Schwelle trat ihm sein Weib entgegen: „Schau dir’s an, die Gaminger Buam, wia’s wurksen1 .“ — „Und dabei vergessen s’ ganz, dass’ no vorgestern arme Waserln waren. Es gibt nix Bessers gegen die Traurigkeit als arbeiten, schaffen.“ — Mit seinem Grammelbrot trat der Heger zu den jungen Werkleuten. Als er sah, dass Bertel die Eichenklötzchen in kleine Pflöcke zerspaltete und einen davon zu einem Holznagel zurechtschnitzte, nickte er: „Holznägel halten besser als eiserne, aber einleimen müsst ihr’s, heiss einleimen.“ Damit ging er ins Haus, holte ein paar Blätter braunen Leim aus einer Lade, zerschlug sie in einem alten Tuch, dass die Splitter nicht herumspringen konnten, tat sie in den gusseisernen Leimtopf, goss Wasser darauf und stellte den Topf in einen grösseren Topf mit Wasser. „So, Mutter, lass den Leim im Wasserbad heiss stehen, dass er zergeht und nit verbrennt. Die Kinder werden ihn bald brauchen.“ Dann suchte er drei ungefähr kleinfingerstarke Bohrer und brachte sie den Kindern: „Aber bohren müsst ihr erst, wenn die Hölzer verfalzt sind.“ Mit dem frohen Bewusstsein, dass die Kinder bei ihrem eifrigen Schaffen am besten aufgehoben waren, ging er wohlgemut seinem Dienste wieder nach.
Als das Falzen und Einpassen der Hölzer an den Kopf- und Fussteilen geschehen war, knieten die drei Buben auf ihren Werkhölzern nieder, um sie gut in den Falzen zu halten, und begannen mit der harten Bohrarbeit, die ihnen den Schweiss auf die Stirnen trieb. Und so oft ein Loch fertig gebohrt war, wurde ein genau auf die Lochweite zugeschnitzelter Holznagel vorläufig leicht hineingesteckt. Dann erst kamen die starken Langhölzer an die Reihe, wobei Sepperl und Liesel haltend mithelfen mussten, da die Längenhölzer in die steilgestellten Kopf- und Fussstücke eingepasst und dann erst gebohrt werden mussten. Als ein Bettgestell richtig auf vier Beinen stand, rüttelte Bertel daran. „Es gogelt! — Zwei Streben an jeder Seit’ kunnten nit schaden.“ — Damit waren alle einverstanden. Und Bertel bezeichnete die Stellen, wo an den Ständern und Langhölzern schräge Falze eingeschnitten werden mussten zur Aufnahme der Stäbe, die Kopf- und Fussteil mit den Seiten gut im Winkel halten sollten. Als auch das zweite Bettgestell fertiggestellt worden war, wurden beide zerlegt und in die Dachstube hinaufgetragen. Dann brachte Liesel den Leimtopf im heissen Wasserbad. Und nun begann das Aneinanderleimen. Erst wurden die Falzflächen bestrichen, dann die Hölzer ineinander gepasst, dann jeder Holznagel in flüssigen Leim getunkt und mit dem Hammer eingetrieben. Als die Bettgestelle standen, schob Bertel eine grosse Kiste ans Fenster mit der Öffnung einwärts und stellte eine kleinere davor als Sitzgelegenheit. Jetzt hatte die bisher kahle Stube plötzlich das Aussehen eines bewohnten Raumes.
Noch wollten die Gaminger Brüder Kristen zermachen, um die nötigen Querbretter zu gewinnen, die, den Längshölzern angelegt, die Strohsäcke tragen sollten. Da wehrte Bertel ab: „Nit anrühren! zwei Tag lang nit anrühren dürft ihr die Betten, bis der Leim steif ist.“ Von Aspern herüber tönte das Mittagläuten. Der Heger und sein Weib wurden zur Besichtigung der getanen Arbeit eingeladen. Und sie kargten nicht mit ihrem Lob. Den kleinen Zimm’rern und Tischlern, Maurern und Schmieden schmeckte das wohlverdiente Essen und dabei guckte eines dem andern vergnügt in die Augen: ,,Hab’ ich brav mit getan? han?“ Nichts bringt die Menschen einander näher, als einträchtige Arbeit, die wunderbar vonstatten geht, weil einer dem andern in die Hände arbeitet. Kein Kind sagte dem andern: „Ich hab’ dich lieb.“ Aber sie fühlten es alle, dass sie zusammengehörten als gute Arbeitsgemeinschaft.
Am Nachmittag gab es noch genug zu tun. Die Wandbretter mit dreieckigen Trägern wurden getischlert und die zwei Kleiderrechen, die nichts andres waren, als hälftig gespaltene Rundhölzer, in die je fünf Holznägel eingeleimt waren. Das Anbringen starker Drahtschleifen und Wandhaken zum Hängen war wieder Franzels Arbeit. Er hatte eine unverkennbare Vorliebe für Metallarbeiten.
In den nächsten zwei Tagen richteten die Knaben die Querbretter für die Bettböden zurecht und nagelten sie auf starke Langhölzer, die den unteren Querhölzern des Kopf- und des Fussendes aufliegen sollten. Dann bauten sie noch zwei dreibeinige Sitzstockerln, indem sie kurze dicke Bretter durchbohrten und zugespitzte Rundhölzer als Füsse einleimten. Liesel aber nähte aus alten Leinwandresten ein Tischtuch, damit die grosse Kiste einem Tische gleichsähe. Dann wurden die Bettrahmen mit den Tragbrettern belegt und die Strohsäcke und Polster herübergesiedelt. Franzel sprach das Bett zur Linken von der Tür als das seine an und hängte sein Wandbrett und den alten Wildererstutzen darüber. Sepperl suchte unter seinen Habseligkeiten ein Mariazellerbildchen heraus, das Maria mit dem Jesukinde vorstellte, und hängte es über sein Bett: „Was Heilig’s muass aa herin sein.“ Indes waren die Wände ganz trocken geworden, der Kalkanstrich war fleckenlos weiss und der Lehm-Estrich des Bodens war erhärtet. Nun hatten die Brüder ihre freundliche Dachkammer.
Als sie zum erstenmal drin schliefen, hatten sie so recht das Gefühl, im Hegerhaus daheim zu sein. Sie hatten sich ja die Stube selber gebaut und eingerichtet, und Bertel und Liesel hatten ihnen geholfen. Es kam der Sonntag und alle vier Kinder verbrachten die meiste Zeit in der neuen Stube, mit dem Ausräumen, Begucken und Einräumen der Habseligkeiten Franzels und Sepperls beschäftigt. Und sie ergingen sich in Plänen, was sie noch alles basteln wollten, dass es im Dachstübchen recht lieb und freundlich werde. Franzel aber hatte seinen Wildererstutzen vorgenommen. Er putzte ihn und ölte das Schloss. Aber o weh! Der Hahn wollte nicht einschnappen. — Den Taschenfeitel setzte er als Schraubenzieher an und zerlegte das Schloss. Da fand er, dass die Stahlfeder im Innern fehlte. Wer mochte die weggetan haben? Niemand andrer als der Hegervater. Da nahm sich Franzel vor, das Schlosserhandwerk zu erlernen, um eine neue Stahlfeder in sein Flintenschloss einzusetzen.
Der Steiger.
Bald waren die vier Kinder aneinander gewöhnt und fühlten sich als Geschwister, als wär’ es immer so gewesen. Es zeigte sich aber, wie grundverschieden die beiden Gaminger waren. Der grössere und jüngere der beiden, der blonde Sepperl, schloss sich mehr an Liesel an, half ihr in der Küche und beim Spielen mit der Puppe und liess sich von ihr zum Stricken und Häkeln abrichten. Der kleinere, um ein Jahr ältere, dunkelhaarige Franzel aber wurde der Arbeits- und Spielgenoss Bertels, mit dem er die Stall- und Hausarbeiten erledigte und in der gewonnenen Musse die neue Heimat durchstreifte. Das Wasser hatte sich vom Auwald und von den Wiesen fast ganz in seine schilfumbuschten Rinnsale zurückgezogen. Nur der staubgraue Überzug von Ton, denes auf Gräsern und Baumrinden zurückgelassen hatte, verriet, wie weit die Überschwemmung gegangen war. Die grauen Wiesen machten einen trostlosen Eindruck. Franzel sagte es dem Pflegebruder unverhohlen, dass ihn die neue Umgebung anödete. Immer wieder verglich er das Auland mit seinem geliebten Gamsgebirge. Hier der fahle Rasen, in dem nur vereinzelt verblühte Schneeglöckchen standen, von Primeln und Leberblümchen keine Spur! Graurindige, kahle Bäume und alles flach, alles eben. Dort im Gamsgebirg fichtenbegrünte Berghöhen, darüber von Schneebändern gestreifte Steinwände, mit gleissenden Firnfeldern bedeckte Hochgipfel und Bergrücken; als Riese unter den Bergen der breite Ötscher, der „Hetscherlberg“ mit seinen geheimnisvollen Höhlen, dem Geldloch, dem Taubenloch, der Eishöhle. Hier Sumpfland und stille, schilfdurchsetzte Wasser, dort murmelnde, rauschende Bäche mit springenden Forellen. Die Erlaf gischtete zwischen den felsigen Tormäuern und Stierwaschmäuern. Und zur Erlaf rieselten plaudernde Quellbäche nieder, ungezählte! In die Erlaf ergoss sich die Treffling als weissstäubender Wassersturz. Ihr eilte die Lassing zu, die mit Getös von turmhoher Felsenkante hinunterdonnerte. Im Moose des Bergwaldbodens wuchsen grossblumige Schneerosen, die schon zu Weihnachten ihre Knospen durch den Schnee bohrten und dann lange fortblühten, erst blendend weiss, dann rötlich und zuletzt gar grünlich. Die sonnigen Steinhalden waren schon zu Ostern rot von blühenden Heideln und blutroten Schlüsselblümchen; und auf den Rasenbändern der Felswände sprosste das gelbe Petergstam, die Goldprimel, eine Verwandte der Schlüsselblumen, von denen sie sich durch die fleischigen ganzrandigen Blätter, die mehligen Blütenschäfte und durch ihren Duft unterscheidet; die Leute nannten sie „Gamsveigerl“, weil sie gar so lieb duftet; unten am Waldesrand gab es Leberblümchen, die meisten dunkelblau; auf der Gaminger Schlossleiten waren auch rote und weisse. Und hoch droben im Gefels standen äsende Gemsen, die einen Steinhagel niederprasseln machten, wenn sie flüchtig hinwegsetzten über die Geröllhalden.
Wenn das Heimweh den Franzel so recht packte, suchte er den Bruder auf und stimmte mit ihm eines der Alpenlieder an, die sie in der Gaminger Schule gesungen hatten: das Holzknechtlied oder die Hahnbalz, ’s Almlüfterl oder den Almfrieden1 . Franzel sang die erste, Sepperl die zweite Stimme; leise begannen sie das Lied, liessen die Töne anschwellen und in stiller Wehmut verklingen:
Pedergstam, fein wia Gold,
Blüaht schon fruah unterm Schnee
Almrausch und Enzian
Drobn auf der Höh;
Edlweiss, Sternderl feins,
Bist’ leicht vom Himmel g’fall’n?
Bist unter d’Blüamerln doh
’s schönste von alln.
Hoch auf’n Felsenzock
’s Gamserl so lusti springt,
Und von meim Juchazer
’s Echo verklingt.
Und wann i furt muass bleibn.
Packt mi fest ’s Hoamweh an,
Halt mi mit aller G’walt,
Möcht’ glei davon!
Die vier letzten Zeilen hatten sich die Brüder eigenmächtig angepasst, wie sie’s jetzt fühlten. Anders hatten sie’s in der Schule gelernt; jetzt waren sie fort aus der Heimat; aber dem Heimweh waren sie nicht entgangen. Immer wieder war es Franzel, der von Gaming zu reden anfing wie von einer schöneren Welt.
Bertel beschlich ein Gefühl der Beschämung, wenn er Franzel die Herrlichkeiten seines Gamsgebirgs so rühmen und die geliebte Lobau schmähen hörte. Und er suchte sein Prahlen zu übertrumpfen.
Aber soviel er ihm auch von den rotgoldig und kupferig befiederten Fasanen erzählte oder gar von den Königsfasanen mit meterlangen Stossfedern, von den Rudeln der Rehe in den Stadlauer Auen, von den vielen Hirschen auf der grossen Insel Lobau, von den Kolonien der Fischreiher, der Krähen und Kormorane hoch oben in den alten Silberpappeln des Rohrwörth1 , er vermochte das Heimweh des Gebirglers nicht zu bannen, weil ihn der noch durchnässte Boden daran hinderte, den Franzel dorthin zu führen, wo das Wild seine Wohngebietehatte. Da zeigte er zunächst dem unzufriedenen Vetter in der Dammböschung die vielen mit Steinen verkeilten Kaninchenlöcher, aus denen der Vater mit Hilfe der zahmen Frettchen oft die „Künigl“ herausgetrieben hatte, und machte ihm Hoffnung auf die Teilnahme an der Jagd auf dieses Kleinwild, von dem der Heger unverrechnet abschiessen durfte, soviel er wollte. Dann zeigte er ihm von der Dammhöhe aus die Türme des Schlosses Kaiser-Ebersdorf, von dem aus Napoleon im Neunerjahr die Schiffsbrücke über die grosse Donau nach der Lobau-Insel geschlagen hatte, jene Schiffsbrücke, auf der das Franzosenheer vom rechten aufs linke Donau-Ufer hinübermarschiert war. Er erzählte ihm, dass die Österreicher die Brücke in Brand gesetzt hätten, und zwar durch brennende Schiffsmühlen, die sie stromabwärts treiben liessen. Aber, nachdem Napoleon sie hätte wiederherstellen lassen, wär’ die Donau arg angeschwollen und hätte die Brücke durch schwimmende Eismassen vernichtet.
Eines Tags gingen die Knaben stromaufwärts, immer auf der Dammhöhe, von der aus der Blick frei war über die grosse Wasserfläche. Noch war das Inundationsgebiet1 überflutet und einzelne Weidensträucher, die auf dem Schotterland wuchsen, wippten im ziehenden Wasser. Franzel, der zwar schon den ruhigen Erlaf-See, aber noch nie so viel strömende Flut gesehen hatte, machte grosse Augen.
Seine Blicke wanderten über die splitterige Wasserfläche hinüber nach dem ungeheuren Häusermeer der Wienerstadt mit dem Stephansturm und der Rotunde. Und als er den Leopolds-, den Kahlenberg und den Bisamberg erspähte, da rief er aus: Jöi, da san ja aa Berg!“ Er liess einen Jodler steigen, der weithin hallte über Wässer und Auen. Der Jauchzer des Bergbuben war auch im Buschwirtshaus des Roten Hiasels vernommen worden. Da kam Hiasel, der Bub des Wirtes, auf den Damm. Der Hegerbertel winkte ihn herbei. Hiasel und Franzel gefielen einander. Hiasel zeigte dem Neuen den Holzschuppen beim Haus, dessen Bretter von einer alten Schiffsmühle herrührten, die in der Franzosenzeit am Wasser gestanden war. Dann übernahm er die Führung ins noch feuchte Auland.