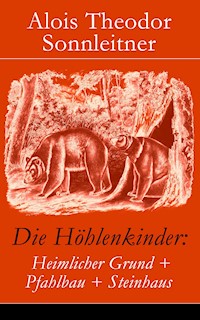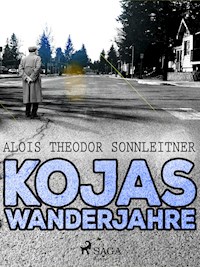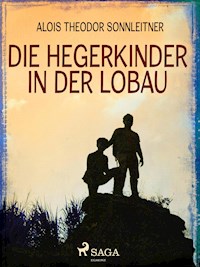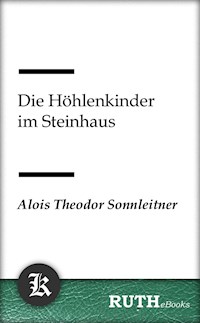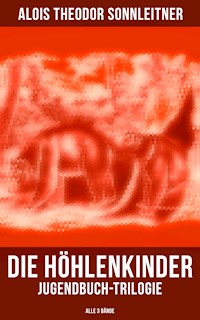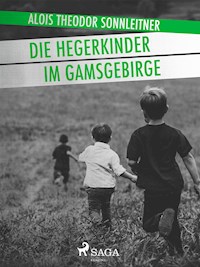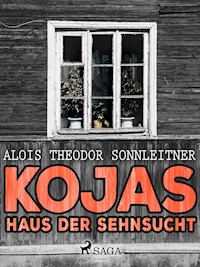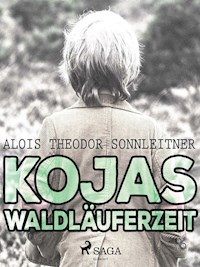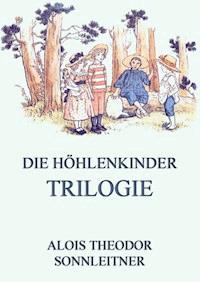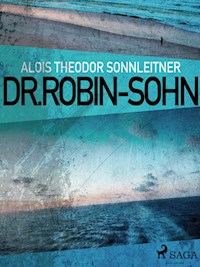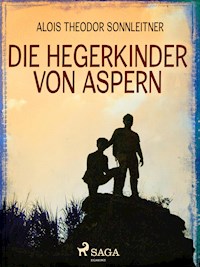
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Hegerkinder, das sind Hubert, genannt Bertel, zehn Jahre, und seine Schwester Liesel, neun Jahre alt. Mit ihrem Vater, dem Förster und Wildheger, und ihrer fürsorglichen Mutter wachsen sie in der Auenwildnis der Lobau an der Donau auf – heute ein Teil der Gemeinde Wien, damals, im Februar 1880, als die Handlung einsetzt, noch ein Stück urtümliche Natur, in dem es sehr viel zu entdecken und zu erforschen und zahlreiche Abenteuer zu erleben gibt. Und das tun die beiden Geschwister auch reichlich. Sie folgen den Spuren des Wildes und seiner Räuber im Wald, kümmern sich um Enten und um die Kühe im Stahl, erleben das Aufwachsen kleiner Küken, die ihre Mutter verloren haben, hautnah als Naturwunder mit, tollen draußen im eiskalten Winter, erfreuen sich der sprießenden Natur im Frühjahr und erleben, kurzum, die naturnahe Welt als eine Art ursprüngliches Paradies, auch wenn Not und Tod, Entbehrung, Leid und Kummer immer nur einen Schritt weit weg sind. Tiere, Pflanzen, Landschaften, Menschen, die ganze urwüchsige Welt der Wald- und Auenlandschaft entfaltet sich vor dem Leser und er erhält, ganz im Nebenbei, auch eine interessante und lehrreiche Einführung in die Naturkunde und geht fortan mit wacheren Augen durch die Welt. Wer zum Beispiel noch nicht weiß, was ein "Erdzwiesel" ist, sollte unbedingt zu diesem Buch greifen! Kurz: A. Th. Sonnleitners erster Band der Hegerkinder-Reihe ist ein wunderbares Buch über Natur und Mensch für Jung und Alt und die beiden Folgebände stehen dem ersten nicht nach.Alois Theodor (A. Th.) Sonnleitner ist das Pseudonym von Alois Tlučhoř (1869–1939), einem böhmisch-österreichischen Pädagogen und Schriftsteller. Tlučhoř, der einer böhmischen Bauernfamilie entstammte, ging am bekannten Gymnasium Melk in Niederösterreich zur Schule und studierte in Wien Philologie und Pädagogik. Nach seiner Promotion zum Dr. phil. arbeitete er zunächst als Fachlehrer, später als Direktor an einer Bürgerschule in Wien. Neben pädagogischen und sozialpolitischen Schriften veröffentlichte Tlučhoř unter seinem Pseudonym A. Th. Sonnleitner Gedichte, Märchen und pädagogisch wertvolle Romane – wie etwa die "Koja-" und die "Hegerkinder"-Trilogie. International bekannt wurde er vor allem mit seiner bis heute in zahlreichen Auflagen erscheinenden Trilogie "Die Höhlenkinder". Er starb am 2. Juni 1939 im Wiener Wilhelminenspital und wurde in einem Ehrengrab am Perchtoldsdorfer Friedhof bestattet.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alois Theodor Sonnleitner
Die Hegerkinder von Aspern
dem Verfasser der Höhlenkider
Mit Bildern von Franz Roubal
1. bis 36. Tausend.
Saga
Die Hegerkinder von Aspern
© 1923 Alois Theodor Sonnleitner
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711570067
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
An der Alten Donau.
Vom Damm gebändigt, fliesst im tiefern Bett
das schwere Wasser, Schiff’ und Flösse tragend.
Im Auland schimmern hohe Silberpappeln,
die schilfumrauschten Weiher überragend.
Da steht, von Stadt und Dorf und Weiler fern,
des Hegers Hütte in dem Wiesengrunde
auf niederm Hügel, und der Aue Bäume
umschützen sie vorm Sturme in der Runde.
Der Heger und sein Weib sind schlichte Leut’,
doch sind sie reich an stiller Elternwonne:
denn ihre beiden Kinder, die gedeihn
wie gut gehegte Äpfel in der Sonne.
Erzählen will ich, was das Inselreich
der Donauarme birgt an Lust und Leide,
das tausendfaches Leben speist und hegt
in Winterstarre und im Blütenkleide.
Erzählen will ich, was die kleine Welt
erschliesst an des Erkenntnisglücks Erleben.
Des Hegers Kinder sollen andern auch
von ihrem Freudenüberflusse geben.
Perchtoldsdorf, Auf der Sonnleiten, Mai 1923.
Bertel und Liesel.
Ein prickelnd kühler Februarmorgen des frostreichen Jahres 1880. Milchiges Dämmerlicht liegt auf den weich verschneiten Donau-Auen, die als flache kleinere und grössere Inseln von den schilfdurchsetzten Armen der Alten Donau still umflossen sind. Sie begleiten den Strom auf der Marchfelder Seite. Zwischen Aspern und dem Regulierungsdamm des neuen Donaubettes liegen der Grosse und der Kleine Biberhaufen; daran reihen sich viel kleinere Inseln und die grösste, am weitesten nordwärts bis nahe an Essling und Gross-Enzersdorf reichende Lobau. Von der hat dieses ganze Inselgebiet den zusammenfassenden Namen „Lobau“ erhalten. Hoch ragen die noch winterlich kahlen Silberpappeln, Rüstern, Ahorne und Weiden im Schmuck des weichen Neuschnees, der ihre Äste und Zweige mit polsterigen Lagen deckt; fast regungslos stehen sie da, noch von keinem Vogel beflogen; denn die vielen gefiederten Bewohner der Lobau sind in der unwirtlichen Winterzeit Langschläfer.
Aus den kleinen Fenstern des Hegerhauses, das unweit der Schanzen von Napoleons Hauptquartier zwischen dem Regulierungsdamm und der Alten Naufahrt auf dem Kleinen Biberhaufen steht, schimmert noch Lampenlicht. Der Holzrauch des Herdfeuers quillt träge aus dem breiten Kamin. Im schmalen, knietief vom Heger ausgeschaufelten und wieder halb verwehten Pfad stapfen seine beiden Kinder, ein Bub und ein Mädel, zur Schule nordwärts nach Aspern. Ein Stück Weges gibt ihnen Küon, der alte Jagdhund, das Geleite. Von der Höhe des flachen Haushügels ruft ihnen die Mutter übern Zaun nach: „Bertel, Liesel! — Nit lang ausbleiben, ’s wird zeitig finster!“ Sie drehen sich noch einmal um: „Eh nit! B’hüat Gott, Mutter, b’hüat Gott!“ Der zehnjährige Hubert bahnt den Weg und die neunjährige Liesel bemüht sich, ihre Füsse genau in seine Fussstapfen zu setzen. Ihr nach watet unverdrossen der alte Küon, wenn er auch im Schnee bis zum Bauche einsinkt. Die Kinder machen nicht den Umweg über den Regulierungsdamm und das Buschwirtshaus des „Roten Hiasels“ zum Biberhaufenweg; sie halten auf den Bug der Alten Naufahrt zu, deren verschneite Eisdecke für sie eine natürliche Brücke ist. So gelingt es ihnen, vom Kleinen auf den Grossen Biberhaufen hinüberzukommen. Bertel stülpt den Rand seiner Pelzmütze hinauf und streicht sich die etwas langen kastanienbraunen Haare ins Genick. Er knöpft seine Lodenjoppe auf. Liesel folgt seinem Beispiel. Den Kindern ist warm geworden. Unweit einer Franzosenschanze, wo eine kleine Heuraufe fürs Rehwild steht, nimmt Bertel den schweren Wollschal ab, mit dem ihm die fürsorgliche Mutter den Hals umwunden hat, und stopft ihn in seinen Schulranzen. Liesel wendet sich gegen den Hund, sie kauert sich vor ihm nieder, wischt ihm mit seinen grossen, schlaff niederhangenden Ohrlappen die tränenden Augen rein und redet ihm zu: „Geh, alter Küon, sei g’scheit, geh wieder heim zur Mutter, die braucht dich, musst brav wachten, dass kein Pülcher1 ein Henderl wegfangt, geh, geh!“
Küon bleibt ein paar Schritte zurück, geht aber doch wieder langsam den Kindern nach. Liesel dreht sich nach ihm um: „Wirst gehn?“ Da reckt sich der alte Hund, er gähnt, streckt seine magern Vorderbeine weit vor und biegt den Rücken durch. Dann setzt er sich auf die Hinterbeine, lässt den Kopf hängen und schaut traurig den Kindern nach. Wie gerne ginge er mit ihnen, weit, weit! Seit er als Ruheständler Torwarteldienst macht, nimmt ihn sein Herr nimmer mit, wenn er in den Busch geht. Dem Hundegreis ist sein selbstgewähltes Amt, den Kindern morgens auf dem Schulweg das Geleit zu geben und ihnen nachmittags ein Stück Weges entgegenzugehen, sehr wichtig. Diese zwei Gänge bilden in seinen Tagen, die er meist im Stroh seiner Hütte verdämmert, lichte Bewusstseinsstunden. Da bringt ihm ab und zu die Witterung von Rot- und Rehwild, von Kaninchen, Rebhühnern und Fasanen entschwundenes Erlebtes in Erinnerung. Einst, in schönen Jugendjahren, war er im Dienste eines vornehmen Herrn gestanden, war im Jagdwagen neben ihm gesessen und hatte im Revier mitgejagt; er hatte geschwelgt in Nasenfreuden und war geschätzt gewesen als unentbehrlich. Dann aber ist sein Herr eines Tages ganz still und stumm in einem schmalen Bett gelegen. Mit dem haben sie ihn aus dem Hause getragen. Ein Diener des Herrn ist Küons zweiter Herr geworden. Wie oft, wie oft ist der Hund mit dem Heger herumgestrichen in Busch und Ried, bis er alt geworden ist, alt und überflüssig, weil der stichelhaarige Treff als der Jüngere ihn aus dem Amte verdrängt hat. Aber die Kinder haben ihren Küon gern und auch er liebt sie mit seiner ganzen treuen Hundeseele.
Die Geschwister gehen ein Stück weit, dann drehen sie sich nach dem Hunde um. Der sitzt noch immer bei der Heuraufe und schaut ihnen nach. Da mahnt ihn die Liesel wieder: „So geh doch heim und leg dich in die Hütten; wärm s’ brav vor; das Huscherl wartet auf dich; es will heihei machen bei dir, dein liebes Katzerl!“ Bertel aber ballt eine Hand voll Schnee und wirft sie nach dem Hunde: „Marsch zurück in die Hütten!“ Küon weicht dem Schneeball aus und trollt sich langsam heim zu.
Die Kinder setzen den Weg über die verschneite „Naufahrtwiese“ fort. Stellenweise ist der Pfad so verweht, dass sie bis zu den Knien waten müssen. Sie kommen zum Ufer des Mühlarms. Dort hat der Vater bei starkem Froste Schilf gemäht für den Stadlauer Baumeister, der es als Stukkaturrohr braucht, um an den Zimmerdecken den Mörtel haften zu machen. Bertel zeigt der Liesel ein stehen gebliebenes Schilfbüschel bei den Uferweiden: „Siehst du dort unser Nest vom Rohrdröscherl,2 hoch oben in dem Schüppel Schilf? Dem ist der Vater mit der Sengsen ausg’wichen, weil ich ihn drum bitt hab’.“ „Ich weiss schon,“ erinnert sich Liesel, „das ist das nämliche Nest, bei dem wir zu Pfingsten zug’schaut haben, wie’s von einem Tag zum andern grösser geworden ist. Wie ein richtiges Körberl ist’s eingeflochten zwischen den Halmen. Die Grasblätter gehen rundherum, einmal drüber, einmal drunter und die nächste Reih’ umgekehrt einmal drunter und einmal drüber. Schad, dass uns die Vögel nit haben zuschaun lassen, wie sie das mit dem Schnabel gemacht haben! Vor uns braucheten s’ doch nicht scheu tun. Sind wir denn nicht die Kinder vom Heger? Hast du überhaupt schon so ein Rohrdröscherl g’sehn?“ „O ja“, erwidert Bertel, nicht ohne Selbstbewusstsein. „Es sieht aus wie eine grosse Nachtigall: oben braungrau, unten beinah weiss.“ Bertel sucht linkshin nach einem Übergang, da der alte Holzsteg, der zum Lobauweg hinüberführt, schadhaft geworden und noch nicht ausgebessert ist. Ein lauwarmer Wind ist aufgesprungen, er legt sich den Kindern in die Kleider. Das wäre lustig, aber der Schnee unter den Füssen wird klebrig und erschwert das Gehen. Auch gibt es hier allerlei zu sehen und zu erlauschen, das betrachtet, behorcht und beredet werden muss. Die noch geschlossene Eisdecke birst jetzt da und dort mit gedämpftem Knistern. Das kann noch nicht vom warmen Wind kommen. Aber irgendwo im Gebirg, wo die Zuflüsse der Donau herkommen, muss es schon vor Tagen zu tauen begonnen haben. Die grosse Donau draussen mag geschwellt sein, so dass jetzt auch die Sickerwasser in den alten Donauarmen steigen. Das Wasser beginnt das Eis sachte zu heben und es von den Ufern zu lösen. Das verstehen die Kinder aus Beobachtung; und in der Schule haben sie gelernt, warum das so sein muss. Wenn’s in Bayern, in Oberösterreich, in Salzburg, in Tirol taut, dann führen die Quellbäche den Flüssen und die Flüsse dem Strome mehr Wasser zu. Der Grundschotter unter dem Regulierungsdamm lässt es durch; so muss es auch in allen Armen der Alten Donau, die um die Auinseln herum fliessen, steigen, wenn auch immer später als im Strom. Sie stehen nicht still, diese klaren Sickerwasser, sie zeigen eine langsame Strömung von West nach Ost, wie die Donau selbst. Das haben die Kinder oft an den seichten Stellen beobachtet, die sie in der wärmeren Zeit als Furten zu durchwaten pflegen und wo auch die Wagen durchfahren. Und an manchen Stellen ist die Strömung so lebhaft, dass sie auch im strengen Winter nicht gefrieren; und solche offene Stellen sind es, die von den Fischen gerne aufgesucht werden, wenn sie Luft schöpfen wollen. Von einer schilfumbuschten Insel des Mühlarmes herüber, auf der zwei alte hopfenumsponnene Erlen stehen, hören die Kinder das Niederwuchten der nassen Schneemassen, sie sehen das Wippen und Schwingen der Äste, die ihre Lasten abgeworfen haben. Dann wieder flitzt vor ihnen überm Wasser etwas Blitzblaues durch die Luft. Es ist ein Eisvogel, der im tiefen Fluge hinstreicht und ihnen die blaue Oberseite zugewendet hat. Bertel weiss, dass dieser flinke Fischer sein eigenes Gebiet ab- und aufstreicht und dass er bald wiederkehren wird. Da warten die Kinder, um das Vergnügen des Schauens noch einmal zu haben. Wenn sie auch seit vier Jahren hier in der Lobau leben, den so fremdartig blauen Vogel haben sie doch nicht oft zu sehen bekommen. Und sie haben die Freude wieder. Einen fingerlangen Weissfisch im Schnabel, kommt der Eisvogel zurückgeschwirrt. Ein Hui, und der Vogel ist da; ein Hui, und er ist wieder weg! „Ah“, haucht Liesel, „der war schön!“ — „Aber jetzt gehn wir“, mahnt Bertel.
Splitterig werfen die nassen Schneeflächen das gelbe Licht des Sonnenballs zurück, der wie eine glühende Riesenscheibe tief über dem Silberpappelwalde der Lobau steht. Da tönt fernher aus dem Marchfeld ein langgezogener Pfiff. Die Lauschenden vernehmen ein gedämpftes Rattern. „Ui Jegerl! Der Marchegger Schnellzug! Jetzt ist’s achte und wir sind noch da! Gehen wir geschwinder“, drängelt Liesel. Sie setzen sich über die Schneedecke des Eises hin in Trab, dass der Schneebrei unter ihren Füssen nach allen Seiten spritzt. Wenn sie auch die Schuhe mit Hirschtalg gefettet haben, das Wasser ist ihnen von oben her übern Rist eingedrungen und macht sie frösteln. Und Liesel ist’s, als ob das Wasser auch rund herum eindringe in ihren rechten Strumpf. Sie beguckt den Schuh. Richtig, die Holznägel sind unterm Sohlenrand sichtbar. Die gequollene Sohle hat sie aus dem Kranzel gehoben. Die Kinder stehen inmitten des Mühlarmes auf einem flachen Inselchen, das nur eine Sandbank ist. Weiter jetzt auf dem vom Hochwild ausgetretenen Wechsel durchs mannshohe Schilf und dann noch einmal übers Eis. Als sie den festen Boden auf der Asperner Seite unter den Füssen haben, arbeiten sie sich tapfer durchs Dickicht der Uferböschung. Das geht nur langsam. Die dornigen Zweige der Weissdornbüsche, mehr noch die der Schlehen und die stacheligen Ranken der Brombeersträucher verwehren ihnen den Aufstieg. Die müssen sachte weggeschoben werden, sonst reissen sie Fetzen von den Kleidern. Trotz der Schwierigkeit des Weiterkommens entgehen Bertel die weissleuchtenden Wunden an den Eschen- und Ahornstämmchen nicht, wo die Rehe und Hirsche die Rinde abgeschält haben, als die Grasäsung verschneit war. Das soll auch Liesel sich anschauen. Die ist aber zurückgeblieben und kommt nicht, als Bertel sie ruft. „Komm lieber du zu mir,“ gibt sie zurück, „ich kann nicht vom Fleck.“ Und als er bei ihr anlangt, macht er eine traurige Entdeckung: Eine niedergetretene Brombeerranke hat sich am vorstehenden Rand ihres Schuhes verfangen und die gelockerte Sohle ganz vom Oberleder gelöst. Da durchstöbert Bertel seine Taschen. Als richtiger Bub hat er darin ein Allerlei von Schnurenden, Knöpfen, Marberln, einen Taschenfeitel, einen gefundenen alten hohlen Schlüssel, ja sogar ein rundgewickeltes Stück rostigen Drahtes, das er einmal unterwegs aufgelesen hat. Zunächst umwindet er Liesels klaffenden Schuh, so fest er kann, mit seinem grossen roten Taschentuch, dann umbindet er den Wickel mit Draht und Spagat, so dass alles gut zusammengezwungen ist. Und er tröstet die Liesel. „Nach der Schul’ gehn wir zum Moasen-Thomerl. Der nagelt dir die Sohle hinauf.“ Dann hasten sie weiter. Über verschneite Äcker halten sie gerade auf die Asperner Kirche zu und erreichen bei einer haushohen Strohtriste3