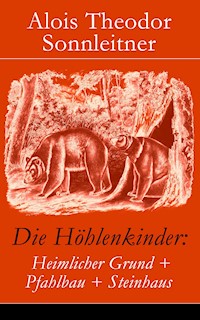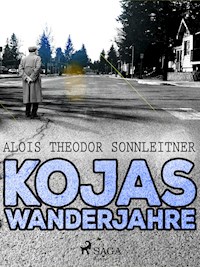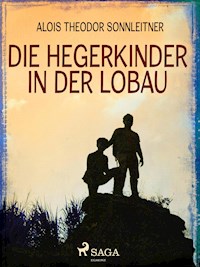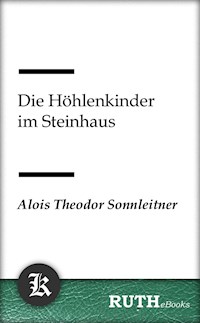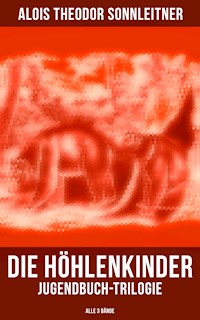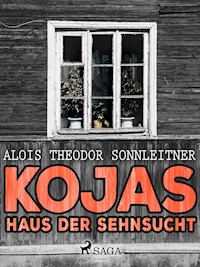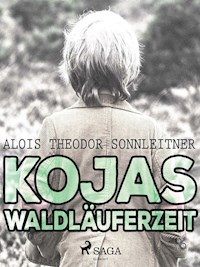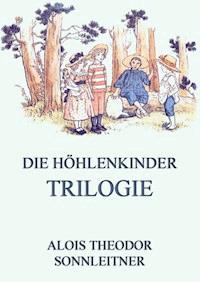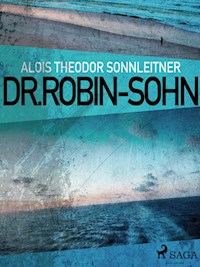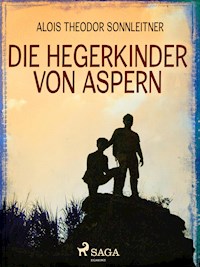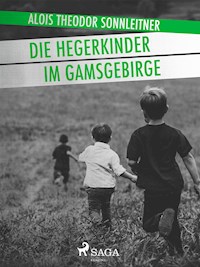
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schlimmes ist in der Familie der Hegerkinder – Bertel und Liesel, Franzel und Sepperl – geschehen: Zuerst ist ihre Mutter an einem Sumpffieber mit nachfolgender Erkrankung der Milz verstorben, dann wurde auch noch der Vater von einem Wilderer getötet, so dass nun alle vier Hegerkinder Vollwaisen geworden sind. Wer soll sich ihrer annehmen? Ihr Vormund wird der Moasen-Thomerl, der Flickschuster. Aber er kann alle vier nicht behalten. Wo soll er sie unterbringen? Klar ist, dass die vier nicht zusammenbleiben können, zumindest die drei Knaben müssen anderwärts unterkommen. Die beiden älteren Ziehbrüder, Franzel und Bertel, müssen sich jetzt entscheiden, was sie werden wollen. Bertels Bruder Sepperl entscheidet sich spontan, "zum Gschaider-Onkel ins Gamsgebirg" zu gehen. Zuerst einmal ziehen Franzel und Sepperl jedoch zusammen mit dem Lehramts-Anwärter Herr Dreßler ins elterliche Hegerhaus in der Lobau zurück, das schließlich nicht verkommen darf. Es dauert noch eine ganze Weile, bis es dann zunächst der Franzel ist, der den beschwerlichen Aufstieg hinauf ins Gamsgebirge antritt. – Der dritte Band der "Hegerkinder" erweitert Blickfeld und Lebensradius der Kinder, die beschauliche Auenwelt wird durch die Weite von Stadt und Gebirge ersetzt und wieder erwarten die heranwachsenden Kinder allerlei Prüfungen und Abenteuer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alois Theodor Sonnleitner
Die Hegerkinder im Gamsgebirge
Roman
Anschliessend an „Die Hegerkinder in der Lobau“
Mit Bildern von Ernst Kutzer und Franz Roubal
Saga
Die Hegerkinder im Gamsgebirge
© 1923 Alois Theodor Sonnleitner
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711570081
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Sehnsucht nach der Höhe.
Es mag uns die Arbeit behagen
In Werkstatt und Stube und Flur;
Doch packt uns zuzeiten die Sehnsucht
Nach der Berge herber Natur.
Wir überwinden die Trägheit
Des Leibes mit Selbstvertrau’n,
Um Täler und Hügel und Weiher
Von oben zu beschau’n.
Glückseliger Wand’rer, der siegreich
Hoch über den Klüften steht
Auf dem Gipfel des Bergesriesen,
Vom Odem des Himmels umweht!
Ein Lichtbad nimmt seine Seele.
Er kehrt geläutert zurück
Dahin, wo er für andre
Und für sich schafft das Glück.
Dr. A. Th. Sonnleitner.
Perchtoldsdorf, Haus „Auf der Sonnleiten“ im Mai 1927.
Der Vormund.
Verklungen ist das hohe Getön der Glocke, die dem Heger Gschaider zuliebe die Asperner zur Trauerandacht gemahnt hat. Verhallt ist das dumpfe Aufprallen der Erdschollen, unter denen der Sargdeckel gedröhnt hat. Verlaufen haben sich die Befreundeten und Bekannten des Hingeschiedenen.
Aber nicht versiegt sind die Tränen der vier Hegerkinder. Noch können sie es nicht fassen, dass sie nun ganz verwaist sind.
Im vorigen Winter ist ihnen die Mutter gestorben. Im Herbste hatte sie an Sumpffieber gelitten. Da war es dem Arzte gelungen, sie durch reichliche Chinin-Gaben vom Fieber zu befreien. Aber als Nachkrankheit hatte sich eine Erkrankung der Milz eingestellt, die er nicht zu heilen vermochte. Damals war die Bestrahlung mit Röntgenlicht noch nicht bekannt.
Und jetzt stehen die Kinder am Grabe des Vaters, der als Opfer seiner Pflichttreue gefallen ist. Ein Milderer hatte eine Rehgeiss in der Drahtschlinge gefangen. Beim Aufnehmen der zu Tode gequälten Beute war er vom Heger ertappt worden. Er hatte sich mit dem Messer gegen die Festnahme gewehrt und den Heger tödlich verwundet.
Abseits vom offenen Grabe steht Herr Dressler, der Student, im Schatten einer Hängebuche, ein dankbarer Freund des Verstorbenen, den Waisen ein Freund in der Not. Er wartet, bis die Kinder sich ausgeweint haben.
Er hat es übernommen, sie zum Moasen-Thomerl zu geleiten, dem braven Flickschuster, der sich das Recht gesichert hat, als Vormund für die Waisen zu sorgen. Der ist mit seinem Töchterl, der Regerl, längst voraus heimzu, den Hegerkindern eine Mahlzeit zu bereiten. Sommerlich warm brennt die Sonne auf den Friedhof nieder. Sie entlockt den Zypressen und Segenbäumen herben Harzduft. Schmetterlinge umgaukeln die Rosen und Ringelblumen auf den Gräbern, Eidechsen sonnen sich auf bemoosten Grabsteinen; leises Bienengesumm macht die Luft klingen. Das Schluchzen der Liesel und Sepperls wimmerndes Weinen ist aufdringlich hörbar. Bertel und Franzel haben wohl feuchte Augen, aber ihre Lippen sind fest geschlossen.
Der Student wartet und wartet.
Die Liesel ist unbewusst dem Grabesrande zu nahe gekommen; sie sieht alles trüb. Die Tränen haben ihr die Augen verschleiert. Unter ihren Füssen rollt die gehäufte Erde hinunter auf den Sarg.
Franzel reisst sie zurück: „Gehen wir!“
Und sie lässt sich hinwegführen.
Der Student tritt an die Kinder heran.
„Kommt, gehen wir zum Moasen-Thomerl.“
Unterwegs liess Dressler wohl eine Weile die Kinder ihr Leid ausweinen, dann aber versuchte er, sie mit schonenden Worten auf andere Gedanken zu bringen. — Er zeigte ihnen mancherlei Käfer und Falter, die der Betrachtung wert waren. Aber heute waren die Kinder nicht geneigt, mit ihm das Wunderbare in der Natur zu bestaunen und den schulmeisterlichen Belehrungen des jungen Mannes zu lauschen, der es doch so gut mit ihnen meinte.
Dass die Sonne so grell schien, dass die Lerchen so laut jubelten, dass die Grillen so schrill zirpten, alles tat ihnen weh. Aber sie weinten nicht mehr. Still näherten sie sich dem Hause des Flickschusters. Sein Töchterlein erwartete sie schon auf der Schwelle und lief ihnen ein gut Stück Weges entgegen. Sie empfing die Ankömmlinge mit der Frage: „Wo bleibt ihr so lange? Der Kaffee wartet und ich hab’ einen Gugelhupf gebacken.“
Da folgten sie ihr in den Hausgarten, wo im Schatten der Obstbäume der Tisch weiss gedeckt war wie an einem Feiertag.
Regerl fühlte sich gar wichtig als Hausmütterchen und sie war stolz darauf, dass ihr der Gugelhupf geraten war. Das sollte ihr eine nachmachen, die noch drei Jahre in die Schule gehen musste wie sie. Sie schenkte ein und legte vor. Da begannen sie zu essen.
Der Moasen-Thomerl aber war nicht da: „Der Vater ist ins Hegerhaus hinüber, das Vieh tränken und füttern,“ erklärte Regerl. So handelte der Vormund1 für seine Mündel. Das Vieh, welches sie geerbt hatten, sollte nicht Durst und Hunger leiden am Begräbnistag.
Erst beim Abendläuten kam der Schuster zurück. Als Liesel ihm dankte, dass er der Vormund wollte sein, wehrte er ab:
„Schaut, Kinder, wenn einem jungen Spatzerl, das noch nicht fliegen kann, die Katz die Eltern wegfrisst, da nimmt sich irgendein anderer Spatz um das verlassene Vogerl an und lässt es nicht verkommen. Wär eine Schand, wann’s bei uns Menschen anders wär.“
Nach dem Moasen-Thomerl kam der Turnowsky-Hiasel, der grosse Bub des Buschenwirtes. Er wollte die Kinder heimgeleiten und in der Nacht bei ihnen bleiben, wie er es als guter Nachbar in den letzten zwei Nächten getan hatte.
Verwaist waren die Hegerkinder, aber verlassen waren sie nicht.
Aufgeteilt.
Am liebsten hätte der gute Moasen-Thomerl seine vier Mündel bei sich behalten im Haus; aber er war zu arm. Sein Handwerk nährte ihn und sein Töchterlein nur so, dass sie gerade noch satt wurden. Seitdem eine Menge Händler schöne und billige Schuhe verkauften, wie sie in den Fabriken hergestellt werden, liess selten jemand bei dem Dorfschuster ein Paar nach Mass machen. Zu flicken hatte er genug, aber das trug nicht viel ein.
Da war es für ihn die erste Sorge, die drei Knaben anderwärts unterzubringen; sie mussten aufgeteilt werden. Aber zu guten Menschen sollten sie kommen, dass sie nicht verdürben. Die beiden schulmündigen Ziehbrüder, Franzel und Bertel, mussten sich jetzt entscheiden, was sie werden sollten. Der Vormund befragte die Knaben darum und suchte Rat beim alten Oberlehrer Leitel und beim neuen Oberlehrer Wagner, aber auch bei den Forstleuten. Franzel wäre am liebsten Jäger geworden, aber er hatte auch Lust zum Schlosserhandwerk. Bertel, der ein sehr gutes Entlassungszeugnis hatte und der seinen Oberlehrer Wagner als Vorbild verehrte, bat, der Vormund möchte ihn Lehrer werden lassen.
Gern hätte dieser ihm willfahrt, aber er hatte Angst, die Mittel für das lange Studium nicht aufbringen zu können. Hiezu kam, dass der Forstmeister, der ihm für Liesel einen Erziehungsbeitrag zu erwirken versprach, sich bereit erklärte, den Bertel sofort als Forstpraktikanten anzunehmen und für dessen spätere kostenlose Unterbringung in der Aggsbacher2 Forstschule zu sorgen.
In seiner Armut unfrei, ergab sich Bertel in das von dem wohlwollenden Herrn bereitete Schicksal. Der Gedanke, dass sein Vater in treuer Pflichterfüllung dem Messerstich eines Strolches erlegen war, erfüllte ihn mit einem Ernste, der ihn älter erscheinen liess, als er war. Als Forstpraktikant wurde er dem Oberförster in Wolfsgrund3 zugeteilt und tat schon am dritten Tage nach dem Begräbnis als Aufseher Dienst beim Holzschlagen. In den Augen der Taglöhner war der junge Forstpraktikant eine Amtsperson wie jede andere. Sein Dienstkleid gab ihm das Ansehen; der graue Lodenrock mit grünen Tuchaufschlägen kleidete ihn gut; das vergoldete Eichenlaub am Kragen, der schwertartige Hirschfänger an der Seite und die alte Büchsflinte, welche er als Erbstück vom Vater übernommen hatte, sie waren Abzeichen seiner Pflichten und Rechte. Und bei seinen Dienstgängen war Treff, der Hund, den der Vater aufgezogen hatte, sein lieber Begleiter.
Der kleine Biberhaufen, in dem des Vaters verlassene Hegerei stand, gehörte in Bertels Revier; da wollte er öfter nachsehen und in der Nähe des Hauses einen blinden Schuss abgeben, damit sich kein ungebetener Besucher herantraue. Die Forstverwaltung besetzte den Asperner Hegerposten nicht wieder und beabsichtigte, das alte Haus abtragen zu lassen, weil dessen Mauerwerk gelegentlich der Überschwemmungen durch aufgesaugtes Grundwasser arg gelitten hatte. Das Gebäude war ja nicht unterkellert.
Liesel, die noch ein Jahr in die Schule zu gehen hatte, blieb beim Vormund im Haus.
Regerl war glücklich, dass die nur um zwei Jahre ältere Freundin von nun an mit ihr hausen sollte. Freilich, wenn die Liesel schulmündig wurde, dann musste sie irgendwohin in die Lehre, sie wollte ja Schneiderin werden.
Franzel und Sepperl, die zwei Pflegekinder des verstorbenen Hegers, machten dem Moasen-Thomerl mehr Sorge. Für die war vom Forstamte keine Hilfe zu erbitten; sie waren ja nicht leibliche Kinder des Forstbediensteten. Und an die Gemeinde Gaming, wohin die Kinder zuständig waren, wollte der Schuster die Kinder nicht abgeben. Dort war ja der Vater der Waisen als Wilddieb und Schnapstrinker ins Unglück gekommen. — Und der gewissenhafte Fürsorger fürchtete, die Knaben könnten auch missraten. Wusste er denn, zu wem man sie in Pflege geben würde?
Weil für Franzel im Lobauer Revier keine Praktikantenstelle zu haben war, fügte er sich darein, das Schlosserhandwerk zu erlernen; er bastelte ja von jeher gerne. Wo aber nur geschwind eine Lehrstelle für ihn finden, nicht zu weit weg, dass der Vormund nachschauen könnte?
Sepperl, der hochaufgeschossene Jüngere, der noch ein Jahr in die Schule zu gehen hatte, erklärte einfach: „I bleib bei der Liesel.“ Da musste der Moasen-Thomerl lachen: „Mein lieber Sepperl, ich kenn dich als Friessniggel, bei mir tät’st du wohl nit satt werden!“ Der Bub tröstete sich: „So geh i halt zum Gschaider-Onkel ins Gamsgebirg.“ — „Der kann di brauchen, wohl, wohl“, versetzte der Schuster und nickte beifällig: „Der hat Küah auf der Fadenwiesen und hat mit fremden Leuten sein’ Plag. Kehren ja die Touristen bei ihm ein, die über’n Fadensteig auf ’n Schneeberg wollen. Mit Küahhalten und Heugna4, mit Hilf im Haus und Fremdenführen kannst dir bei ihm den Sterz und die Milchsuppen verdienen ausser der Schulzeit.“ So schrieb denn Liesel, die am besten mit der Feder umzugehen wusste, einen Brief an den Gschaider-Onkel in Losenheim am Schneeberg, ob er den Sepperl zu sich nehmen wollte.
Nun kamen sorgenvolle Tage für den Flickschuster.
Vom Vormundschaftsgericht, das als Testamentsvollstrecker sich um das Erbe der Waisen bekümmerte, kam eine Schätzungskommission, der auch der Bürgermeister von Aspern zugezogen wurde, und nahm das Verzeichnis der Hinterlassenschaft des verstorbenen Hegers auf. Der Moasen-Thomerl musste aufs Bezirksgericht, um als Vormund der Waisen das Angelobungsformular zu unterschreiben. Er übernahm die Pflicht, das Erbgut der Kinder zu bewahren und zu verwalten. Was er nicht in seinem kleinen Anwesen bergen konnte, musste er verkaufen und das Geld bei der Waisenkasse des Steueramtes hinterlegen.
An den Notar war ein Bericht über den Nachlass zu schicken. Da kam dem Moasen-Thomerl der Student Dressler als freiwilliger Helfer zurecht.
An einem Montag war’s, es ging schon auf Mittag; mit fröhlichem „Grüss Gott!“ trat der junge Mann in die Werkstatt des Schusters, warf seinen prall gefüllten Rucksack in einen Winkel, den Lodenhut dazu und setzte sich auf die Ledertruhe neben dem Werktisch.
„Ich muss allweil an die armen Hegerkinder denken und an Euch, lieber Meister,“ begann er; „Ihr habt Euch ein bisserl zu viel aufgeladen: die Sorg um vier Waisenkinder! Vier! — Allein zwingt Ihr’s nicht.“
Der Schuster sah dem Studenten erwartungsvoll in das vom dünnen, dunklen Vollbart umrahmte Gesicht. „Besser schon, als einer, der’s mit der Vormundschaft leicht nimmt; — wann ich nur schon eine Lehr hätt für’n Franzel — aber es müsst in der Näh sein, wo ich auf ihn schauen könnt; er is a Malefiz5-Schlankel!, der Franzel; hat dem Heger g’nug zum Auflösen ’geben. Ich mein’ allweil, er kunnt leicht sein’m Vater nachg’raten, der war soviel unbändig.“ — „Wie meinen Sie das? War er ein Raufer?“ — „Dös aa; ’s hat überhaupt ka Z’ruckhalten geben bei dem, wenn ihn was g’razt6 hat. — Ob’s ein Glasel Schnaps war oder ein Stück Wild im Gaminger Gebirg, oder ob ihn einer durch ein Wort schiach7 g’macht hat, er hat si nit zügeln können.“
„Aha, ich verstehe: in ihm waren die Begierden zu stark und die Gewissensstimme war zu schwach. Da hat er sich nicht abhalten lassen, wann er in eine Versuchung gekommen ist.“ — „Ja, so war er und so is der Franzel. Aber der Bub hat auch einen guten Kern; es wär’ schad um ihn. Drum will ich den Franzel nit aus den Augen verlieren, muss schauen, dass er sich eing’wöhnt in ein ordentlich’s Leben unter die Leut.“ — „Sie können doch nicht allweil um den Buben sein; Ihr Handwerk lässt Ihnen dazu nicht die Zeit“, wendete der Student ein; „ich weiss aber einen, der die Zeit hat und den guten Willen und das nötige Geld. Der kümmert sich weit und breit um die Waisenkinder. Ein richtiger Vater der Waisen.“ — „Wer?“ — „Es ist der Professor Hyrtl8.“ — Der Schuster schüttelte den Kopf: „Hyrtl? — kenn i nit.“ — „Ein alter Professor der Anatomie.“ — „Anatomie? Was ist denn das wieder?“ — „Das Zerschneiden von Leichnamen zum Zwecke der wissenschaftlichen Erforschung.“ — „Hm“, machte der Schuster und schüttelte seinen grauen Kopf. „Und so ein Leichenzerschneider sollt ein Herz haben für arme Waserln? I kann’s net glauben.“
Da entnahm der Student seiner Brieftasche ein Schreiben und öffnete es. Ein Lichtbild kam zum Vorschein. Das zeigte er dem Schuster: „Da hab ich seine Photographie. Die hab ich von ihm bekommen zum Andenken. Wohl hätt ich ihn auch ohne dieses Bild mein Lebtag nicht vergessen. Hat er doch für mich acht Semester lang die Kollegiengelder9 gezahlt und dazu einen Verköstigungsbeitrag zu einer Zeit, wo ich noch nicht genug Nachhilfeunterricht geben konnte, um mich durchzubringen. Schaun Sie sich den Hyrtl einmal an: Die Augen! Die Augen! Da leuchtet Güte und starker Wille heraus! Und die paar Falteln in seinem Gesichte, die kommen vom Lachen her. — Der gute Hyrtl lacht gern und macht oft einen feinen Witz, dass auch andre lachen.“
„Bei seinem traurigen G’schäft?“ fragte der Schuster. — „Der wär traurig gewesen, wenn er nicht Leichen sezieren10 hätt’ dürfen. Es hat eine Zeit gegeben, wo es den Ärzten verboten war, an menschlichen Leichnamen zu studieren. Da haben sie keine Ahnung gehabt, wie es im menschlichen Leib ausschaut, wie die Knochen aneinandergefügt sind, wie die Adern und die Nerven verlaufen, wie das Herz und die Nieren, die Lungen und die übrigen Eingeweide gebaut und eingelagert sind. Und wenn sie helfen wollten, haben sie manchen falschen Schnitt getan; in der guten alten Zeit sind Tausende von Menschen nur darum an Wunden und inneren Krankheiten gestorben, weil die Ärzte das Wichtigste nicht gewusst haben, nämlich, wie der wunderbare innere Bau des Menschenleibes beschaffen ist.“ — Der Schuster nickte; es leuchtete ihm ein. „Hyrtl hat vierzig Jahre seines Lebens damit verbracht, Ärzten und Studenten, die Ärzte werden wollten, genauen Unterricht zu geben über das Innere des menschlichen Leibes. Er hat aber auch einzelne Organe, ich meine damit Lebenswerkzeuge, wie Gehirn, Herz, Nieren, Augen, Ohren, so gut vor dem Verderben bewahrt, dass sie immer wieder von den Studierenden angeschaut werden konnten. Er hat die Organe durch Einlegen in fäulniswidrige Flüssigkeiten oder durch Einspritzungen ‚präpariert‘. Und alles hat er so säuberlich hergerichtet, dass seine anatomischen Präparate wegen ihrer Reinheit und Genauigkeit bewundert und verlangt wurden. Die hat er an alle Museen und Universitäten der Welt verkauft. Und sie sind ihm noch besser gezahlt worden als seine anatomischen Lehrbücher; die hat er nicht nur deutsch, sondern auch lateinisch geschrieben, damit sie von den Gelehrten anderer Völker studiert werden konnten. Und ihm zulieb sind Studierende aus Amerika, aus Ägypten, China und Japan nach Wien gekommen und haben sich als seine Hörer an der Wiener Universität aufnehmen lassen. Tausende von Ärzten in allen Erdteilen verdanken es unserem Hyrtl, dass sie wissen, wie sie den Kranken helfen sollen. Gar nicht ausdenken kann man’s, wieviel Millionen Menschen in allen Erdteilen das Leben ist gerettet worden von Hyrtl-Schülern. Dafür aber ist ihm auch schon zu seinen Lebzeiten ein marmornes Denkmal gesetzt worden im Laubengang der Wiener Universität.“ — „So einer ist das!“ rief der Schuster aus, „also ein ganz Grosser!“ — „Ja, ein ganz grosser Helfer. — Hyrtl ist nicht nur der berühmteste Anatom der neuen Zeit, er ist einer der warmherzigsten Menschen überhaupt. Das wissen wir armen Studenten, denen er die Studienkosten, Wohnung und Nahrung zahlt, das wissen auch die Waisenkinder, für die er sorgt wie ein Vater. Er ist einer, der nicht nur Gutes tun will, sondern auch kann. Durch seine Arbeit ist er ein vielfacher Millionär11geworden und lebt dabei so bescheiden wie unsereiner. Da hat er viel Geld übrig für andre.
Er hat es nicht vergessen, dass er selbst als Sohn eines armen Musikanten12 von guten Menschen ist unterstützt worden, dass er nur dank der Hilfe von Wohltätern etwas Ordentliches lernen konnte. Weil er aber denen, die ihm geholfen haben, die Guttaten nicht zurückerstatten kann, tut er wieder anderen Gutes, jungen Leuten und Kindern, damit aus ihnen brauchbare Menschen werden. Und die helfen dann wieder anderen.
Wohl haben Hyrtls Augen besonders beim anstrengenden Schauen durchs Mikroskop13 arg gelitten. Dafür haben die Studenten der Medizin an den Universitäten von ihm Lernmittel, dass sie schauen können, wie der menschliche und der tierische Leib in seinen Teilen und Teilchen gebaut ist.
Im Jahre 1874 waren Hyrtls Augen infolge der vierzigjährigen Überanstrengung so geschwächt, dass er sich entschliessen musste, sein Lehramt an der Universität aufzugeben. Seitdem lebt er in Perchtoldsdorf in seinem bescheidenen Haus nah der Burgruine. In der hat er seine Bücherei untergebracht14.
Aber er lebt da nicht als Verdrossener, obwohl er dem Erblinden nahe ist. Immer darauf aus, andern zu helfen, freut er sich, dass sich viele finden, denen er helfen kann. Und weil er selber keine Kinder hat, nimmt er sich am liebsten um Kinder an, die keine Eltern haben.“
Des Schusters Augen waren gross geworden in andächtiger Bewunderung.
Er fragte bange: „Na, ja, wenn er schon so viele hat, um die er sich annimmt, ob er auch noch den Franzel wird mögen, wenn ich ihm den ans Herz leg?“
„Das besorg lieber ich“, versetzte der Student. „Ich schreib ihm. Ich mach ihm eine Freud damit, dass ich ihm ein armes Kind zuführ. So kenn ich den Hyrtl.“
Der Schuster stand von seiner Werkbank auf, kramte Papier, Feder und Tinte aus der Tischlade und nötigte den Studenten ins anstossende Zimmer: „Da haben Sie Ruh zum Schreiben, je eher, desto besser.“
Indes kamen Liesel und Regerl vom Hofe herein, jede mit einem Arm voll Kleinholz, das sie hinterm Herd an der Wand aufzuschichten begannen.
Ihnen auf dem Fusse folgte Franzel mit einem Kruge voll Milch. Er kam aus der Hegerei, wo der Sepperl als Haushüter zurückgeblieben war, bis ihn der Hiasel vom Buschenwirt ablösen würde.
Der Student hatte seinen Brief beendet, liess ihn vom Moasen-Thomerl als dem verantwortlichen Vormund mit unterschreiben und übergab ihn dem Franzel, dass er ihn zur Post trage.
Da tat der Alte einen tiefen Atemzug: „Ein Stein ist mir vom Herzen gefallen.“ — Gleich darauf aber fügte er doch wieder kleinlaut hinzu: „Kann ich mich wirklich darauf verlassen, dass er den Buben nimmt, der Hyrtl?“ — „Ja, auf den Hyrtl kann man sich verlassen; er ist immer der Gleiche. Die Leute heissen ihn den Weisen von Perchtoldsdorf. Und ‚weise‘ ist das höchste Lob, das einem Menschen werden kann. Weise sein, heisst mehr als gescheit sein. Es heisst, das Rechte kennen und wollen und unwandelbar tun.“
Farmer, Fischer und Trapper.
Herr Dressler, der kurz vor Beginn der Ferien die Staatsprüfungen an der Wiener Universität abgelegt hatte und im Herbst am Mariahilfer Gymnasium15 als Probekandidat16 den Dienst antreten sollte, verzichtete einstweilen auf die geplante Ferienreise; er konnte ja den Moasen-Thomerl nicht ohne Hilfe lassen. Er musste ihm einen Teil der Sorgen abnehmen. Für Franzel und Sepperl war im Häuschen des Schusters nicht Platz. Sie sollten einstweilen in der Hegerei wohnen, die der Vormund erst ausräumen wollte, bis die Brüder anderswo untergebracht wären.
So zog denn Dressler mit den beiden Knaben ins Hegerhaus, das inmitten der Au lag, wie eine Farm im Urwald.
Er half den zum zweitenmal verwaisten Buben über das Traurige ihrer Lage hinweg, indem er wie im Spiel ihr Farmerleben einrichtete. Vor lauter Arbeit sollten sie gar nicht dazukommen, wehmütigen Gedanken nachzuhangen. Das Ernten der Frühkartoffeln sicherte den Hauptbestandteil der Mahlzeiten, an Gemüse und Milch fehlte es nicht, geräucherte Speckseiten hingen in der Kammer, die Mehltruhe war noch halb voll, die Hühner waren in ihrer besten Legzeit. So fehlte es nicht an Nahrung. Und die drei „Farmer“ lösten einander in den Haus- und Feldarbeiten ab. Durch Hiasels Vermittlung bekamen sie die Erlaubnis, in dem vom Buschenwirt gepachteten Donauarm zu fischen. Von Bertel redeten sie als vom befreundeten „Trapper“, und hofften, dass er etwas Freiwild17 zu ihrer Wirtschaft beisteuern werde.
Die vom Heger im Laufe der Jahre aufgespeicherten Langhölzer mussten auf meterlange Scheiter zersägt werden; die sollten mit dem Kuhgespann zum Moasen-Thomerl verfrachtet werden; dann aber gab es in der nächsten Umgebung der Hegerei eine Menge Baumstrünke, die auch nicht zu verachten waren. Beide Brüder, die zu Lebzeiten ihres Vaters beim Sprengen des Stockholzes oft zugesehen hatten, nahmen sich mit Feuereifer um das mühsame Anbohren der Strünke an. Der vom Heger ererbte Pulvervorrat war beträchtlich. Die Bohrlöcher wurden damit geladen, mit Luntenstücken versehen und oben durch Lehmpfropfen abgeschlossen. Und Franzel liess sich’s nicht entgehen, Feuer an die lang wegliegenden Lunten-Enden zu legen. — Wenn er dann aus sicherer Entfernung das Fortglimmen der Zündschnur beobachtete und der Schuss recht kernig krachte, so dass die Trümmer des Strunkes auseinanderflogen, jauchzte er voll Vergnügen. Krachen hören, das war seine Freude. Sepperl aber fühlte sich so recht als Mann, wenn er beim Beladen des Wagens oben stand und die zugereichten Scheiter zweckmässig schichtete, wenn er die Kuh vor den Wagen spannte und dann als richtiger Fuhrmann nebenher stapfte, die Peitsche in der Hand. So lebten die drei Farmer vergnügt dahin bei ihrer Arbeit.
Sie hätten nun alle zufrieden sein können. Nur Franzel war’s nicht. Der Wildererstutzen18 über seinem Bette wirkte auf ihn wie ein Versucher. Die wilden Kaninchen, von denen es in der Au wimmelte, die Fasane, die ungescheut bis an den Gartenzaun heranstrichen, ja auch die Wildtauben und Krähen, die in den Beständen der alten Silberpappeln nisteten, sie reizten den beutegierigen Sohn des Wilderers immer wieder. Für Sepperl, seinen ruhigen Bruder, waren sie keine Versuchung. Der mochte wohl seiner stillen, leidenschaftslosen Mutter nachgeraten sein. So oft Bertel nachschauen kam, wie es den „Farmern“ ging, bettelte ihn Franzel an: „Geh, lass mi schiassen!“ Einmal griff er in fieberhafter Begierde nach der Büchsflinte, die am breiten Riemen von des Forstpraktikanten Schulter niederhing. — „Rühr mein Dienstgewehr nicht an!“ klang ihm die Abweisung hart entgegen. „Du hochfahriger Ding, du!“ murrte Franzel; in seinem Herzen entstand der Groll, wie ihn die Wilderer hegen gegen die Berufsjäger. — Da beschloss er, sich selbst zu helfen.
An einem Vormittag, als Dressler und Sepperl in der Au mit dem Ausgraben von Stockholz beschäftigt waren, hatte Franzel Hausdienst. Erst besorgte er die Vorbereitungen zum Mittagmahle. Das Feuer prasselte unter dem gemischten Gemüse, das in mancherlei Änderungen die tägliche Kost der „Farmer“ bildete; jetzt hatte er Zeit für sich. Er nahm seinen Wildererstutzen von der Wand, den der Heger-Onkel seinerzeit durch Herausnehmen der Feder lahmgelegt hatte, und zog die Schrauben mittels seines Taschenfeitels aus den Deckplatten des Schlosses. Er nahm sie ab und legte den Stutzen auf den Küchentisch. Dann begab er sich auf den Boden, wo er in einer Kiste das eiserne Allerlei wusste. Er hoffte, eine Stahlfeder zu finden, die er ins Schloss einpassen könnte. Er fand ein zusammengerolltes Stahlband, das einst einem Glockenzug als Feder gedient hatte; aber es war viel zu breit. So holte er denn aus der Werkzeugkiste Feile, Meissel, Hammer und Schraubstöckel. Das letztere machte er am Rande des Küchentisches fest, klemmte das Stahlband ein und begann mit dem Zurechtfeilen. Das Band mochte härter sein als die Feile; es kreischte überlaut und gab nichts ab, so sehr sich der Bub auch plagte. Er verfiel auf den Gedanken, das Stahlband erst durch Anglühen und langsames Auskühlen weich zu machen und nach der Bearbeitung wieder zu härten. Als er es mittels des Schürhakens glühend dem Ofenfeuer entnommen hatte, legte er’s auf den bereitgestellten Hackstock. Hier gelang es ihm leicht, mit Hilfe des Meissels und des Hammers, aus dem erweichten Band die benötigte Feder herauszuschneiden. Dann passte er sie ins Schloss ein und nahm von ihren Rändern mit der Feile weg, was nötig war. Er bog sie zurecht, glühte sie wieder im Feuer an und warf sie dann ins Wasserschaff. Als er sie herausnahm, federte sie richtig, aber sie tat im Schloss nicht ihren Dienst. Mit einem Ende hätte sie festsitzen sollen. Aber wie sie festmachen? Es fehlte an der passenden Schraube. Er zweifelte nicht, dass es ihm gelingen werde, das zusammenzubringen, was vor ihm tausend andere gemacht hatten. Aber das Hindernis in der Ausführung seines Vorhabens brachte ihn zur Besinnung: In ihm wurde das Gewissen wach. Das Bewusstsein, dass er im Begriffe war, etwas Verbotenes zu tun, die Erinnerung an den verstorbenen Heger, der ihn beim Pfeilschuss auf den Marder ertappt hatte, das Gedenken des Vaters, den Gendarmen als Wilderer abgeführt hatten; all das wurde in ihm zur Hemmung. In einem Zustande qualvollen Ringens sass er da, den verhängnisvollen Wildererstutzen über den Knien. In ihm stieg die Frage auf, wie sich Bertel gegen ihn benehmen würde, wenn er ihn mit dem Stutzen in Händen im Reviere ertappte.
Als ob seine Gedanken an den Forstpraktikanten eine Ahnung von dessen Nähe gewesen wären, stand dieser plötzlich auf der Schwelle der offen gebliebenen Türe.
Mit einem unsagbar traurigen Ausdruck seiner braunen Augen schaute er auf Franzel nieder. Der Gruss war ihm auf den Lippen geblieben. Eine Weile schwiegen beide. Franzel fand als erster das Wort: „Ich hab’s nur herrichten wollen.“ — „Mir bind’st nix auf,“ erwiderte der andere. „Ich kenn dich. — Was glaubst, was ich tun müsst, wenn ich dich im Revier anträf’ mit dem Stutzen?“ — „Bist ja mein Ziehbruder,“ wendete Franzel ein. — „Im Revier bin ich Amtsperson; daran is nix zu deuten. Abliefern müsst ich dich an die Gendarmerie!“
Franzel sprang auf, dass der Stutzen dumpf zu Boden fiel. Seine Fäuste ballten sich. Bertel aber trat ruhig auf ihn zu und legte seinen rechten Arm um den Nacken des zornig Erregten. „Dank dem Herrgott, dass ich jetzt zu dir gekommen bin, du Zornbinkel; wer weiss, wie’s geworden wär.“ Da machte sich Franzel von ihm los, hob den Stutzen vom Boden und drängte ihn dem Bertel auf.
„Da nimm das Teuxelsschiesseisen. Es razt mi, sooft i’s anschau.“ — Bertel hielt es staunend in Händen. — „Aber heb mir’s gut auf; es is ja mein einziges Andenken an den Vater.“ Bertel nickte. — Nach kurzem Schweigen fuhr Franzel fort: „Weisst, Bertel, wir leben da mit dem Studenten im Spiel als Farmer. Und zum Farmerleben g’hört do ’s Jagen aa. Das war so mein dummer Gedanken. Von dir reden wir immer als von unserm Freund, dem Trapper. Und meinen, du könntest uns doch ab und zu ein Stück Freiwild bringen.“
Bertel musste lächeln. „Wann ihr schon Farmer spielt, so will ich euer Trapper sein. Ich schiess euch Künigl, soviel ihr braucht. Die sind ja für mich frei als Dammschädlinge, auch Nebelkrähen, die Schaden machen an Vogelbruten.“
Franzel war getröstet. „Dann hab’n m’r bachene Hasen und Krähensuppen wie der Stummerl.“
Mit kräftigem Handschlag verabschiedete sich Bertel.
Als er so hinschritt, aufs Forsthaus zu, dachte er bei sich:
„Höchste Zeit, dass wir den Franzel in eine ordentliche Lehr bringen, dass er nicht wieder auf dumme Gedanken kommt.“