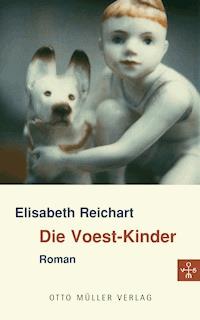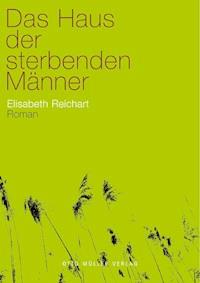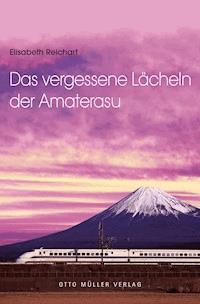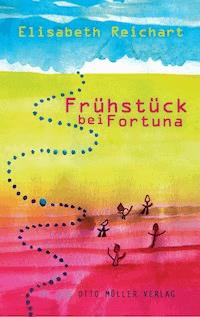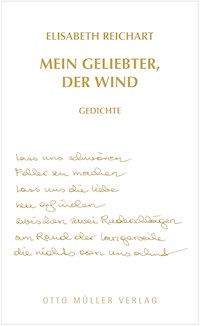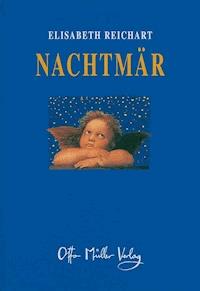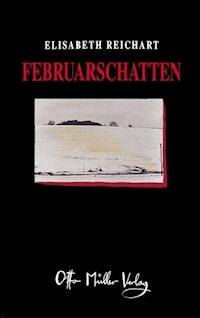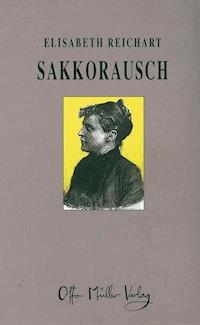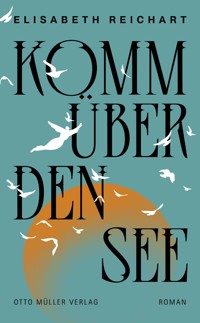
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Otto Müller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ruth Berger war zwar als Dolmetscherin in fremden Sprachen zu Hause, doch eine eigene Sprache findet sie nicht. Schon als Kind wurde sie zum Schweigen verdammt, und als erwachsene Frau verstummt sie immer wieder vor der Macht der Männer um sie herum. Nach gescheiterten Beziehungen und einer abgebrochenen Karriere ist sie allein mit ihrer Angst vor Nähe und Freundschaft, allein mit dem Verdacht, dass mit dem Verschwinden der weiblichen Stimmen die Ohnmacht der Frauen zementiert werden soll. Ruth, nunmehr Lehrerin, übersiedelt für ein Jahr von Wien nach Gmunden. Dort ist sie ganz nah am Thema ihrer Recherchen, die sie seit Jahren nebenbei führt: Sie sammelt Akten über NS-Widerstandskämpferinnen im Salzkammergut, zu denen auch Anna Zach gehörte. Nach einem Gespräch mit dieser mutigen, inzwischen alten, aber ungebrochenen Frau versteht Ruth plötzlich ihre innere Fremde, versteht die Bedeutung von Schweigen und Verrat. "Komm über den See" verbindet Themenkreise, die seit Beginn an Elisabeth Reicharts Werk formen: Generationsübergreifendes Schweigen, Sprachlosigkeit und Verdrängen, aber auch weiblicher Widerstand gegen eine – immer noch – von Männern beherrschte Welt. Aufwühlend und zeitlos aktuell.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Elisabeth Reichart
KOMM ÜBER DEN SEE
Roman
Elisabeth Reichart
KOMM ÜBER DEN SEE
Roman
Mit einem Nachwort von Hans Höller
SIE
Vor jeder Erinnerung das Wissen: Alle Sätze in dieses Gestern können nur Brücken zu Inseln sein, was sie verbinden, es bleibt für immer getrennt.
Am Anfang, sagt sie, war ich wie gelähmt – und ich habe nichts getan, als meine Ohnmacht auszuschreiten, hin und her, hin und her … Es war wie ein Sog, dieses Gefühl, versagt zu haben, ich war beherrscht von diesem Wort – und keine Hilfe, kein Zeichen, an das du dich hättest halten können, du musstest selbst aus ihr hervorkriechen, ja, kriechen, langsamer als in diesen ersten Monaten habe ich mich nie bewegt … Und wer hat schon gelernt, auf sich zu vertrauen, und es lernt sich nicht unbedingt leichter in braunen Zeiten … Dann bin ich angekommen bei der Frage: Wo habe ich eigentlich gelebt, in welchen Traum bin ich geflüchtet, was ließ mich glauben, in Wahrheit seien alle Menschen wie ich, wollten sie alle keinen Faschismus, keinen Krieg, wagten es nur nicht, die Stimme zu erheben gegen die Mächtigen … Der Traum war plötzlich zu Ende, war zu Ende angesichts des Jubels in den Gesichtern beim Einmarsch der Nazis, ja, es war Jubel in vielen Gesichtern, und andere waren lebendiger, als ich sie je zuvor gesehen … Da fing die Ohnmacht an … In ihr war auch Geborgenheit, ich wollte geborgen sein, kurze Zeit wollte ich nur geborgen sein … Bis die Stille in mir vollkommen war, bis sie groß genug war, mich zu erschrecken – so ein Leben ist kein Leben … Da wusste ich wieder, ich kann nicht blind werden, ich muss meinen Teil tun, egal, was die anderen tun, es war mein Leben, ich würde es mir nicht nehmen lassen, von ihnen nicht, von niemandem … Das schwierigste war, sagt sie, sich Tag für Tag und Nacht für Nacht immun zu machen gegen die Faschisten – keine Haustür sperrte sie aus, kein Schlaf, in den sie nicht ihre Arme streckten –; die Banalität des Alltags war nur noch eine Erinnerung an eine Vorzeit, an ihre Stelle war eine Wachsamkeit getreten, du warst ein gespannter Bogen, jahrelang, und es war fast eine Erleichterung, wenn sie an dir zerrten, wenn sie kamen, um dich zu holen für den Dienst an ihren Verbrechen. Und die Dienste waren meist kleine Dienste, du solltest für ihr Winterhilfswerk sammeln gehen, du solltest ihre Häuser putzen, ihnen ihre Mahlzeiten kochen, du solltest ihren Organisationen beitreten, das Kind in ihre Uniform stecken – ja, es war fast eine Erleichterung, nein sagen zu können, ein ganz konkretes Nein sagen zu können …
Neben den alltäglichen Neins gab es die großen Neins – eine fremde Stimme sagt dies, die kein Staunen zum Schweigen bringt, die weiterredet, als wäre sie aufgefordert dazu: SIE hat 1940 eine Frauendemonstration zur Freilassung einer Genossin organisiert, und die Genossin wurde freigelassen – SIE hat mit belgischen Kriegsgefangenen ihr Essen geteilt; einer, der keine Wunder ertragen konnte, hat SIE angezeigt … SIE schafften das Unmögliche, aber wer konnte noch an das Unmögliche glauben, die Frauen gingen wieder nach Hause und vergaßen, dass die Nazis besiegbar …
Dieser Gang nimmt kein Ende. Wie gut, dass du ihn mit geschlossenen Augen gehen kannst. Rechts die großen Fenster, links die Türen zu den Klassenzimmern, halte dich in der Mitte, die Fenster können ein Hindernis sein, genauso die Türen. Du hast dich überschätzt, Ruth, wie schon öfter. Du hast geglaubt, du schaffst es allein, nur mit deinen Leistungen: Jetzt beugen sie dir den Rücken.
Das Sausen in ihrem Kopf wurde lauter. Sie wäre am liebsten zur Toilette gelaufen, zwang sich jedoch, langsam zu gehen. Endlich stand sie vor dem Waschbecken, konnte das Wasser über ihre Arme laufen lassen, fing es in den Händen auf, tauchte ihr Gesicht hinein, befeuchtete ein Papiertaschentuch, legte es sich in den Nacken, spürte das kalte Wasser ihren Rücken hinuntertropfen. Zehn Minuten waren erst vergangen, seitdem die Sekretärin in das Konferenzzimmer gekommen war und sich suchend umgesehen hatte. Ruth hatte gehofft, die Suche würde ihr gelten. Als sich ihre Blicke begegneten, nickte die Sekretärin: „Frau Berger, bitte zum Direktor!“ Ruth sah sich noch einmal aufstehen und in das Direktionszimmer gehen. Das Gesicht im Spiegel lachte sie aus. Der Direktor war nicht allein, ihr Kollege Klingenbach war bei ihm, grüßte sie mit einem kurzen Kopfnicken, um seinen Mund ein verlegenes Lächeln. Ruth war froh, dass der Direktor sie beide aufforderte, Platz zu nehmen, die Angst krampfte ihren Magen zusammen, sie kannte Klingenbach, sonst waren seine Begrüßungen überschwänglich, konnte sie sich seinen Umarmungen fast nicht entziehen; sie kannte auch ihren Körper, bald würde die Angst in den Beinen sein, würde ihr die Füße wegziehen, die stechenden Schmerzen in den Lendenwirbeln würden tagelang bleiben. Sie verstand den Direktor kaum und hörte doch jedes Wort: Dass er sich für den Kollegen Klingenbach entschieden habe, schwer sei ihm die Entscheidung gefallen, er habe noch nie zwei so gute Probelehrer in einem Schuljahr beschäftigt, aber für mehr als einen sei kein Platz an seiner Schule, er habe bereits eine Empfehlung zu Ruths Bewerbung hinzugefügt, mehr könne er leider nicht für sie tun. Ruth spürte, wie Klingenbach sie anstarrte. Was will er denn von mir, ich weiß, dass er nicht schuld ist an meiner Situation, arbeitslos mit fünfundvierzig! Ob es mein Alter war, das seine Entscheidung beeinflusst hat – sinnlose Grübelei, ich werde es nicht erfahren, jetzt nicht mehr, sie war entlassen. Die Sekretärin sah sie mitleidig an, wie sie seit Jahren abgewiesene Probelehrer mitleidig ansah, meinte, Ruth hätte eben doch zur Partei gehen sollen, ein Satz mit auf den Weg in die Zukunft.
Ruth warf das Taschentuch in den Abfalleimer, versuchte, wieder gleichmäßig zu atmen, den Schrecken wegzuatmen. Als sie in das Konferenzzimmer zurückkehrte, war ihr nichts anzumerken.
Ruth ging nach Hause, ohne sich umzudrehen. Kein Abschiedsblick, kein Blick mehr auf dieses Gebäude, auf die noch immer herausströmenden Schüler. Diese Straße von nun an meiden, die Umwege werden zahlreicher, auch dieser wird eines Tages überflüssig sein, das kennst du doch, und du wirst ihn trotzdem noch gehen, aus Gewohnheit, warum sonst.
Vor einem Spirituosengeschäft blieb sie stehen, betrachtete die Auslage, entschied sich schließlich für Wodka, davon, hatte sie gehört, würde man ohne Kopfschmerzen wieder zu sich kommen, aber vorerst wollte sie ja weg von sich, von diesem Gefühl der Sinnlosigkeit, diesem Ringen nach Luft, die Luft, die ich zum Atmen brauche, ist besetzt. Der erste Schluck schmeckte scheußlich, Ruth schüttelte sich, dann schüttete sie den Wodka in sich hinein. Sie hatte einen Trinkrhythmus gefunden, der ihr unerträgliche Gedanke, alles sei umsonst gewesen, von dem sie sich zugleich nicht trennen wollte, bestimmte ihn.
Als sie am nächsten Tag aufwachte, war sie entsetzt über sich.
Sie stellte sich unter die Dusche, beseitigte alle Spuren. Diesen Nachmittag hatte es nie gegeben.
Eine Woche lang gelang es Ruth, nicht an den Herbst zu denken. In der zweiten Woche beobachtete sie sich dabei, wie sie während des Vormittags öfter als sonst auf die Uhr sah. In der dritten Ferienwoche wartete sie bereits unruhig, bis sie die Post holen konnte – meistens Ansichtskarten aus dem Süden oder dem Westen Europas, manchmal aus ferneren Ländern, kaum Karten aus dem Norden, keine Karten aus dem Osten.
Der Aushilfsbriefträger kannte Ruth inzwischen, sie wechselten einige Sätze. Auch er studierte Englisch und Geschichte für das Lehramt, während der Sommerferien übernahm er die Arbeit als Briefträger. Er habe Glück, erzählte er Ruth, sein Vater sei bei der Post, er mache diese Arbeit bereits den fünften Sommer, es gebe kaum noch Ferialarbeiten, auch die Post nehme niemanden mehr auf, der ihr noch nicht bewiesen habe, dass er würdig sei, einzugehen unter ihr gelbes Dach. Wenn er Ruth sah, grüßte er sie mit einer verneinenden Kopfbewegung, um Sekunden verkürzte er damit ihr Warten. So weit war Ruth noch nicht, dass sie die Sekunden zählte, wer weiß, dachte sie, wann es so weit ist. Noch amüsierte sie sich bei der Beobachtung, wie sie den Aushilfsbriefträger tröstete, dem ihr Warten wie ein schlechtes Omen vorkam. In zwei Jahren werde er das Probejahr hinter sich haben, ob sie denn keine Parteikontakte habe, er habe sich umgehört, ohne Parteibuch könne sie gleich ihre Koffer packen.
Er redet schon fast wie einige meiner Kollegen, all diese Überzeugungsversuche, all diese öffentlichen Demütigungen, es ist doch nicht möglich, hatte sie oft gedacht, dass nur ich das so empfinde, nur ich diese Sätze nicht mehr hören kann, all diese „Glaube mir, ich hab auch einmal wie du gedacht, aber damit kommst du nicht weit, vergiss deinen Stolz und überwinde dich“-Sätze. Manchmal hörte sie diese Stimmen zu einem Chorgesang anschwellen: „Du bist nicht besser als wir, nur weil du ohne Stiefel durch den Matsch gehst, du änderst nichts, nur weil du dich weigerst, Stiefel anzuziehen!“ – rosarote Stiefel, schwarze Stiefel, braune Stiefel, Sie brauchen nur zu wählen, aber wählen Sie endlich! Die gültige Hauptmaxime ist alt: „Erkenne die Lage – das heißt, passe dich der Situation an, tarne dich, nur keine Überzeugungen … andererseits mach aber ruhig mit in Überzeugungen, Weltanschauungen, Synthesen nach allen Richtungen der Windrose, wenn es Institute und Kontore so erfordern …“ Diese Gedanken vertreiben, sie nicht gültig werden lassen wollen, besonders jetzt nicht, da alles für sie spricht und nichts für mich, von ihnen weggehen, auf und ab gehen, stolpern, über die Gedanken oder über das Telefonkabel, es ist wichtig für den Lehrer, dass er … Ruth lachte, erschrak vor diesem Lachen, das sich um ihr Erschrecken nicht kümmerte, nur langsam verebbte, wiederkam, als Ruth überlegte, welche Eigenschaft ihr eben verloren gegangen war. Wieder dieses Gefühl zu ersticken, woran denn nur, Ruth? Sie zwang sich, ihre Wohnung zu verlassen, kaum war sie im Freien, begann sie zu laufen, lief ihre Straße hinunter, der andere Blick, unbenannt, aber was kümmerte das die Augen, die heute die Risse in den Häusern bemerkten und die Dunkelheit in den Bassenawohnungen, die die Bretterverschläge zählten, diese Zeichen aufgelassener Hoffnungen. Ruth lief fast den ganzen Ring entlang bis zum Schwarzenbergplatz, dort stieg sie in den 71er, wohin sie fuhr, fiel ihr erst auf, als vor ihr zwei alte Frauen über die für sie immer beschwerlicher werdenden Fahrten zum Zentralfriedhof redeten und laut darüber nachdachten, wann wohl ihre letzte Fahrt dorthin gekommen sein würde. Ruth sah zum Fenster hinaus, die Sonderangebote für Grabsteine zwischen den Sonderangeboten für Gebrauchtwagen. Die gemiedenen Gräber, die gemiedenen Erinnerungen, jährliche Rechnungen von der Gärtnerei. Das Elterngrab, das Tantengrab – seit der Scheidung habe ich die Gräber nicht mehr besucht. Mit Walter gab es die Spaziergänge durch den Zentralfriedhof, waren die Toten erträglich, es gab sie nicht wirklich, sie waren eine Verpflichtung für ihn unter vielen Verpflichtungen, aber sein Blick wurde nicht zu meinem Blick; an der nächsten Haltestelle steige ich aus und fahre in die Stadt zurück.
Nur in der Literatur gefielen ihr die Friedhöfe noch immer.
Wiens tote, Wiens verstorbene Friedhöfe, Wiens sterbende Friedhöfe, und Friedrich Heer, der sie gekannt und die Erinnerung an sie lebendig erhalten hat, liegt heute selbst auf dem Zentralfriedhof, in einem Ehrengrab. Er hat es gewusst, die zu späte Ehre ist hier Alltag, Wiens Frieden: Hier ist er zu finden.
Das Warten auf die Montagpost begann am Samstag, am Sonntag wartete die Stille mit Ruth. Auf dem Fensterbrett gegenüber lehnte wie jeden Sonntag die dicke Frau, deren Körper das Fenster ausfüllte, sie würde den ganzen Nachmittag so verharren, wie ich in meinem Warten verharre, worauf wartet diese Frau? Ich sollte hinausfahren, baden gehen, mich ablenken! Warum bin ich nicht fähig, mich abzulenken, jedes Kind lernt das doch. Auch dieses Kind? Stadtkind, Einzelkind, Kriegskind – alle Kinder in diesem Land bisher Vorkriegskinder, Kriegskinder, Nachkriegskinder, Zwischenkriegskinder, Vorkriegskinder usw. –, Trümmerkind, Wunderkind, Enkelkind, Tantenkind. Selten dienten diese Worte als Information, kamen dementsprechend kaum in Antworten vor, sie wurden meist als Vorwurf verwendet, sieht man ihnen gar nicht gleich an. Neben diesen zusammengesetzten Hauptwörtern die Beifügungen zu dem Hauptwort Kind: Wer fügte dem Hauptwort „Kind“ das Eigenschaftswort „böse“ bei? Das böse Kind, als solches beugbar, ein gebeugtes Kind? Ein Kind, an das sich Ruth manchmal erinnerte, vielleicht auch jetzt.
Das Haus der Eltern in Wien, Krieg, die Nächte im Keller, das Kind halb schlafend in den Armen der Mutter, deren Stimme zitterte, während sie dem Kind Lieder vorsang, Märchen erzählte. Eines Nachts war das Kind wieder von den Sirenen aufgewacht. Es war das Zeichen, in den Keller zu gehen. Sie starrte die Tür an. Gleich würde sie aufgehen, die Mutter kommen, sie in die Arme nehmen und mit ihr in den Keller gehen. Die Tür blieb zu. Vor dem Fenster sah sie die Sterne vom Himmel zischen. Sie suchte schnell ihre Puppen zusammen, trug die Puppen in den Keller, sang so laut sie konnte, hielt sich dabei die Ohren zu, wollte ihre Stimme nicht hören, diese eine Stimme gegen die vielen Kriegsstimmen, die bis in den Keller reichten, und hörte die Frage dann doch: Ist die Mama tot? – Eine Puppe hatte sie das gefragt (immer noch war es die Puppe, die große mit den blonden Haaren und den schwarzen Augen, ein Geschenk des Vaters, die fragte), zögernd und leise, und das Kind war aufgesprungen und hatte die Puppe in die Ecke geschmissen, hatte sie wieder und wieder in die Ecke geschmissen, schreiend: „Du böses Kind, du böses Kind!“ Die Kellernächte, die Tage verbrachte sie hinter dem Küchenfenster, von wo aus sie die Gartentür sehen konnte. Saß nur da und starrte die Gartentür an, wie viele Tage lang. Erinnerte sich das Kind an seinem Fensterplatz an die Verhaftung der Mutter? Hatte es einen Namen für den Vorfall? War das Gefühl, die Mutter im Stich gelassen zu haben, erst entstanden, als die Mutter wieder zu Hause war und das Kind die eigene Mutter nicht wiedererkannte, oder entstand es gleich, als das Kind ihr gehorchte und weglief. Sie waren spazieren gegangen, plötzlich sprangen zwei Männer aus einem Auto, nahmen die Mutter zwischen sich, die Mutter wehrte sich, da schlugen die Männer auf sie ein, zerrten sie zum Wagen, das Kind riss an dem Mantel von einem der beiden Männer, der Mann bemerkte es nicht, das Gesicht der Mutter war blutverschmiert, aber sie konnte noch schreien, schrie: „Lauf weg! Lauf!“, und als sich nun doch einer der Männer nach dem Kind umdrehte, nach ihm griff, begann es zu laufen, lief und lief und läuft und läuft, dachte Ruth, wenn ich nicht gerade warte.
Warten oder, wenn ich es könnte, mich davon ablenken, zwischen diesen beiden Möglichkeiten wählen, wenn das eine Wahl ist und nicht nur Hohn. Wie viele sind wir, die nur warten? Diejenigen, die über uns bestimmen, sie wissen, was sie tun. Eine andere Stimme fragte sie: Wer sagt dir, dass du nicht allein bist? Vielleicht wartest nur du, während die anderen diesen Sommer genießen?
Unter der Woche hielt es Ruth an den Vormittagen nicht mehr zu Hause aus. Sie hatte sich einen eigenen Stadtplan gezeichnet, das also ist das Ergebnis, wenn ich mich ablenke – ein Behördenplan! Jeden Vormittag nun ihre Behördenrunde, jeden Vormittag umsonst. Da niemand da ist, der Ruth gefragt hätte, warum sie trotzdem geht, diese Frage aber nun einmal hier steht, bleibt ihr nichts anderes übrig, als sie aufzugreifen, vielleicht eines Morgens, bevor sie ihre Behördenrunde beginnt. Die Antwort zögert sie hinaus, bis sie auf der Straße steht, zwischen den Häusern ein Stück Himmel sieht, unter Menschen ist. Hier kommt die Antwort sofort: Ich gehe, um nicht verrückt zu werden. Und genau vor dem, was jetzt folgt, hat sie sich gefürchtet, diese Antwort zieht die nächste Frage nach sich: Wer sagt dir, dass du es noch nicht bist? Wer wie du Tag für Tag all diese Türgriffe in die Hand nimmt, nicht deshalb, um sich während eines vorübergehenden Schwächeanfalls daran festzuhalten, nicht, um vielleicht eine Untersuchung über die verschiedenen Materialien der Türgriffe an den Wiener Amtsgebäuden zu machen, nein, aus keinem anderen Grund als dem, den Türgriff hinunterzudrücken, einen nach dem anderen jeden Tag wieder hinunterzudrücken, immer in der Hoffnung, sie wären dazu da, die Türen, an denen sie befestigt sind, auch zu öffnen, hat der nicht viele Anhaltspunkte, an seiner Normalität zu zweifeln? Ruth erklärt sich für befangen.
Umsonst auch ihre Versuche, frühere Alltäglichkeiten weiterzuleben. Manchmal blieb sie vor einem Kaffeehaus stehen und dachte, es wäre Zeit, wieder einmal Zeitungen zu lesen.
Ihre Hände zuckten, die Daumenkuppen strichen über die anderen Fingerspitzen, strichen über ihr Lieblingspapier, fein und dünn, schreckten zurück vor grobem Papier, noch bevor die Augen sich weigerten, die fett gedruckten Schlagzeilen zu lesen. Während des Schuljahres war sie jeden Nachmittag in ein Kaffeehaus gegangen, hatte ein, zwei Stunden gelesen, hatte an den Tagen, an denen sie ihren Kaffeehausbesuch ausfallen lassen musste, das Gefühl, etwas versäumt zu haben.
Das Kaffeehaus war fast leer, die Zeitungen lagen geordnet auf drei Tischen, ein Tisch mit österreichischen Zeitungen, einer mit Zeitungen aus Deutschland und der Schweiz, einer mit fremdsprachigen Zeitungen. Sonst hatte sie sich die Zeitungen von den Sesseln und frei gewordenen Tischen zusammensuchen müssen, hatte oft auf eine Zeitung warten müssen, welch ein Luxus, heute warten die Zeitungen auf mich. Die Fingerspitzen suchten sich einige aus, die Freude des Wiedererkennens wurde ständig durch groß bedruckte, schreiende Zeitungen gestört, inzwischen färben sie auch ab, aber vielleicht haben sie das immer getan, und ich habe es nicht bemerkt.
Ruth ging mit den Zeitungen zu einem Tisch, legte sie neben sich, nahm die obenauf liegende in die Hand. Die zunehmende Unruhe, von der sie auch der Kaffee nicht ablenkte.
Wenigstens durchblättern muss ich sie, wenigstens überfliegen muss ich die Zeitungswirklichkeit, wenigstens versuchen muss ich es, andere Wirklichkeiten als mein Warten wahrzunehmen. Dieses vertraute Warten, die Kulissen änderten sich, die Schauspieler wechselten die Rollen, außer einer, die beharrte auf ihrer, kümmerte sich nicht darum, welches Stück gespielt wurde. Die Nische zwischen dem Schrank und der Wand zum Schlafzimmer der Mutter, die Augen fixierten die Tür. Der Kasten rückte manchmal näher, gleich würde er sie erdrücken, die Strafe Gottes, die verdiente Strafe, warum auch wollte sie sich nicht taufen lassen, sie hatte doch gespürt, wie wichtig es der Mutter war. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, das Wasser aus dem Taufbecken, sie hatte dann doch nachgegeben, hatte alles still über sich ergehen lassen, nur Neugeborene weinen bei der Taufe, aber nicht Vierjährige, die Dunkelheit in der Kirche, die Friedensglocken waren bereits wieder verstummt, zum ersten Mal in einer Kirche sein, all diese Gestalten, sie stürzen auf dich und holen dich, dann klebst du an den Wänden wie sie. Wo ist die Mutter? – Warte hier auf mich, ich komme gleich. Niemand kommt freiwillig in diese Dunkelheit. Die Strafen nahmen kein Ende, zu lange war sie des Teufels gewesen, die Lehrerin konnte sich gar nicht beruhigen, und Ruth konnte ihr die Frage, warum sie erst mit vier Jahren getauft wurde, nicht beantworten. Auch nicht am nächsten Tag. Die Tanten, bei denen sie nach dem Tod ihrer Mutter lebte, hatten nur vielsagende Blicke gewechselt. Diesen Blickwechsel kannte sie. Jetzt noch ein Wort von ihr, und Tante Vroni würde zu schreien anfangen, und Tante Inge würde sich mit ihrer Migräne zurückziehen. In Erinnerung geblieben waren die Drohung der Lehrerin: Dir werde ich den Teufel schon noch austreiben, und die tägliche Strafarbeit – hundertmal musste sie den Satz schreiben: Ich bin eine Sünderin, bis es der Lehrerin zu langweilig wurde und sie sich ein anderes Opfer suchte. Wann war das? Und wann war es, dass ich mich meiner Erleichterung zu schämen anfing? Dieses mühsame Lernen inmitten der Angst.
Weiße Mauern, weiß flimmernder Asphalt in der Julisonne, im Schatten erkannten die Augen das vertraute Grau. Kein blauer Fleck, keine blaue Tasche. Gestern ist Ruth dreimal hinuntergegangen, um nach der Tasche des Briefträgers zu sehen. Erst beim dritten Mal sah sie sie vor dem Nachbarhaus stehen. Sie ging zurück in den kühlen Hausflur, wartete dort auf den Briefträger. Dieses fremde Gesicht dann, alt und müde. „Wo ist denn Ihr Kollege?“ Der Briefträger zuckte nur mit den Schultern, verteilte die Post in die Fächer, steckte keinen Brief in ihr Fach. Nachdem er hinausgegangen war, sperrte Ruth es trotzdem auf und war wieder enttäuscht …
Anfang August klingelte um halb acht Uhr morgens das Telefon. Ruth starrte den Apparat an, das konnte nur die Schulbehörde sein, niemand, den sie kannte, rief während der Ferien um diese Zeit an. Die Hand, die den Hörer abnahm, zitterte. In ihrer Aufregung erkannte sie die Stimme nicht sofort. Der andere Teilnehmer glaubte, er sei falsch verbunden, entschuldigte sich, legte auf. Ruth hatte kein Wort gesagt. Außer mit dem Briefträger und den Verkäuferinnen hatte sie seit Wochen mit niemandem mehr geredet.
Sie versuchte einige Worte. Es läutete wieder, sie musste mehrmals hüsteln, bevor sie wenigstens ihren Namen nennen konnte. Es war Franz, ein Bekannter; zum Glück fragte er nicht nach ihrem Schweigen von vorhin, er hätte doch nur erneutes Schweigen zur Antwort bekommen. Martha, seine Mitarbeiterin, sei krank, sie habe ihm doch bereits öfters ausgeholfen, eine dringende Übersetzung aus dem Spanischen.
Ruth sagte zu. Einen ganzen Sommer nur warten, wer das könnte. Möchtest du es denn können? – Diese Frage wird sie nicht beantworten, sie ist bereits bei anderen Gedanken angelangt, nicht für die Schule, für das Leben lernen wir, dachte sie gerade, und wenn es das Falsche ist, was wir einmal lernten, und meinte damit ihr erstes, ihr Dolmetscherstudium, zum Überleben reicht es, muss es reichen. Dieses Überleben konnte sie sich noch nicht vorstellen; keine Stunden, wieder zurückkehren in die vorgegebenen Sätze, nur nicht das Unglück beschwören, jetzt werde ich abergläubisch.
Ruth fuhr zu Franz. Dachte, während sie auf die Straßenbahn wartete, wenn jetzt eine Tramway kommt, die von einer Frau gefahren wird, dann bekomme ich heute den Brief. Nein, das ist zu einfach. Es muss außerdem ein alter Waggon sein, in dem ein Schaffner mitfährt und an dessen Eisenstangen die schönen, abgewetzten Ledergriffe angebracht sind. Kein Schaffner, keine Lenkerin, keine Ledergriffe – die orangen Plastikgriffe bewegten sich in der Zugluft hin und her. Ruth setzte sich. Als sie später zufällig wieder die Griffe sah, bemerkte sie, dass sich diese nicht bewegten. Sie blieben in der Stellung stehen, in der die Hand sie zurückließ, die sich an ihnen festgehalten hatte.
An der nächsten Haltestelle stiegen zwei Kontrolleure ein, ein Bub eilte noch schnell zur Tür, presste die sich schließenden Türflügel auseinander, sprang hinaus. Ruth zuckte bei dem klickenden Geräusch, als sich die Kontrolleure ihre Kennmarken ansteckten, zusammen. Sie dachte, auch wenn du dieses metallene Klicken weiterhin hörst, hier, wo du jetzt bist, in dieser Tramway, hat es aufgehört. Wenn du es nicht glaubst, dann hör dich um. Du hörst Kinderlachen, eine junge Frauenstimme, die keifenden Stimmen des in Permanenz tagenden Wiener Straßenbahngerichtes, hörst die wiederholte Aufforderung: Fahrkarten vorweisen!, hörst Autogeräusche, die Geräusche der Straßenbahn, aber sonst, sonst hörst du nichts.
Franz erwartete Ruth bereits. Er hatte den Tisch gedeckt, ein Frühstück vorbereitet. Er hat es nicht vergessen, dass ein gutes Frühstück für mich noch immer etwas Besonderes ist. Bei der Mutter und später bei den Tanten gab es nur Milchkaffee und Marmeladebrote, nein, das war erst in den Fünfzigerjahren, vorher hatte es nicht einmal das gegeben. Und einmal gab es einen Frühstückstisch wie diesen, in einem Wiener Hotel, für ein Vater-Tochter-Frühstück, für ein Abschiedsfrühstück, das erfuhr Ruth erst durch das Gespräch der Tanten: „Es ist besser für sie, dass er wieder weg ist.“
Während sie mit dem Frühstück begannen, die Semmeln aufschnitten, sie mit Butter bestrichen, sich Kaffee einschenkten, die Eier schälten, erzählte Franz, dass Martha eines Tages zu ihm in das Zimmer gekommen sei, um ihm wie jeden Tag die Mappe mit den Briefen zu bringen. Wie immer sei Martha neben ihm stehen geblieben und habe gewartet. Franz schwieg, griff nach seiner Tasse, betrachtete sie, die Stille in dem Zimmer, dann das Geräusch, wie der Kaffee durch seine Kehle rann, Ruth nahm schnell ihre Tasse in die Hand und versuchte, das fremde Geräusch mit dem eigenen zu übertönen. Franz sah auf, sah kurz zu Ruth: „Die Briefbögen in der Mappe waren weiß, kein Wort stand auf ihnen, kein einziges Wort!“
Ruth legte ihre Semmel auf den Teller zurück.
Franz sprach weiter, ohne Ruth dabei noch einmal anzusehen. „Als ich Martha fragte, was das soll, ist sie zornig geworden. Sie hat mich beschimpft, ich, in meiner Überraschung, habe ihre Worte nicht verstanden. Als sie sich beruhigt hatte, habe ich ihr die weißen Briefbögen gezeigt. Martha hat darauf bestanden, dass nur noch meine Unterschrift fehle. Ich habe ihr wiederum die weißen Briefbögen gezeigt, so ging es ein paarmal hin und her.“
Franz war inzwischen aufgestanden, umkreiste den Tisch, Ruth begleitete ihn mit den Augen. Noch fragte sie sich, ob Franz ihr nicht einen Traum erzähle, die langen Pausen zwischen den einzelnen Sätzen, es war, als suche er nach Worten für Bilder und habe zugleich Angst, sie durch zu schnelle Benennungen zu vertreiben.
Er werde das Gefühl nicht los, mitschuldig zu sein an Marthas Verwirrung – wieder stockte er, fragte sich, ob es der richtige Ausdruck sei, beantwortete sich seine Frage nicht. Er, der täglich mit so vielen Formen des Wahnsinns konfrontiert sei, er hätte nicht so überrascht sein dürfen angesichts ihres Verhaltens. Er sei höflich gewesen, ruhig, abwartend, vernünftig, wie er es gewohnt sei zu sein. Vielleicht wäre es das einzig Richtige gewesen, die Briefbögen zu unterschreiben, und Martha hätte kurze Zeit später selbst bemerkt, dass der Inhalt fehle. Er habe einmal einen Satz gelesen, der ihm nicht mehr aus dem Kopf gehe: „Überall wurden Abenteuer bestanden, auf die es nicht ankam“ – ja, und nun wäre es darauf angekommen zu bestehen, wirklich zu bestehen …
Franz stand am anderen Ende des Tisches, den Kopf hielt er gebeugt. Ruth vermied es inzwischen, ihm nachzusehen, jedesmal, wenn er ihren Blick spürte, hatte er den Kopf geschüttelt, war sich mit der Hand über das Gesicht gefahren, als wollte er etwas wegwischen. Sie glaubte ihm jetzt, hörte ihm zu, in den Pausen versuchte sie, sich Martha vorzustellen, sich zu erinnern, wann sie Martha zuletzt gesehen hatte.
Es fiel ihr nicht ein.
In den letzten Tagen denke er immer öfter, vielleicht sei nicht Martha verwirrt, sondern er. Er, der immer noch an den Sinn dieser Briefe glaube, dieser nicht beantworteten oder nach Jahren beantworteten oder wenn es zu spät war beantworteten oder zynisch beantworteten Briefe. Wäre es nicht egal, ob sie mit oder ohne Inhalt weggeschickt würden. Vielleicht liege es wirklich an ihrer Arbeit: diese sich seit Jahren gleichenden Briefe, diese nicht endenden Berichte über immer neue Waffensysteme, Vernichtungskapazitäten. Vielleicht sei ihr die Arbeit schon lange sinnlos vorgekommen, auch er kenne diese Augenblicke, was ist, wenn sie nicht mehr aufhören? Nicht nur die Briefe, auch die Berichte hätten nichts genützt. Ja, wenn er ehrlich sei, kein Brief von all den Briefen, kein Bericht von all den Berichten habe etwas genützt; als lebten wir unter lauter Analphabeten! Er schlafe manchmal ein über der Arbeit, wie oft habe ihn Martha geweckt, aber er könne sich nicht erinnern, sie jemals geweckt zu haben. Ja, vielleicht sei sie die einzig Vernünftige.
Er jedenfalls habe angesichts der weißen Briefbögen unvernünftig reagiert. Er habe einen befreundeten Arzt angerufen, der habe Martha in das Krankenhaus bringen lassen. Martha habe sich geweigert, das Büro zu verlassen. Sie habe sich auf ihren Drehstuhl gesetzt, ihre Hände um die Lehnen geklammert und kein Wort gesagt. Sei nur dagesessen und habe sich gedreht. Dann sei alles sehr schnell gegangen, viel zu schnell.
Der Krankenwagen, die Wärter, alles weiß, nur noch weiß.
Jetzt sei sie in der Psychiatrie, die Ärzte seien ratlos, es könne genauso schnell vorbei sein, wie es gekommen sei, oder auch nicht.
Am Nachmittag besuchte sie Martha. Der Türöffner summte, der Gang vor ihr lang und leer. Martha lag in einem Vierbettzimmer, sie schlief. Ruth stellte sich einen Stuhl neben ihr Bett, wartete. Marthas Bettnachbarin kicherte: „Da können Sie lange warten, die haben sie vollgepumpt mit Medikamenten. Von allein wacht die nie auf. Das machen sie immer so mit den Neuen.“
„Martha, Besuch für dich!“, riefen plötzlich alle drei Frauen zugleich, wiederholten ihren Ruf so oft, bis Martha die Augen öffnete. Stille. Für alle hörbar Marthas langgezogenes: „Du!“ Fast keine Bewegung in ihrem Gesicht – dieses Gesicht, das Ruth kaum wiedererkannt hatte, mit roten Flecken überzogen, aufgequollen. Das nächste Wort verstand Ruth nicht. Marthas Bettnachbarin kicherte wieder, stand auf und holte Martha ein Glas Wasser. Martha bedankte sich, trank das Wasser, gab Ruth ein Zeichen, mit ihr auf den Gang zu gehen. Sie hängte sich bei Ruth ein: „Führ mich bitte zu dem Sessel dort.“ Aber es gab keinen Sessel. Gestern sei hier noch einer gestanden. Ruth holte einen Sessel aus dem Zimmer, Martha wartete an die Wand gelehnt. Kein Wort blieb ohne Echo in dem Gang. „Wann wird es wieder möglich sein zu gehen, was tun mit Füßen, die einen nicht mehr tragen?“ Martha zog ihre Pantoffeln aus, streckte die Beine von sich – den Beinen und den Füßen war nichts anzumerken. „Vielleicht versagt nur mein Gehirn, alles ist möglich, achtundvierzig Jahre habe ich gebraucht, um das zu begreifen.“ Martha zog ihre Pantoffeln wieder an, dann wollte sie von Ruth wissen, welche Veränderungen ihr an ihr auffielen: „Es gibt hier keinen Spiegel. Die Scheiben sind alle aus Milchglas. Mir fehlt mein Spiegelbild.“ Ruth erschrak – sie hatte sich nicht überlegt, wie sie mit Martha reden sollte. Nicht gerade ein rühmlicher Gedanke, er stempelt Martha ab, schließt sie hier ein, trennt sie von mir – wer misst die Entfernung? Ein Spiegel sein. Ruth hörte ihre Stimme, sie klang sanfter als sonst, ein beschlagener Spiegel, dachte sie, ein Spiegel, der nicht weiß, was es zu spiegeln gilt. Martha lehnte ihren Kopf zurück, atmete auf: „Das ist gut so“, flüsterte sie, „noch hässlicher soll ich werden, noch viel, viel hässlicher. Ich will so hässlich werden wie meine Mutter war, als sie aus dem KZ nach Hause kam. Unerkannt stand sie vor meinem Vater und mir. Als sie uns sagte, wer sie ist, habe ich zu stottern begonnen. Ma-Ma-Ma habe ich vor mich hingestottert, konnte gar nicht mehr aufhören damit. Jahrelang habe ich dann gestottert. Vater hat sich abgewandt und ist weggegangen. Manchmal kam er noch zum Schlafen nach Hause, die dünnen Wände, seine Stimme: ‚Mich ekelt vor dir‘ – der Ekel war zu hören, wie ihr Weinen zu hören war, ihr nächtelanges Weinen.“