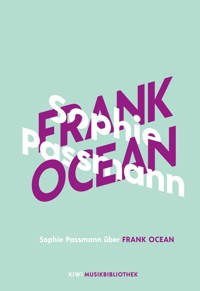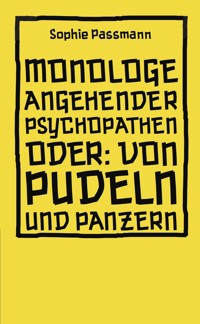9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nach ihrem vieldiskutierten Bestseller »Alte, weiße Männer« entlarvt Sophie Passmann in ihrem neuen Werk den unerträglichen Habitus einer Bürgerlichkeit, durch die sie selbst geprägt wurde. Eine Passmannsche Suada at its best. Bloß nicht so werden, wie alle anderen um sich herum. Bloß nicht so werden, wie man schon längst ist. Bloß schnell erwachsen werden, um in die transzendentale Form des Verklärens eintauchen zu dürfen, die Jugend als »die beste Zeit des Lebens« zu feiern. Sophie Passmann teilt aus gegen alle, am verheerendsten aber gegen sich selbst und ihresgleichen. Zornig und böse, sanft und lustig zugleich zieht sie uns mit rein ins tiefe Tal der bürgerlichen Langeweile im westdeutschen Mittelstand. Sie geht vehement vor gegen die hedonistische Haltung einer wohlgemerkt nicht homogenen Generation, die ihr selbst nur allzu bekannt ist. Dies ist kein Memoir, kein Roman, keine Biographie, es ist: literarischer Selbsthass. Das finden Sie anmaßend? Genau das ist es und genau das will Sophie Passmann: sich anmaßen, das zu tun, was sie tun möchte. Komplett Gänsehaut einfach!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sophie Passmann
Komplett Gänsehaut
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Sophie Passmann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Sophie Passmann
Sophie Passmann, Jahrgang 1994, ist scheinbar überall. Ihr Buch »Alte weiße Männer« war 47 Wochen in der SPIEGEL-Bestsellerliste. Sie schreibt eine Kolumne für das ZEITMagazin und macht einen wöchentlichen Kultur-Podcast. Im Mai 2020 moderierte sie »Männerwelten« auf ProSieben und löste damit eine gesellschaftliche Debatte aus. Im Internet folgen ihr 350.000 Menschen.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Nach ihrem viel diskutierten Bestseller »Alte, weiße Männer« entlarvt Sophie Passmann in ihrem neuen Werk den unerträglichen Habitus einer Bürgerlichkeit, durch die sie selbst geprägt wurde. Eine Passmann’sche Suada at its best. Bloß nicht so werden wie alle anderen um sich herum. Bloß nicht so werden, wie man schon längst ist. Bloß schnell erwachsen werden, um in die transzendentale Form des Verklärens eintauchen zu dürfen, die Jugend als »die beste Zeit des Lebens« zu feiern. Sophie Passmann teilt aus gegen alle, am verheerendsten aber gegen sich selbst und ihresgleichen. Zornig und böse, sanft und lustig zugleich zieht sie uns mit rein ins tiefe Tal der bürgerlichen Langeweile im westdeutschen Mittelstand. Sie geht vehement vor gegen die hedonistische Haltung einer wohlgemerkt nicht homogenen Generation, die ihr selbst nur allzu bekannt ist. Dies ist kein Memoir, kein Roman, keine Biografie, es ist: literarischer Selbsthass. Das finden Sie anmaßend? Genau das ist es und genau das will Sophie Passmann: sich anmaßen, das zu tun, was sie tun möchte. Komplett Gänsehaut einfach.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2021, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Patrick Viebranz
ISBN978-3-462-32043-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Prolog
Die Wohnung
Die Straße
Die Stadt
Dank
Do not whine
Do not complain
Work harder
Spend more time alone
Joan Didion
Prolog
Also: Ich halte es für überbewertet, mit siebenundzwanzig zu sterben. Ich denke, Jimi Hendrix und Janis Joplin haben da wirklich einen Fehler gemacht. Mit siebenundzwanzig fängt alles erst an, die ganze Jugend ergibt erst Sinn, wenn man lang genug durchhält, um sie hinter sich gebracht zu haben. Im Nachhinein von allem erzählen, das ist doch das eigentlich Geile. Dann ist alles nur noch Anekdote und Nostalgie und nicht Weltschmerz und Anstrengung.
Jimi Hendrix hatte einen Lebenstraum, er wollte eine Art universelle Sprache der Musik erfinden. Er ist gestorben, bevor er sich diesen Traum erfüllen konnte. Er ist gestorben, bevor er erkennen konnte, dass diese Idee vor allem keck klingt, aber nicht umsetzbar ist, so wie luxuriöses Camping oder deutscher Antifaschismus. Jimi Hendrix ist mit siebenundzwanzig Jahren gestorben, herrje, natürlich blieb sein Lebenstraum unerfüllt, er hat es vermutlich nicht mal geschafft, einmal im Leben ordentlich seine Steuererklärung zu machen und festzustellen, dass es eine finanzielle Verlustrechnung ist, eine Gitarre pro Konzert zu verbrennen. Janis Joplin hat bis heute eine Karriere als Konterfei in Hard Rock Cafes, das muss ja wirklich jeder selbst wissen, es gibt jedenfalls diese Geschichte über sie, wie sie auf der After-Show-Party ihres eigenen Konzerts im Central Park in New York traurig war, weil irgendein Kerl nicht mit ihr nach Hause gehen wollte. Sie soll dann später am Abend Patti Smith auf einem Hotelzimmer vollgejammert haben, was man sich wie eine Szene vorstellen kann, bei der man nicht unbedingt dabei gewesen sein will, Joplin jedenfalls: sehr aufgelöst, dass sie keinen Erfolg bei Männern hat, another night alone, soll sie zu Smith gesagt haben, und wie absolut kacke müssen die Zwanziger sein, dass man ein Konzert im Central Park gibt und danach traurig auf einem Hotelzimmer liegt, weil irgendein Kerl einem nicht unters Shirt wollte, es muss doch besser als das werden, siebenundzwanzig darf auf keinen Fall das Ende sein. Mit siebenundzwanzig ist jeder Haarschnitt immer noch nur eine Phase. Ganz langsam macht sich die Einsicht breit, dass man nicht sein ganzes Leben lang die Möglichkeit haben wird, sich für Zeug, das man tut, im Nachhinein zu schämen, irgendwann ist man richtig erwachsen, und dann endet die Ära, in der man sich später noch lustig entschuldigen darf für Dinge, die man getan hat, für T-Shirts und Beziehungen und witzige Piercings, die man zum Ende des Studiums einfach für eine hochemotionale Idee hielt, man steht so auf der Kippe zum richtigen Erwachsenensein, in den ersten Jahren nach der Volljährigkeit war das noch eine niedliche Pose, nicht zu wissen, wie man einen Ölwechsel macht oder eine Hühnersuppe, langsam ist es nur noch albern, die Leute lassen einen das spüren, langsam sollte man mal Verantwortung übernehmen für dieses lächerliche Leben, das man sich da im Laufe der letzten Jahre zusammengeklöppelt hat, für die Wohnungen, die man bezieht, die Straßen, durch die man fährt, und die Städte, die man hasst, irgendwann darf man nicht mehr einfach nicht kochen können und selbst gedrehte Zigaretten als Kern des eigenen Charakters ausgeben, da muss mehr kommen, und das, was da ist, muss dann auch hinterfragt und verteidigt werden, es wird ja ohnehin wahnsinnig viel hinterfragt, und das hat dann auch sicher seine Richtigkeit, und deswegen kommt irgendwann zwangsweise der Moment, in dem man entscheidet, dass jetzt auch mal gut ist, dann bezieht man mit großer Ernsthaftigkeit eine Wohnung und richtet sie ein, lernt, was das Wort toxisch auf Menschen bezogen bedeutet, und sortiert ein paar Freunde aus, hängt Bilder auf und sagt Partys ab, und dann fühlt sich alles an wie der Abend nach einer Beerdigung, wenn alle Gäste gegangen sind und es zum ersten Mal seit langer Zeit ruhig wird und man mit komischen Gefühlen alleine ist und sich denkt, ah, achso, scheiße. Dann fängt es an. Nicht das Leben, sondern viel eher, so zu tun, als wüsste man, was das Leben ist, so lange bis es einem passiert, sehr wissend nicken während Trennungen und Umzügen und Toden und Geburten, klar, so haben wir das immer schon gemacht. Das klingt alles anstrengend, es wird aber sicher super gewesen sein. So im Nachhinein betrachtet.
Erwachsene Menschen reden über ihre Jugend, als sei es dieses schillernde Ding gewesen, als wäre danach nichts Tolleres gekommen, Dir steht die ganze Welt offen, sagen sie, und das stimmt natürlich, aber es ist eben auch wahr, dass kein Mensch, der einigermaßen alle Gefühle beieinander hat, ernsthaft möchte, dass ihm die ganze Welt offensteht. Das scheinen Erwachsene zu vergessen, diese Hektik, diesen Stress, denn die scheiß Welt steht ja nicht einfach offen, sie drängt sich auf, später erzählt ist das sicher aufregend, wenn es gerade passiert, aber einfach nur irre anstrengend. Um irgendwann einer von den Erwachsenen werden zu können, der nostalgisch verklärt, wie Jungsein war, muss man Jungsein erst mal hassen und anfangen, die Welt zu zwingen, endlich nicht mehr offenzustehen, halt dein Maul, Welt, lass mich in Ruhe Döner essen, und dann sortiert man Stück für Stück die Sachen aus, die man nicht haben will, so lange, bis nur das bleibt, was man vielleicht nicht braucht, dessen Existenz man aber zumindest rechtfertigen kann, natürlich ist das lästig, herrje, alles ist lästig, das Machen, vor allem aber das Nichtmachen, das sagen die Alten einem ja ständig, und man kann so gut wegignorieren, dass sie leider recht haben. Nichtmachen ist die Hölle, deswegen steht man in seinen Zwanzigern so entsetzlich betriebsam in der Gegend rum, als gäbe es auch nur einen einzigen wichtigen Brief, der einen in diesem Kalenderjahr noch erreicht, jedenfalls zwingt man die Welt, endlich nicht mehr so unerträglich offen zu sein, und zwar tut man das mit Methode. Diese spezielle Form von Weltschmerz, diese empirisch sich aufdrängende Arroganz, zu glauben, dass man überall hinkönnte, wenn man nur wollte, die ist ja nicht bei allen jungen Leuten da, das ist das große Generationenmissverständnis, diese große Erzählung von den jungen Leuten, wie sie absichtlich ihre Turnschuhe kaputt laufen und sich verklemmt aufgeregt durch die Welt schleppen, in Wahrheit ist das nur ein Gefühl, das höchstens eine Handvoll junger Leute in jeder Generation wirklich verkörpern, das sind diese entsetzlich deutschen Vorstadtkinder mit ihren Tupperdosen voller Gurkenscheiben, die ganze scheiß Kindheit eine einzige abgeschnittene Brotkruste, wer so groß wird, empfindet den Tatort natürlich als krass, und diese Deutschen, die haben den Weltschmerz, und auf diese Deutschen wird natürlich gehört, und sie sind wichtig, und diese Deutschen tun alles mit brutaler Methode, so wie man das immer schon gemacht hat, es bietet sich also Folgendes an: Man geht vom Kleinsten zum Größten. Man betreibt einmal Inventur im ganzen Leben, man fängt bei sich zu Hause an, auf dem beschissenen Parkett in der ekelhaft hellen Altbauwohnung, geht weiter in die beschämend schöne Straße, und zuletzt guckt man auf die Stadt, in der man natürlich aus Absicht wohnt, das guckt man sich alles an, entscheidet, was davon dableiben darf, man zählt alles einmal durch und sucht Begründungen für die Anwesenheit von Designerstühlen und Erbschuld, nach dem Grund für das Ende von Mietverträgen und Lieben, das kann man also dann alles erklären und rechtfertigen, zumindest kann man so tun, zumindest kann man endlich mal wieder über sich selbst nachdenken, und dann steht die scheiß Welt nicht mehr offen, und dann ist endlich Ruhe.
Wäre das hier eine gute Geschichte, würde all dieser Kram passieren, der im echten Leben immer höchstens fast passiert. Ich würde immer mal wieder rauchend an Bars stehen, dabei sehr jung aussehen, bestimmt würde auch an Seen gestanden und auf Bürgersteigen gesessen, an irgendeinem Punkt würde ich mit einer halben Flasche Grauburgunder durch meinen komplett bescheuerten Stadtteil laufen, die Herleitung dieser, na ja, sagen wir mal Anekdote, wäre natürlich frech und ein wenig absurd, so wie das Leben mit siebenundzwanzig eben frech und absurd zu sein hat, was für eine Scheiße.
Es wäre alles deutlich einfacher, wenn die Geschichten, die junge Leute angeblich erleben, nicht immer so irre einfühlsam wären, so voller Erkenntnis in Elternhäusern und Liebeskummer auf Autobahnen, Großwerden ist meistens langweilig, oft stößt man sich an Tischkanten oder steht im Supermarkt und weiß nicht, ob es sich wirklich lohnt, den teuren Risottoreis zu kaufen, oder ob es nicht doch niemand merkt, wenn man wie immer Milchreis nimmt. Währenddessen fühlt man sich kein bisschen so, wie Jugend in Filmen immer aussieht, man denkt auch daran, dass die einzige Gewissheit, die man hat, die ist, dass die Leben von den Leuten, die so irre spannend im Internet aussehen, die nämlich, die Fotos posten von sich vor geschlossenen Bars, man weiß, dass deren Leben langweiliger und dümmer und vor allem ungeputzter sind als das eigene. Man weiß das. Und trotzdem bleibt an der Supermarktkasse dann so ein furchtbarer Restzweifel an sich selbst, genährt durch die Erkenntnis, dass die anderen Leute sich am Ende für den echten Risottoreis entschieden haben und einfach zu jeder Tageszeit elegante Menschen sind, selbst wenn niemand zuguckt. Wenn man siebenundzwanzig ist, wollen einem erwachsene Menschen brachial vermitteln, dass man gerade die Zeit seines Lebens haben sollte, aber die meiste Zeit meines Lebens verbringe ich damit, nicht zu wissen, was ich auf Netflix gucken soll.
Die Wohnung
In Filmen wird ja behauptet, dass es wichtig sei zu erklären, was bisher geschah, also vor dem Moment, an dem eine Geschichte anfängt, ihr fragt euch sicher, wie es dazu kam, sagt die Hauptfigur dann, in diesem Fall hier ist es allerdings völlig egal, was gestern passiert ist und an den Tagen davor, wie es dazu kam, wäre am Ende nur eine Nacherzählung meines bisherigen Lebens, und dafür bin ich zu jung, und dafür war mein Leben zu langweilig, bestimmt stand ich schon mal irgendwo rum, und bestimmt war ich schon mal auf einer Party, die anders lief als gedacht, alles im Rahmen, alles im Lauf.
Das Wetter in meinem bisherigen Leben war durchwachsen, viel durchwachsener wohl als das Wetter im Leben von alten Leuten, denn auch wenn so ein kollektives Lebensgefühl-Narrativ von Nachkriegsdeutschen behaupten darf, wir, also junge Leute, würden weder richtigen Sommer noch bitterkalten Winter kennen, wird das Wetter insgesamt ja immer durchwachsener, und ja, das ist der Moment, in dem ein überambitionierter Meteorologie-Jonas darauf hinweisen könnte, dass es eigentlich nicht das Wetter, sondern das Klima sei, das sich ändert. Ich weiß das. Ich weiß die meisten Sachen, ich lege aber selten Wert darauf.
In diesem Moment sitze ich auf dem Boden meines Wohnzimmers und trinke lauwarmes Sprudelwasser aus einer 1,5-Liter-PET-Flasche von Aldi, ja, das Wasser der armen Leute, das in Plastik eingeschweißt zu sechst verkauft wird und neunzehn Cent pro Flasche kostet, ich schlage die Spitzen meiner Schuhe gegeneinander, ich höre immer dieselben zwanzig Sekunden desselben Songs, ich will nicht drei Minuten und dreißig Sekunden warten, skippe rechtzeitig zurück, weil ich doch nur wegen dieser einen Stelle da bin, ungefähr so, wie man manchmal glaubt, nur wegen der drei Wochen Jahresurlaubs zu leben. Ich wohne jetzt in einem neuen Kiez, so nennt man seinen Stadtteil, wenn man den Nationalsozialismus noch nicht überwunden hat, dazu später mehr, vielleicht, und auch das klingt schon zu absichtlich, zu sehr wie der Beginn einer Geschichte, dabei wird das hier keine Geschichte, wirklich nicht, es ist eher Zufall, dass das alles hier beginnt. Irgendwann beschließt man, endlich ein richtiger Mensch zu werden, man geht einmal samstags auf den Markt und will einer von diesen Leuten sein, die das immer machen, einer dieser Menschen, die am Wochenende schön mal ein Stück Lammfleisch schmoren oder einen Stamm-Italiener haben, man kommt garantiert an diesen Punkt, mit einer Mischung aus deutscher Kleinbürgerlichkeit und einem Amtsgerichtsstolz will man es jetzt durchziehen, genau da befinde ich mich gerade, zwar ohne Wochenmarktbesuch und Lammschulter im Ofen bei Niedrigtemperatur, aber dafür ist diese Wohnung hier leer und damit voller neuer Möglichkeiten. Ich könnte jetzt also einer dieser Menschen werden, die bei eBay-Kleinanzeigen Art-déco-Möbel kaufen oder Sukkulenten züchten, ich könnte so tun, als hätte ich das immer schon gemacht, das ist ein offenes Geheimnis unter Leuten in meinem Alter, dass wir Dinge sehr plötzlich beginnen und dennoch so tun, als hätten wir das immer schon so gemacht, ich könnte also jetzt in diesem Moment in dieser leeren Wohnung entscheiden, ein Mensch werden zu wollen, der verschiedene Koriandersorten anbaut, und wenn mich die ersten Menschen besuchen kommen, sage ich, du, das habe ich immer schon gemacht.
Leute sagen oft, soundso viele Umzüge seien wie ein Hausbrand, sie sagen das irgendwie mahnend, als würde ihr schönes Zeug verloren gehen im Zuge des Wohnortwechsels, das Emaille-Sieb, das aggressiv pittoresk an der Wand hängt, das so eine Blut-und-Boden-Hausfraulichkeit ausstrahlt, irgendein signiertes Buch von irgendeiner Lesung, zu der man aus irgendeinem Grund gegangen ist, ein besonderer Brief, sie sagen das, als wäre es etwas Schlechtes, im Laufe des Lebens Krempel zu verlieren, mir kommt es allerdings gerade eher wie ein Versprechen vor: im Zweifel bei jedem Umzug sicherheitshalber das ganze Haus abbrennen, wirklich nur die Dinge mitnehmen, auf die man auf keinen Fall verzichten kann, den Rest in unendlich vielen Kellern von mehr oder weniger Blutsverwandten unterstellen, Sideboards bei Exmännern lassen, Möbel ghosten, bis niemand mehr weiß, wem sie gehören, den Sperrmüll mit dem Hinweis zu verschenken irgendwo in die Großstadt stellen. Dann zählt man das Zeug, das übrig geblieben ist, und fragt sich, was der neue Mensch, der man ja jetzt geworden ist, in diese leeren Ecken in dieser neuen Wohnung stellen würde, denn im Grunde geht es dabei, ein neuer Mensch zu werden, immer eher um das Zeug, das fehlt, als um das Zeug, das man hat, meistens fehlt ein schöner Beistelltisch für die scheiß leere Ecke in der scheiß leeren Wohnung, das richtige Airbnb für das lange Wochenende in Porto, das richtige Tonic zu diesem guten Gin, den man geschenkt bekommen hat, für das Gefühl, dass etwas fehlt, hört man erst auf, sich zu schämen, wenn man insgeheim im Glauben groß geworden ist, dass es eine Lücke gibt, deren Füllung das Leben einem noch schuldig ist, klar, das könnte jetzt gut und gerne Kapitalismus-Kritik werden, das Nichtkaufen ist ja viel absichtlicher und anstrengender als das Kaufen und so weiter, im Grunde geht es aber viel mehr um Kindergeburtstage. Das ganze verdammte Leben lang spricht man von den tollen Kindergeburtstagen, an denen der eigene Vater für alle Freunde gegrillt hat, dabei denkt man in Wahrheit ja immer nur an den einen, an dem er nicht da war, weil er länger arbeiten musste. Es geht immer um das, was fehlt, alles andere haben wir immer da. Es geht auch viel mehr um die Dinge, die man nicht mehr macht, als um die Dinge, die man sich gerade erst angewöhnt hat. Ich koche zum Beispiel kein Risotto mehr. Ich war früher so ein Mensch, der mit dem Partner nach Feierabend Risotto gemacht hat, was nichts anderes bedeutet, als in einer Altbauwohnung Italien spielen, es ist quasi Bildungsbürgertum-Cosplay, Menschen rühren so lange in Reis herum, bis sie glauben, sich wieder zu spüren, dabei hört man diese Spotify-Playlists, die fast schon beklemmend genau ein Lebensgefühl im Titel tragen, das man gerne hätte, ich mache mittlerweile kein Risotto mehr, und den Partner gibt es, relativ gesprochen, auch nicht mehr, weil ich an einem dieser Risotto-Abende despektierlich über die Beatles gesprochen habe, irgendwann liefen nämlich die Beatles, und ich seufzte beim Risottorühren laut, ich sagte wirklich: Hach,man darf die Beatles auch einfach nicht überbewerten, woraufhin wir uns fürchterlich stritten, noch bevor wir den Parmesan beigeben konnten, ging es um Respekt und Wertschätzung und all solche Themen, im Nachhinein betrachtet hätte die Tatsache, dass wir an diesem Abend nicht mal mehr den Friséesalat mit Orangenfilets zubereiteten – wir hatten das Rezept wie so Arschlöcher aus dem SZ-Magazin abfotografiert –, mich wissen lassen müssen, dass das alles nicht gut gehen konnte. An diesem Abend streute er keine Kräuter auf das fertige Risotto, normalerweise machte er das und sagte: für die Farbe. Wir saßen oft am Küchentisch, er machte immer diese eine Sache mit seinen Haaren, die ich hier beschreiben könnte, die aber nur für mich besonders wäre. Wir fuhren auch ab und zu mal ans Wasser, das war nicht immer besonders, wir hatten diesen einen Song und diese eine besondere Art, dieses eine Wort zu betonen, wir platzierten es manchmal heimlich in Gesprächen mit anderen und warfen uns dann Blicke zu, die die anderen nicht verstanden, ganz schön arrogant, so im Nachhinein betrachtet.
Liebeskummer ist das emotionale Äquivalent zu einem verlängerten Wochenende in Zürich, extrem teuer und am Ende den Aufwand nicht wert, man sieht sich ja so schnell satt an blauen Seen wie man von interessanten Emotionen genug hat, ich werde nicht über gemeinsame Erlebnisse sprechen, über schöne Erinnerungen, hier wird nicht geschwelgt, auf keinen Fall, ich habe nicht vor, nachdenklich auf Bürgersteigen zu sitzen und mir von interessierten Passanten Zigaretten anbieten zu lassen, die ich dann natürlich einfühlsam und distanziert beschreiben würde. Sie alle, die Passanten, hätten gute Hosen und Pullover mit ironischen Drucken an, sie mögen diese eine Platte von Mumford & Sons ganz gerne, würden es heute aber nicht mehr zugeben, niemand von denen trinkt gerne Bier, es schmeckt einfach komisch bitter, wenn sie auf der Straße zufällig Bekannte treffen, beenden sie den Small Talk mit einer Telefonhörergeste und dem Satz Wir sprechen, ja?, wir kennen die ja alle, wieso sollte man das aufschreiben. Egal. Das auf alle Fälle ist, was bisher geschah.
Die Leute, die das mit der Anzahl der Umzüge und den Bränden sagen, legen auch besonderen Wert auf die erste Nacht in einer neuen Wohnung, irgendwas mit Träumen und Wünschen, die wahr werden. Die erste Nacht ist auch die beste, weil dann der ganze Krempel, der einen erst zu der Person macht, die man selbst ist und die auch jede andere Person ist, die da herkommt, wo man selbst herkommt, noch nicht in den Räumen aufgebahrt ist, das Instrument, das man früher mal gespielt hat nämlich, die eine Monstera auf dem Hocker, eine Fotografie von Helmut Newton, diese Tischuntersetzer für nette Abendessen mit Freunden, bei denen immer irgendjemand aggressiv Auberginen im Ofen röstet, als hinge sein Leben davon ab, das Lammfell von IKEA auf der Holzbank an der Wand in der Küche, wo man sich dann hinkuscheln kann, wenn man denn will, der Aschenbecher, der eigentlich ein umgedrehter Terrakotta-Blumentopf ist, in dem die nachdenklichen Frauen und die Typen mit Macher-Mentalität im Laufe einiger Jahre Freundschaft ihre NILs ausdrücken können, das Poster von Pulp Fiction im Bad und die Postkarte von Monty Python am Kühlschrank. In der ersten Nacht hat man eine Matratze auf dem Boden, und zwar eine ordentliche, weil man sich mittlerweile für Rückengesundheit interessiert, man kennt jetzt auch das Wort Schlafhygiene, Schlafhygiene ist ja so wichtig,