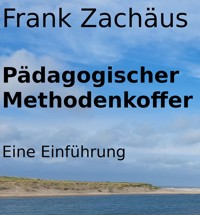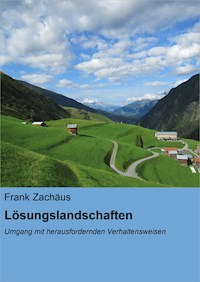6,49 €
Mehr erfahren.
Wenn Unternehmen erfolgreich sein wollen, sowohl wirtschaftlich als auch in der Erreichung ihrer internen Ziele, dann ist dies nur möglich, wenn Konflikte gut gemanagt werden und es eine eine gute und wertschätzende Kommunikationskultur gibt. Dysfunktionale Kommunikationsstrukturen behindern und schmälern den Unternehmenserfolg. Wer Erfolg haben möchte, der muss Konflikte managen. Das Management von Konflikten wird in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Dies erklärt sich zum einen aus der steigenden Komplexität der anfallenden Probleme in Organisationen und in deren Umwelt, sowie zum anderen aus der gestiegenen Möglichkeit an Kommunikation innerhalb des Unternehmens aufgrund der Einführung von teamorientierten Strukturen in Folge der Enthierachisierung. Dies bedingt ein Ansteigen des Konfliktpotentials innerhalb des Unternehmens. Der Erfolg, die Effizienz, die Produktivität und die Humanität eines Unternehmens wird in Zukunft von dessen Fähigkeit zur konstruktiven Konfliktbewältigung mitentschieden werden. Wer Konflikte nicht löst, aussitzt oder sie per Machtentscheid aus der Welt zu schaffen sucht, wird nicht in der Lage sein, seine Organisation innovativ an eine sich verändernde Umwelt anzupassen. Die Organisation wird in ihren Strukturen verharren und erstarren und schließlich den veränderten Umweltbedingungen nicht mehr gerecht werden können. Sie kann dann ihren Daseinszweck, das Erwirtschaften von Gewinnen, nicht mehr erfüllen und wird in der bestehenden Form aufhören zu existieren. Daher ist eine konstruktive Konfliktbearbeitung notwendig, um innovativ sich an der veränderten Umwelt anpassen zu können. Doch wie kann man Konflikte konstruktiv nutzen? Was sind überhaupt Konflikte? Welche Strategien gibt es, um sie zu lösen? Wo liegen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien? Welche Techniken und Methoden benötigt man zur konstruktiven Konfliktbewältigung? Wie wirkt sich eine Eskalation auf den Konflikt aus? Warum eskaliert ein Konflikt? Welche Kompetenzen benötigt die Führungskraft als Konfliktmanager? Alles Fragen, die diese Abhandlung beantwortet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Konflikte und ihre Bewältigung
in Organisationen
Eine grundlegende Einführung
in das Management
von Konflikten in Organisationen
0. Einleitung
Wenn Unternehmen erfolgreich sein wollen, sowohl wirtschaftlich als auch in der Erreichung ihrer internen Ziele, dann ist dies nur möglich, wenn Konflikte gut gemanagt werden und es eine eine gute und wertschätzende Kommunikationskultur gibt. Dysfunktionale Kommunikationsstrukturen behindern und schmälern den Unternehmenserfolg. Wer Erfolg haben möchte, der muss Konflikte managen.
Das Management von Konflikten wird in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Dies erklärt sich zum einen aus der steigenden Komplexität der anfallenden Probleme in Organisationen und in deren Umwelt, sowie zum anderen aus der gestiegenen Möglichkeit an Kommunikation innerhalb des Unternehmens aufgrund der Einführung von teamorientierten Strukturen in Folge der Enthierachisierung. Dies bedingt ein Ansteigen des Konfliktpotentials innerhalb des Unternehmens. Der Erfolg, die Effizienz, die Produktivität und die Humanität eines Unternehmens wird in Zukunft von dessen Fähigkeit zur konstruktiven Konfliktbewältigung mitentschieden werden. Wer Konflikte nicht löst, aussitzt oder sie per Machtentscheid aus der Welt zu schaffen sucht, wird nicht in der Lage sein, seine Organisation innovativ an eine sich verändernde Umwelt anzupassen. Die Organisation wird in ihren Strukturen verharren und erstarren und schließlich den veränderten Umweltbedingungen nicht mehr gerecht werden können. Sie kann dann ihren Daseinszweck, das Erwirtschaften von Gewinnen, nicht mehr erfüllen und wird in der bestehenden Form aufhören zu existieren. Daher ist eine konstruktive Konfliktbearbeitung notwendig, um innovativ sich an der veränderten Umwelt anpassen zu können.
Doch wie kann man Konflikte konstruktiv nutzen? Was sind überhaupt Konflikte? Welche Strategien gibt es, um sie zu lösen? Wo liegen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien? Welche Techniken und Methoden benötigt man zur konstruktiven Konfliktbewältigung? Wie wirkt sich eine Eskalation auf den Konflikt aus? Warum eskaliert ein Konflikt? Welche Kompetenzen benötigt die Führungskraft als Konfliktmanager? Alles Fragen, die diese Abhandlung beantwortet.
Essen, den 18.12.2023
F. Zachäus
1. Organisation und ihr Konfliktpotential
Unternehmen, unabhängig ihrer Größe, sind Organisationen. Unter Organisationen im engeren Sinn verstehen Becker/Langosch „ [...] die Koordinierung und die innere Ordnung eines Systems, die ein einwandfreies Funktionieren gewährleisten soll.“ (Becker/Langosch 1995, S. 2). In der Definition des Begriffes Organisation fällt aber noch ein anderer Begriff auf, der sich sehr gut zur Beschreibung eines Unternehmens eignet: dieser Begriff heißt System. Der Begriff Organisation bezeichnet einen spezifischen Strukturzustand in einem System.
Unter einem System kann eine Anzahl von in Wechselwirkung stehenden Elementen verstanden werden (vgl. Kneer/Nassehi 1997, S. 20). Ein Unternehmen ist ein System, das sich dadurch auszeichnet, daß zwischen seinen Teilelementen (z.B. verschiedene Abteilungen, verschiedene Personen) wechselseitige Beziehungen bestehen. So tritt der Abteilungsleiter A mit dem Abteilungsleiter B in Beziehung, um sich zu erkundigen, warum er über den Vorfall X nicht informiert worden ist. Dennoch läßt sich diese Beschreibung noch weiter differenzieren. Ein Unternehmen ist nicht nur ein System, sondern es ist ein soziales System, was sich deutlich von anderen System (Unternehmen) abgrenzt. Unter einem sozialen System versteht Luhmann den Zusammenhang von aufeinander verweisenden sozialen Handlungen (vgl. Kneer/ Nassehi 1997, S. 38). Dieses soziale System grenzt sich durch den Zusammenhang von aufeinander verweisenden Handlungen von anderen sozialen Systemen ab. Diese anderen sozialen Systemen nennt Luhmann Umwelt. Jedes soziale System operiert also in einer nicht zum sozialen System gehörenden Umwelt (vgl. Kneer/Nassehi 1997, S. 38). Diese Umwelt bildet für das soziale System Unternehmen den Handlungsspielraum.
Das soziale System Unternehmen läßt sich durch seinen Arbeitsablauf beschreiben, in dem aufeinander bezogene Handlungen zur Erledigung von Arbeitsaufgaben ausgeführt werden. Das Ziel bzw. die Funktion von sozialen Systemen ist die Reduktion der Komplexität der Welt. Dies geschieht durch die Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten innerhalb des sozialen Systems (vgl. Kneer/ Nassehi 1997, S. 40). „Soziale Systeme reduzieren die Weltkomplexität, in dem sie Möglichkeiten ausschließen.“ (Kneer/ Nassehi 1997, S. 41).
Unternehmen als organisierte soziale Systeme müssen sich von ihrer Umwelt abgrenzen. Diese Abgrenzung erfolgt durch die Aufstellung von Bedingungen an die Mitgliedschaft von Personen in der Organisation. Dies geschieht durch die formale Regelung des Ein- und Austrittes in und aus die/der Organisation und durch die Auferlegung bestimmter Handlungserwartungen, die an das Mitglied herangetragen werden (vgl. Kneer/ Nassehi 1997, S. 43). Die Umwelt eines Unternehmens ist die gesamte restliche Welt mit all ihren Möglichkeiten. Zwischen System und Umwelt bestehen Anknüpfungspunkte. Sie können in Verbindung zueinander treten. Soziale Systeme grenzen sich aber noch durch eine andere Besonderheit von ihrer Umwelt ab. Soziale Systeme sind geschlossen und beziehen sich ausschließlich auf sich selbst. Dabei bestehen soziale Systeme aus mindestens zwei psychischen Systemen. Diese psychischen Systeme sind organisationell geschlossen und damit autonom. Alles was sie zu ihrem Funktionieren benötigen, stellen sie selbst her. Sie sind Autopoietisch. Zugleich sind lebende Systeme auch offen, da sie in der Lage sind, mit der Umwelt durch das Verbindungsglied Kommunikation in Kontakt zu treten. Dieser Gedanke trifft auch für Organisationen wie ein Wirtschaftsunternehmen zu.
Die nicht-auflösbare Letzteinheit von sozialen Systemen ist die Kommunikation. Sie ermöglicht es den sozialen Systemen, sich selbst zu erhalten und immer wieder neu zu erzeugen (vgl. Kneer/ Nassehi 1997, S. 65). Soziale Systeme sind daher Kommunikationssysteme. Innerhalb des sozialen System kann kommuniziert werden, aber ebenso kann das soziale System mit seiner Umwelt kommunizieren. Durch Kommunikation an Kommunikation wird der Bestand des sozialen Systems erhalten.
Jedes System stellt eine Reduktion der Komplexität der Welt dar. Dies kann ein System gewährleisten, in dem es Strukturen ausbildet (vgl. Kneer/ Nassehi 1997, S. 93). Die Struktur strukturiert, so könnte man sagen, die fortlaufende Produktion der Kommunikations-Möglichkeiten des Systems, in dem sie die Nutzung bestimmter Kommuikations-Möglichkeiten wahrscheinlicher macht als andere (vgl. Kneer/ Nassehi 1997, S. 93). Die Strukturen zeigen sich in sozialen Systemen an konkret geknüpften Erwartungen. Oftmals drücken sich diese Erwartungen (besonders in einer Organisation) in Regeln aus. Diese Regeln legen das Handeln der Personen in bestimmten Situationen fest. Dadurch wird der Handlungsspielraum des Systems begrenzt (vgl. Giddens 1995, S. 66ff.) und es kommt zu einer Reduktion der Komplexität der Welt. Die Regeln beziehen ihre Stärke und Kraft aber nicht aus einem Verbot von bestimmten Handlungen, sondern aus dem Ermöglichen von Handlungen (vgl. Giddens S. 77ff. und S. 222ff.). In jeder Organisation findet man Regeln, die die Handlungen ihrer Mitglieder in spezifischen Situationen festlegen bzw. die bestimmte Handlungen erwartbar machen. Diese Regeln werden sichtbar in Aufgabenbereiche, Arbeitszeiten, Ausschlußverfahren, Lohnvergütung, Arbeitsplatzbeschreibungen usw.
Damit die kurze Beschreibung einer Organisation mit systemtheoretischem Vokabular ausreichend sichergestellt werden kann, ist die Einführung eines weiteren Begriffes hilfreich. „Der Begriff Systemdifferenzierung bezeichnet die Wiederholung der Systembildung im System. Die so entstanden Teilsysteme sind sich dann in einem wechselseitigen System-Umwelt-Verhältnis, hier System/ gesamtsysteminternen Umwelt, gegeben.“ (Kneer/Nassehi 1997, S. 116). Dieser Begriff ist wichtig, zur Beschreibung der internen Differenzierung eines Unternehmens.
Ein Unternehmen ist also ein geschlossenes, aber im Kontakt zur Umwelt stehendes System. Zur Umwelt eines Unternehmens gehören die technische Infrastruktur bestehend aus Straßen, Schienen, Rohrleitungen und dergleichen, aber auch die anderen sozialen Systeme wie die Kunden, der Markt, die Berufsschule usw. (vgl. Gukenbiehl 1995, S. 107-108). Ein Unternehmen grenzt sich deutlich von anderen Unternehmen ab. Dies geschieht z.B. durch die Herstellung verschiedener Produkte oder einer anderen Unternehmenskultur und -identität.
Ab einer gewissen Größe kann es innerhalb des Unternehmens zu Differenzierungsprozessen kommen. Das System bildet Subsysteme, die füreinander wieder Umwelt sind, aus. Innerhalb des Unternehmens ist die Kommunikation das Erzeugungsmittel des Unternehmens und zugleich stellt die Kommunikation das Verbindungsglied zu ihrer Umwelt dar. Das Unternehmen reduziert die Komplexität der Welt durch die Schaffung von Strukturen. Jedes Unternehmen schaut also immer nur auf einen bestimmten Teil der Welt. Die Strukturen eines Unternehmens reduzieren nicht nur die Komplexität der Welt, sondern sie regeln die Kooperation der einzelnen Mitarbeiter und der verschiedenen Organisationseinheiten (vgl. Gukenbiehl 1995, S. 106).
Jedes Unternehmen verfolgt die verschiedensten Ziele. Ein Ziel, was alle Profit-Organisationen verfolgen, ist die Erwirtschaftung von Gewinn und Kapital. Daneben können sie noch die verschiedensten Ziele verfolgen, so z.B. den besten Kundenservice des Landes aufzubauen. Bei Non-Profit-Organisationen lassen sich kein Ziele finden, die für alle Non-Profit-Organisationen gelten könnte. Ihre Ziele hängen vom Grund und dem Zweck ihrer Gründung ab. In den meisten Unternehmen sind die Ziel in Gesetzen, Satzungen, Konzeptpapieren, Visionen oder dem Handelsregister festgelegt (vgl. Gukenbiehl 1995, S. 106).
In der Organisation eines Unternehmens lassen sich drei große Subsysteme identifizieren:
das geistig-kulturelle Subsystem
das politisch-soziale Subsystem
das technisch-instrumentelle Subsystem (vgl. Glasl 1992, S. 116).
Diese drei Subsysteme lassen sich in jedem Unternehmen unabhängig von der Größe finden. Sie setzen sich aus einer Vielzahl von Elementen zusammen.
1. Im geistig-kulturellen Subsystem lassen sich zwei Elemente identifizieren: Identität und Policy/ Strategie.
Zur Identität eines Unternehmens gehört die gesellschaftliche Aufgabe der Organisa-tion, ihre Mission, ihr Sinn und Zweck, ihr Fernziel, ihre Philosophie, ihre Grundwerte, ihr Image nach innen und nach Außen und das historische Selbstverständnis der Organisation.
Zur Policy/Strategie eines Unternehmens gehören die langfristigen Programme des Unternehmens, die Unternehmenspolitik, Leitsätze, Strategien, langfristige Konzepte und Pläne (vgl. Glasl 1992, S. 116).
2. Im politisch-sozialen Subsystem lassen sich drei Elemente festmachen: die Struktur; Menschen, Gruppen und Klima; Einzelfunktionen und Organe.
Zur Struktur des politisch-sozialen Subsystem gehören die Aufbauprinzipien des Unternehmens, die Führungshierarchie, Linien und Stabsstellen, zentrale und dezentrale Stellen und das formale Layout.
Zu dem Element der Menschen, Gruppen und Klima gehören das Wissen und Können der Mitarbeiter, Haltungen und Einstellungen, Beziehungen, Führungsstile, informelle Zusammenhänge und Gruppierungen, Rollen, Macht, Konflikte und das Betriebsklima.
Zu dem Element der Einzelfunktionen und Organe gehören die Aufgaben der Mitarbeiter, die Kompetenzen und Verantwortungen, Aufgabeninhalte der einzelnen Funktionen, die Gremien, die Kommissionen, die Projektgruppen, die Spezialisten und die Koordination (vgl. Glasl 1992, S. 116).
3. Als drittes Subsystem existiert das technisch-instrumentelle Subsystem. Zu diesem Subsystem gehören die Elemente Prozesse/Abläufe und physische Mittel.
Zu dem Element der Prozesse und Abläufe gehören die primären, sekundären und tertiären Arbeitsprozesse, Informationsprozesse, Entscheidungsprozesse, Planungs- und Steuerungsprozesse.
Zu dem Element der physischen Mittel gehören die Instrumente, Maschinen, Geräte, Materialien, Möbeln, Transportmitteln, Gebäude, Räume und finanzielle Mittel (vgl. Glasl 1992, S. 116).
Anhand dieses Modells lassen sich für die Erkundung des Konfliktpotentials der verschiedenen Elemente folgende Fragen formulieren:
„1. Identität: Ist die Kernaufgabe der Organisation klar? Ist sie widersprüchlich, missverständlich, vage? Hat sich in der letzten Zeit ein Wandel der gesellschaftlichen Funktion ergeben? Sind alte Werte und neue Werte zueinander stimmig? Ist die Identität gesellschaftlich akzeptabel? Wie stellt sich die Identität zur Umwelt? Wie stehen die Menschen zum Selbstverständnis? Ist die Sinngebung für sie in ihrer eigenen Funktion erkennbar – überzeugend? [...]
2. Policy/Strategie: Bestehen ausreichend Leitsätze, Strategien und Programme, mit denen die allgemeinen Ziele und Werte konkretisiert werden? Oder schweben die allgemeinen Ziele und Werte (Identität) in der Luft? Geht von den unternehmenspolitischen Leitsätzen eine integrierende Wirkung aus? Wie kräftig, klar, übersichtlich, widerspruchsfrei usw. sind die Leitsätze? Wie sehr sind Politik und Strategie akzeptiert? [...]
3. Struktur: Nach welchen Gedankenmodellen ist die Organisation aufgebaut? Liegt der Aufbaustruktur ein statisches oder dynamisches Denken zugrunde? Ist dabei mechanistisch gedacht? Wie steht dieses Organisationsdenken zur gesamten Unternehmensphilosophie? Wie zweckmäßig sind die Organisationskonzepte in bezug auf die gegenwärtigen Ziele, Kernaufgaben, Ressourcen usw.? Sind die verschiedenen Organisationseinheiten für die Mitarbeiter übersichtlich? Können sie sich erlebnismäßig in ihnen zurechtfinden und darin eine neue ‚Heimat‘ finden? Wie wird von der Struktur die Spannung zwischen Differenzierung und Integration bewältigt?
4. Menschen, Gruppen und Klima: Wie werden die Mitarbeiter in ihrem Wissen und Können angesprochen? Welche Ziele und Ambitionen haben die Menschen? Sind die Menschen in unterschiedlichem Maße zur Leistung motiviert? Woran wird das sichtbar? Welche informellen Zusammengehörigkeiten und Gegnerschaften haben sich gebildet? Wo gibt es Distanzen – wo Nähe? Vertrauen oder Mißtrauen? Welche Bedeutung haben Macht, Status, Prestige, Karriere usw.? Was ist charakteristisch für das Betriebsklima? Wie berücksichtigt die Organisation die Entwicklungsinteressen der Mitarbeiter? Welche Stile sind charakteristisch für die Führung? Wie werden menschliche und soziale Faktoren berücksichtigt und gepflegt? [...]
5. Einzelfunktionen und Organe: Nach welchem Prinzip ist die Arbeit über die Funktionen verteilt; nach gleichem Fachhintergrund, nach gleichartiger Verrichtung usw.? Sind es sinnvolle Ganzheiten – oder willkürliche bzw. logische Trennungen und Zuteilungen? Sind Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander? Wieviel an eigener Planung und Kontrolle gehört zur Funktion? Welchen gegenseitigen und einseitigen Abhängigkeiten ergeben sich aus der Aufgabe und Kompetenzverteilung? Wie akzeptieren dies die Menschen? Wie sehr können die einzelnen Funktionen den Sinn des Ganzen vermitteln?
6. Prozesse und Abläufe: Wie gut schließen die einzelnen Funktionen im Ablauf aufeinander an? Gibt es im Ablauf Staus, Engstellen, unnötige Umwege oder Verzögerungen, Doppelgleisigkeiten und dergleichen? Orientieren sich die Abläufe an den Arbeitszielen? Wie werden die Prozesse geplant und gelenkt? Welche Abhängigkeiten ergeben sich daraus? Wie stehen die Menschen dazu? Wieviel Orientierung geben ihnen Unternehmenspolitik, Strategie, Strukturkonzepte usw.?
7. Physische Mittel: Wie menschengerecht (ergonomisch richtig) sind die Maschinen und Mittel? Wie zweckmäßig oder zweckwidrig sind Instrumente, Gebäude usw.? Wo bedingen die physischen Mittel eine Trennung, wo sie aus ablauflogischen Gründen nicht sein sollten? Wie wirkt sich dies auf die Menschen aus?“ (Glasl 1992, S. 116-118).
Anhand dieser Fragen lässt sich das Konfliktpotential eines Unternehmens bestimmen. Bei einem Konfliktmanagement können diese Fragen hilfreich sein, um die Art und den Inhalt der Konfliktintervention differenzierter bestimmen zu können. Durch die Beantwortung der Fragen kann das jeweilige konfliktträchtige Subsystem des Unternehmens in den Fokus der Konfliktintervention geraten. Zudem können die Fragen dazu benutzt werden, Interventionen zur Senkung des Konfliktpotentials zu entwerfen. Das Konfliktmanagement würde zu einem Prozess der Organisationsentwicklung.
Den jeweiligen Subsystemen eines Unternehmens lassen sich im nächsten Schritt Typen von Organisationen zuordnen. Glasl nennt drei Typen von Organisationen:
Die professionelle Organisation:
Bei der professionellen Organisation geht es vornehmlich um das kulturelle Subsystem. Der Organisationszweck der professionellen Organisation ist das Produzieren von Ideen (z.B. Forschungsinstitute). Daher richtet sich die professionelle Organisation „in erster Linie auf die Befriedigung geistiger Bedürfnisse“ (Glasl 1992, S. 133) ein. Als wichtigstes Gestaltungsmittel fungiert die professionelle Freiheit der Mitarbeiter. Daher ist ein autoritärer Führungsstil abträglich für die Erfordernisse der professionellen Organisation. Für sie bietet sich eine kollegiale oder horizontale Führung an. Durch Gespräche und gemeinsame Entscheidungsfindung drückt sich die horizontale Führung aus. Erst hierdurch können Ideen kreativ und ohne organisatorische Hindernisse entwickelt werden. Dies bedeutet einen Verzicht auf einengende bürokratische Kontrollmechanismen.
Aus der Art der professionellen Organisation kann sich folgendes Konfliktpotential ergeben:
Die Freiheit der Mitarbeiter wird eingeschränkt.
Die professionelle Arbeit wird nur nach wirtschaftlichen Kriterien bewertet, so dass die professionelle Arbeit in Zwangssituationen geführt wird.
Durch starre bürokratische Regeln wird die Kreativität der Mitarbeiter behindert
Durch persönliche Interessen wird die Erfahrungskommunikation mit den Kollegen eingeschränkt.
Die professionellen Mitarbeiter verteidigen fanatisch ihre eigenen Ideen, bei gleichzeitigem Fehlen der Toleranz für die Ideen der Kollegen.
Die Organisation betreibt Raubbau mit den Ressourcen ihrer Mitarbeiter und ermöglicht ihnen keine Weiterbildung (vgl. ausführlich Glasl 1992, S. 133-135).
Die Dienstleistungsorganisation
Bei der Dienstleistungsorganisation geht es vornehmlich um das politisch-soziale Subsystem. Ihr Organisationszweck ist das Produzieren eines Prozesses. Ihre Leistungen befriedigen in erster Linie die psychischen Bedürfnisse der Klienten (z.B. Reisebüro). Für das Image eines Dienstleistungsunternehmens sind deshalb subjektive und persönliche Merkmale bestimmend: Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Vornehmheit, Schlichtheit usw.
Eine Dienstleistungsorganisation kann ihre Leistungen erst dann erbringen, wenn der Kunde sie dazu auffordert. Das besondere Merkmal der Dienstleistungsorganisation ist der direkte Kontakt zum Kunden während der Leistungserbringung. Damit die Leistungserbringung zur Zufriedenheit des Kunden verlaufen kann, ist ein gutes Betriebsklima notwendig. „Die Qualität der Beziehungen bestimmt hier die Leistungsqualität der Organisation.“ (Glasl 1992, S. 136). Daher ist es für eine Dienstleistungsorganisation entscheidend, wie sie im Innern mit ihren Mitarbeitern umgeht, wie sie ihre Mitarbeiter behandelt, denn eine schlechte Behandlung der Mitarbeiter durch die Organisation, wird von den Mitarbeitern direkt an den Kunden weitergeben werden (vgl. Glasl 1992, S. 136).
In einer Dienstleistungsorganisation kann folgendes Konfliktpotential entstehen:
Zum Zwecke der Rechtssicherheit tritt eine Übernormierung ein. Jeder Erwartungsfall soll durch Regeln abgedeckt werden, so dass hierdurch das persönliche Verhalten der Mitarbeiter eingeschränkt wird.
Das Verhalten der Mitarbeiter wird interessenlos, sie orientieren sich nur noch an die formale Erfüllung der Regeln (Dienst nach Vorschrift).
Eine zu große Arbeitsteilung (vgl. Glasl 1992, S. 137).
Die Produktorganisation:
Produktorganisationen liefern bzw. produzieren materielle Güter. Diese materiellen Güter zirkulieren möglicherweise um die ganze Welt, wo sie konsumiert werden können.
Der Fertigungsprozess für ein Gut kann in unzählige Arbeitsschritte zerlegt werden. Durch die fortgeschrittene Technisierung stehen bei Produktorganisationen die physischen Produktionsmittel im Vordergrund. „Die Produktion ist ein differenzierter sozio-technischer Prozeß, darum müssen neben den Anforderungen an der Technologie auch die Leiblichkeit des Menschen unbedingt beachtet werden.“ (Glasl 1992, S. 138). Ergonomie, körpergerechte Bedienung einer Maschine, Schutz vor Lärm, Staub, Hitze und anderen Schäden des Körpers sind vom Arbeitgeber sicher zu stellen. Die Forschung hat nach dem Zweiten Weltkrieg erkannt, welche Auswirkungen monotone Arbeit auf die psychische Gesundheit (z.B. Abstumpfung) und auf die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter haben kann. Wherry führt deshalb vier Hauptkriterien für die Gestaltung der Arbeit an:
Job-Rotation: Rotation von Aufgaben innerhalb eines Teams.
Der Arbeiter soll das Resultat seiner Arbeit kennen, d.h. entweder in natura, durch Graphiken oder Fotografien.
Der Arbeiter sollte Einfluss auf die Produktionsgeschwindigkeit nehmen können, um sie so an seinen persönlichen Tagesrhythmus mit den Hochs und Tiefs anpassen zu können.
Die Arbeit muss für den Arbeiter eine Herausforderungen darstellen. Daher muss die Arbeit eine Mischung aus routinemäßig zu erledigenden Aufgaben bzw. Tätigkeiten und unbekannten Tätigkeiten mit Herausforderungscharakter sein (vgl. Glasl 1992, S. 138).
In Produktorganisationen hat sich die Einzelleistung des Mitarbeiters in die synergetische Gesamtleistungserbringung der Organisation einzuordnen. Damit dies erreicht wird, bedarf es der Planung und Koordinierung. Sie nehmen innerhalb der Produktorganisation einen wichtigen Status ein. Die Planung und Koordinierung geschieht zumeist über Zielvorgaben. Die Zielvorgaben sind in Produktorganisationen leichter bestimmbar, quantifizierbar, messbar und kontrollierbar als in den anderen Typen von Organisationen. Daraus läßt sich aber nicht von vorne herein eine hierarchische oder autoritäre Führung der Mitarbeiter ableiten. Auch „der Mitarbeiter an der Maschine kann über ein abgestuftes, gut entwickeltes System der Mitbestimmung am Arbeitsplatz zum weitgehendem Gestalter der eigenen Arbeit werden, wenngleich er die objektiv gegebenen Parameter anerkennen muß.“ (Glasl 1992, S. 139).
In Produktorganisationen ergibt sich das Konfliktpotential, wenn diese Prinzipien mißachtet werden:
Der Arbeiter kennt nicht die Resultate seiner Arbeit; er kennt nicht den Nutzen seiner Leistung für den Endverbraucher.
Durch endlose Zergliederung der Arbeit einer Person ergeben sich Aufgaben, die für die Arbeiter kein sinnvolles Ganzes mehr erkennen lassen. Hierdurch kann auch kein Sinnbezug mehr zu den Konsumentenbedürfnissen hergestellt werden.
Die horizontale Arbeitsteilung führte dazu, daß Menschen ausschließlich in einseitigen Tätigkeiten, z.B. nur planen, nur ausführen, angesprochen werden. Sie werden so in ihrem Wesen und in ihren Möglichkeiten begrenzt (vgl. Glasl 1992, S. 139ff.).
Bei allen vorgestellten Organisationstypen dominiert eines der drei Subsysteme. Die anderen Subsysteme sind natürlich auch vorhanden, nur spielen sie für den bestimmten Organisationstypen nicht eine so große Rolle wie das dominierende Subsystem.
Das Konfliktpotential einer Organisation bezeichnet also die Höhe der Möglichkeit eines Auftretens von Konflikten. Doch was genau sind Konflikte?
1.1 Was ist ein Konflikt?
Konflikte sind für die Menschen kein unbekanntes Phänomen. Tagtäglich erleben wir Konflikte, sind ihnen ausgesetzt oder können sie beobachten. Da geraten zwei Autofahrer aneinander, weil der eine ein Stoppschild mißachtet hat. Der Ehemann wirft seiner Frau vor, zu verschwenderisch mit dem Haushaltsgeld umzugehen. Zwei Nachbarn streitet sich über die zu laute Musik. Und last but not least: da streitet zwei Manager eines mittelständischen Unternehmens, um den Kauf einer neuen PC-Anlage, ohne sich einigen zu können. Alle Situation stehen beispielhaft für eine Konfliktsituation. Was aber ist ein Konflikt? Wie läßt sich der Begriff des Konfliktes definieren?
Die Soziologie hat sich in den 60er Jahren wieder verstärkt dem sozialen Konflikt in der Gesellschaft und in Organisationen zugewendet. Zuvor hatte die Konsens- bzw. Integrationstheorie von Parsons das Hauptaugenmerk auf die Stabilität, die Integration, die Funktion und den Konsens in der Gesellschaft gelegt. In dieser Theorie wurden Konflikte als dysfunktional bezeichnet und es galt, sie unter allen Umständen zu vermeiden. Dahrendorf betont die Wichtigkeit der Parsonschen Theorie, aber zugleich weist er daraufhin, daß sie die Aspekte des Wandels, der Konflikte, der Dysfunktion und des Zwanges zur Beschreibung der gesellschaftlichen Prozesse vernachlässigt (vgl. Weiss 1993, S.49ff.).
Im Anschluss an die Konsens- bzw. Integrationstheorie von Parson kam es zu einer regelrechten Inflation des Konfliktbegriffes. In der Definition des Konfliktbegriffes orientiere ich mich im wesentlichsten an Neubauer und Glasl. Beide Definitionen umfassen im Gegensatz zu anderen Definitionen des Konfliktbegriffes die wesentlichsten Kennzeichen eines Konfliktes:
Ein Konflikt ist eine Interaktion zwischen zwei oder mehreren Aktoren, mit unvereinbaren oder sich widersprechenden Handlungen, so dass der andere Aktor als Behinderung in der Realisierung der Handlung erlebt wird (vgl. Neubauer 1981, S.4ff.; Glasl 1992, S.13ff.).
Ein Konflikt besitzt nach der oben genannten Definition folgende Kennzeichen:
Ein Konflikt ist durch die Interaktion zwischen Individuen, Gruppen und Organisationen (Aktoren) gekennzeichnet. Die Interaktion muss eine wechselseitige, aufeinander bezogene, Kommunikation beinhalten (vgl. Glasl 1992, S.14; Neubauer 1981, S.5).
Zu einem Konflikt gehören mindestens zwei oder mehrere Konfliktaktoren (vgl. Glasl 1992, S.14; Neubauer 1981, S.5).
Konflikte sind durch unvereinbare oder sich widersprechende Handlungen oder Handlungsabsichten gekennzeichnet (vgl. Glasl 1992, S.14ff.; Neubauer 1981, S.5). Die diskrepanten Standpunkte der Konfliktaktoren in einem Konflikt erklären sich aus ihren unterschiedlichen Sichtweisen (vgl. Glasl 1992, S.14-16; Redlich 1997, S. 45ff). Diese unterschiedlichen Sichtweisen werden im wesentlichen durch das Denken, Fühlen und die Interessen der Aktoren bestimmt. Unter Denken verstehe ich einen Prozess der Informationsverarbeitung, die den Menschen befähigt, sich ein begrifflich fixiertes, kognitives Abbild eines Teilbereiches der objektiven Realität bezüglich seiner wesentlichen Eigenschaften und Zusammenhänge zu machen. Der Prozess der Informationsverarbeitung dient der späteren Findung und Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten (vgl. Clauss 1983, S.112). Mit dem Begriff des Fühlens ist das innere, gefühlsmäßige Erleben einer Interaktion gemeint. Der Begriff des Interesses meint die Verfolgung subjektiver Ziele. Er umfasst das Wollen und die Ziele der Konfliktaktoren.
Ein Konflikt ist dann gegeben, wenn ein Aktor durch den anderen Aktor in der Realisierung seiner Handlung beeinträchtigt wird. Dabei muß der eine Aktor die Interaktion so erleben, so daß er die Gründe für die Nichtverwirklichung der Handlung dem anderen Aktor zuschreibt (vgl. Glasl 1992, S.14ff.).
Ohne das Erleben der Beeinträchtigung in der Realisierung einer Handlung kann sinnvollerweise von einem Konflikt nicht gesprochen werden (vgl. Glasl 1992, S. 14ff.).
Nollmann kommt in seiner weiten Fassung des Konfliktbegriffes zu einer ähnlichen, aber weiteren Definition des Konfliktbegriffs. Er leitet den Konfliktbegriff aus der Systemtheorie ab.