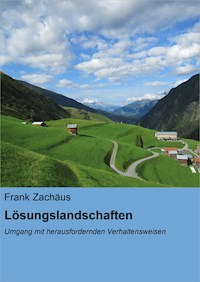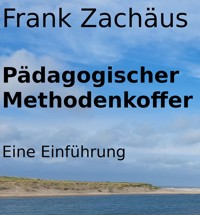
6,49 €
Mehr erfahren.
Zu Beginn der Einführung möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Es war einmal ein Vorstellungsgespräch. Ein Bewerber erhielt die Frage von der Personalleitung: "welche pädagogische Methoden kennen Sie?" Der Bewerber antwortete: "Das ist eine gute Frage. Lassen Sie mich kurz nachdenken?! ….Ich kann es Ihnen gar nicht so genau sagen. Ich handele in den Situationen mit den Kindern intuitiv. Meine Intuition begleitet die Kinder und Jugendlichen." Der Personalleiter antwortet: "Können Sie denn wirklich keine pädagogische Methoden benennen?" "Na, ich spreche mit den Kindern und entwickele mit Ihnen Möglichkeiten, wie sie Probleme lösen können!", sagt der Bewerber. "Na dann, haben sie ja eine Methoden genannt. Gespräche führen! Sehr gut….Verstehen sie mich nicht falsch, wenn ich Ihnen eine eher provokante Frage stelle. Angenommen, ich wäre Chef eines Dachdeckerunternehmens und sie hätten sich bei mir als Dachdecker beworben. Ich hätte sie dann gefragt, mit welchen Werkzeugen sie mir ein Dach bauen würden? Und sie hätten geantwortet: Oh, das ist eine gute Frage. Ich baue Dächer immer so intuitiv!...was glauben sie, welche Entscheidung würde ich treffen?" Der Bewerber ruckt nervös auf seinem Stuhl hin und her. Zugegeben, man kann sagen, dass der Personaleiter sicher nicht der netteste war und er schon recht provozierend auf den Bewerber geantwortet hat. Viele sozialpädagogische Fachkräfte machen einen unglaublich professionellen Job. Diese kleine Abhandlung über die unterschiedlichen pädagogischen Methoden möchte dazu beitragen, dass sozialpädagogische Fachkräfte einen guten Überblick über die Methodenvielfalt in der pädagogischen Arbeit bekommen. Für den Pädagogen ist die Kenntnis der unterschiedlichen Methoden, die er einsetzen kann, um Lern- und Erziehungsprozesse zu initiieren, ein Zeichen seiner Professionalität. Er wählt aus seinem pädagogische Methodenkoffer, die zum Kind bzw. Jugendlichen passende Methode aus. Er kann in der Hilfeplanung im Vorfeld gezielt überlegen, mit welchen Methoden er am besten die Ziele in der Hilfeplanung erreichen kann. Für all das oben beschriebenen muss die sozialpädagogische Fachkraft über eine große Anzahl an Methoden verfügen und diese vor allem auch kennen, damit er sie gezielt und planvoll in seiner pädagogischen Praxis einsetzen kann. Neben der Kenntnis von unterschiedlichen Theorien zur Beschreibung pädagogischer Prozesse und der Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen ist die Kenntnis der unterschiedlichen pädagogischer Methoden zur Erreichung der Erziehungsziele ein Zeichen seines Professionalisierungsgrades. Wer das Wie nicht kennt, kann seine Ziele in der Erziehung von Kinder und Jugendlichen nicht erreichen. Wer das Wie nicht kennt, kann nicht gezielt zur Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit zu einem Erwachsenen beitragen. Denn Pädagogik, sei es die frühkindliche Pädagogik oder die Soziale Arbeit, ist konkretes Tun mit den Kindern und Jugendlichen. Pädagogik ist für die Kinder und Jugendliche sowie die sozialpädagogischen Fachkräfte konkrete erlebte Handlung als Teil ihrer Lebensrealität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Frank Zachäus
Pädagogischer Methodenkoffer
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1 Motivieren
2 Beraten
3 Informieren
4 Arrangieren und Situationen gestalten
5 Dasein und Zeit haben
6 Reflektionsgespräche
6 Grenzen setzen
7 Verhaltensspiegelung
8 Beziehungsarbeit
9 Kurzinterventionen
10 Sit-In
11 Gesprächspsychotherapie bzw. klientenzentrierte Ansätze
12 Verhaltenstherapeutische Maßnahmen
13 Rollenspiele
14 Paradoxe Interventionen
15 Konfliktmanagement
16 Soziale Einzelfallhilfe
17 Soziale Gruppenarbeit
18 Basale Stimulation
19 Basale Kommunikation
20 Psychomotorische Angebote
21 Snoezelen
22 Präventive Maßnahmen
23 Soziale Lernspiele
24 Regeln absprechen
25 Theaterprojekte/ Psychodrama
26 UK – Unterstützte Kommunikation
27 TEACCH-Ansatz
28 Alternativen zum Handeln anbieten
29 Ablenken/ Umlenken
30 Anleiten/ Direkte Aufforderung
31 Direkte Aufforderungen/ Appelle
32 Anweisungen geben und Konsequenzen aufzeigen
33 Erlebnispädagogik
34 Lernen durch Konsequenz oder den Schaden selbst regulieren
35 Visionen und Ziele entwickeln
36 Klare Hilfestellungen zur Überwindung von Augenblickskrisen
37 Intervention durch Signale
38 Humor
39 Beruhigung durch Körperkontakt
40 Soziale Kontrolle und personale Präsenz
41 Gentle Teaching
42 Training für soziale Problemlösungen
43 Selbstsicherheitstraining und Selbstbehauptung
44 Konfrontative Pädagogik
45 Kreative Angebote
46 Heilpädagogische Rhythmik
47 Fragen
48 Umdeuten (Reframen)
49 Narrative Umdeutungen
50 Nicht-Vorschläge
52 Doppeln
53 Starten und Steuern
54 Unterbrechen und Abbremsen
55 Zur Aussage auffordern
56 Zur Reaktion auffordern
57 Verständnisüberprüfung
58 Zusammenfassen
59 Botschaften des Körpers ermitteln und ansprechen
60 Mediation (Konfliktvermittlung)
Literaturverzeichnis
Impressum neobooks
1 Motivieren
Pädagogische Methoden
Eine Zusammenstellung
Frank Zachäus
Inhaltsverzeichnis
Pädagogische Methoden – eine kurze Einführung
Für den Pädagogen ist die Kenntnis der Methoden, die er einsetzen kann, um Lernprozesse zu initiieren, ein Zeichen seiner Professionalität. Durch den gezielten Einsatz von pädagogischen Methoden wechselt der Pädagoge seine Rolle. Er kommt in die Rolle des Agierens und befindet sich nicht in der Rolle des Reagierens. Der Pädagoge setzt die Akzente in der Kommunikation mit den Klienten.
Zudem stellt das Inventar der pädagogischen Methoden den Lösungskoffer für die Praktiker dar, wenn ich auch betonen will, dass der hier vorgestellte Koffer nicht vollständig sein wird und all die möglichen Kombinationen verschiedener Lösungen/Methoden nicht ausreichend beschrieben sind in dieser Zusammenstellung. Die Wirklichkeit ist so komplex und dynamisch, dass gerade die Kombinationen der verschiedenen Methoden den Möglichkeitshorizont für Lösungen ins Unendliche erweitert. In der Darstellung geht es mir lediglich um einen Anriss der Methoden/Lösungen, so dass man eine Vorstellung bekommt, wie viele es gibt.
Damit pädagogische Methoden ihre volle Wirksamkeit entfalten können, kommt es immer darauf an, dass der Pädagoge eine lösungsorientierte Grundhaltung entwickelt und verinnerlicht hat.
Die in diesem Papier aufgeführten Methoden erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Das Motivieren von anderen Menschen zur Ausführung von bestimmten Handlungen und zum Unterlassen anderer Handlung ist eine wichtige pädagogische Methode. Durch die Motivation soll der Klient bewegt werden, die Lernmöglichkeiten einer Lernsituationen zu nutzen. „Es geht also darum, andere zu bewegen, sich auf etwas einzulassen, was sie ohne einen solchen Anstoß vermutlich nicht tun würden – sei es, dass sie ängstlich sind, sei es, dass sie zunächst kein Interesse daran haben.“ (Giesecke 1996, S. 105). Auf diese Weise können Klienten Lernchancen wahrnehmen und an Lernsituationen teilnehmen, die sie sonst wahrscheinlich gemieden hätten. Aber die Methode der Motivation bezieht sich nicht nur auf Lernsituationen, sondern sie zielt auch darauf ab, Klienten zur Durchführung von Handlungen zu bewegen, um ihren Alltag zu bewältigen. Wie man konkret andere Menschen zu etwas motivieren kann, hängt zum einen von der Persönlichkeit des „Motivators“ ab, zum anderen von der Situation, dem Klienten und dem eingesetzten Medium. Motivieren kann man durch guten Zuspruch, Lob, gemeinsames Tun, einen Witz, Konsequenzen in Aussicht stellen (positive wie negative), Spaß sowie Belohnungen.
2 Beraten
Beraten ist eine universelle Methode, die in vielen Funktionsfeldern der Gesellschaft ihre Anwendung findet. Eltern beraten ihre Kinder, Vorgesetzte beraten ihre Mitarbeiter, Berater (oder neudeutsch: Coaches) beraten Firmen, Versicherungsberater beraten ihre Kunden vor dem Abschluss von Versicherungsverträgen und Bänker sollten ihre Kunden gut beraten, wie sie ihr Geld sicher anlegen und vermehren können. Auf Beratung trifft man überall. Beratung ist aber auch eine fundamentale pädagogische Methode, welche eingesetzt wird, um dem Klienten zu helfen, die richtigen Entscheidungen zur Bewältigung des Alltags zu treffen. Beratung versucht, dem Klienten durch Erkundung der Situation und der möglichen Antworten auf die Anforderungen zu helfen, eine für ihn und die Situation passende Antwort zu finden. Beratung versucht aufzuzeigen, welche Möglichkeiten des Handelns der Ratsuchende hat, einen Problem bzw. diese Anforderungen zu begegnen. Daher springt Beratung in die Zukunft und eruiert die Möglichkeiten der Lösungshandlungen und spielt deren mögliche Konsequenzen durch. Beratung bedeutet immer, dass der Ratsuchende die Entscheidungshoheit behält, wie er auf das Problem oder die Anforderungen reagieren bzw. antworten will. Er entscheidet, welche Kommunikationen das Problem lösen oder die Anforderungen bewältigen sollen.
Der Berater hat zwei Möglichkeiten, im Beratungsprozess vorzugehen. Entweder er gibt direkt und als Experte sein Wissen und seine Lösungsvorschläge an das System weiter oder er sich macht non-direktiv mit dem System auf die Suche nach der passenden Lösung. Die erste Variante birgt immer die Gefahr, dass die vom Berater vorgeschlagenen Lösungen nicht umgesetzt werden, weil sie nicht zum Klienten passen. Der zweite Weg öffnet den Fächer an möglichen Lösungen für das Problem oder die Anforderungen und unterstützt den Klienten bei der eigenständigen und selbstbestimmten Entwicklung einer möglichen Lösung. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit deren Umsetzung.
Diese Methode findet gerade in der pädagogischen Arbeit in vielschichtiger Weise Anwendung. Ein Mensch mit Behinderung, der immer aggressives Verhalten bei Überforderungssituation (z.B. beim Putzen seines Zimmers oder bei Konfliktsituationen mit seinen Mitbewohnern) zeigt, kann man in der Beratung bei der Entwicklung von Lösungen unterstützen. Man könnte erarbeiten, dass er sich nur noch realistische Aufgaben aussucht und andere ablehnt, man könnte ihm raten, Hilfe zu holen, oder man könnte ihm raten, mit seinen Bezugspersonen eine Vereinbarung zu schließen, dass sie ihn sofort zur Hilfe eilen, wenn sie sehen, dass er überfordert ist. Das wichtigste Instrument der Beratung ist das Fragen (siehe weiter unten).
3 Informieren
Informieren ist eine pädagogische Methode, die täglich im pädagogischen Alltag verwandt wird. Das Informieren bezieht sich immer auf eine aktuelle Alltags- oder Lebenssituation. Sie informiert den anderen, wie man sich in einer Situation erwartungsgemäß verhalten soll. Sie informiert den anderen über die Rahmenbedingungen. Sie erläutert Verfahrensweisen und Sachzusammenhänge. Erst auf der Grundlage einer ausreichenden Informiertheit kann man für sich eine Entscheidung treffen, wie man sich verhalten will. Der pädagogische Mitarbeiter informiert das Kind in der Wohngruppe über die Konsequenz bei einem handgreiflichen Streit mit einem anderen Kind. Es bekommt ein Time-Out im Zimmer, ein Privileg wird gestrichen, es muss für das andere Kind eine Wiedergutmachung leisten. Anschließend wird es ein Gespräch mit dem Pädagogen geben, indem sie beide Situation reflektieren und nach alternativen Reaktionsmöglichkeiten Ausschau halten. Informationen werden von Menschen benötigt, um ihr Verhalten steuern zu können und zu wissen, was in welcher Situation von ihnen erwartet wird und welche Handlungsoptionen ihnen offiziell zur Verfügung stehen. Informationen helfen, die Handlungsunsicherheit von Menschen in sozialen Systemen zu reduzieren. Sie helfen, die Rahmenbedingungen von sozialen Situationen abzustecken, sie helfen bei der Lösung von Problemen und bei der Steuerung von Verhaltensweisen.
4 Arrangieren und Situationen gestalten
Das Arrangieren von Situationen stellt eine der am häufigsten eingesetzten Methoden in der Pädagogik dar. Das Arrangieren von Situationen bedeutet die gezielte Reduktion von Komplexität und Kommunikationsmöglichkeiten in einer spezifischen Situation, so dass dadurch ein spezifischer Rahmen entsteht, indem der Klient bestimmte Erfahrungen machen kann. In diesem spezifisch arrangierten Rahmen stehen ihm nur bestimmte Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung, andere wiederum sind eindeutig ausgeschlossen. Der Klient kann dann entscheiden, welche der im arrangierten Rahmen vorzufindenden Kommunikationsmöglichkeiten er wählen will. Durch diese Methode kann der pädagogische Mitarbeiter gezielt Einfluss nehmen, wie Situationen aussehen sollen und welche Kommunikationen durch den Klienten realisiert werden sollen. Er kann das Arrangieren von Situationen zur Schaffung von Lernsituationen (vgl. Giesecke 1996, S. 95.), zur besseren Bewältigung von Problemen oder zur Veränderung von Verhaltensweisen nutzen. Der arrangierte Rahmen kann dabei eng oder weit gefasst werden. Der pädagogische Mitarbeiter kann dem Klienten die Wahlmöglichkeiten so verkleinern, dass es zu keiner Überforderung kommt. So kann er ihn fragen: Willst du Wurst oder Käse auf dein Butterbrot? Er kann die Sitzordnung am Essenstisch so verändern, dass die zwei Personen, welche sich spinnefeind sind, nicht direkt nebeneinander sitzen. Durch das veränderte Arrangieren der Sitzordnung kann zukünftig die Anzahl der auftretenden Streitigkeiten zwischen den beiden verringert werden. Oder der pädagogische Mitarbeiter strukturiert das gemeinsame Aufräumen des Zimmers nach bestimmten Handlungsschritten. Er kündigt sie dem Klienten an, zeigt selbst deren Ausführung und läßt es dann den Klienten nachmachen und unterstützt ihn weiter durch verbale Anweisungen und Erläuterungen1.
5 Dasein und Zeit haben
Zeit haben für andere ist eine häufig verkannte pädagogische Methode. Dabei ist sie so einfach einzusetzen. Dasein bedeutet, für den anderen bei der Bewältigung von Problemen und Anforderungen da zu sein, wenn er Unterstützung braucht oder diese wünscht. Dasein beschränkt sich nicht nur auf Problem- oder Anforderungszeiten, sondern es bezieht sich auch darauf, dem Klienten echte und authentische Beziehungskontakte anzubieten, gerade auch in den Phasen, in denen es den Klienten gut geht. Gerade durch die Intensivierung der sozialen Kontakte in den Phasen, wo keine Auffälligkeiten auftreten, können die dort gezeigten und gewünschten Kommunikationen und Handlungen weiter verstärkt werden. Dies kann durch gemeinsame Aktivitäten wie Sport, Spaziergänge, Gespräche, Basteln, Musik hören, Discobesuche, gemeinsames Kochen, Gesellschaftsspiele, gemeinsames Playstation spielen, Fernsehen schauen, einkaufen, auf die Kirmes gehen usw. erreicht werden. Wichtig ist, dass eine Aktivität gewählt wird, von der beide Interaktionspartner etwas Positives abgewinnen können.
Oftmals unterschätzen die pädagogischen Mitarbeiter gerade die Wirkkraft des Daseins für andere. Dasein für andere bedeutet natürlich, auch Zeit für andere zu haben. Zeit haben für ihre Probleme, Ängste, Sorgen und individuellen Herausforderungen. Aber auch Zeit haben für die Durchführung von gemeinsamen Freizeitangeboten, Sportaktivitäten oder einfach für intensive Gespräche.
Diese „Insel des positiven Kontaktes“ führen zu einer Stärkung und Intensivierung der Beziehung zwischen pädagogischem Mitarbeiter und Mensch mit herausfordernden Verhaltensweisen. Dies kann beim Menschen mit herausfordernden Verhalten bewirken, dass er sich noch mehr anstrengt, sozial akzeptierte Verhaltensweisen zu zeigen. Die positiv erlebte Beziehung unterstützt und stärkt die Selbstdisziplin des Klienten.
6 Reflektionsgespräche
Reflektionsgespräche sind eine häufig eingesetzte Methode zur Veränderung von Verhaltensweisen und zur Lösung persönlicher Herausforderungen. In den Gesprächen wird die aktuelle Problemsituation analysiert und die Gründe für deren Entstehung werden erarbeitet. Dann wird in einem gemeinsamen Suchprozess nach Lösungen gesucht, diese Probleme zukünftig anders zu bewältigen. Reflektionsgespräche eignen sich zur Veränderung von herausfordernden Verhaltensweisen. Im ersten Schritt wird der Symptomträger mit seinen herausfordernden Verhaltensweisen und mit den negativen Auswirkungen für seine sozialen Umwelt konfrontiert. Im zweiten Schritt wird an dem Sinn der gezeigten Verhaltensweisen gearbeitet, um darauf aufbauend alternative Wege zu finden und zu konstruieren, um den Sinn der herausfordernden Verhaltensweisen auf einem weniger leidvollen Weg zu erreichen. Im dritten Schritt wird vereinbart, welche der Möglichkeiten in der nächsten Zeit umgesetzt werden sollen. Wenn z.B. jemand aus Frustration und Wut sein Zimmer zerstört, so kann der Sinn der Zimmerzerstörung der Abbau seiner Frustration oder Wut sein. Im Reflektionsgespräch könnte man erarbeiten, dass er lieber einen Wutball gegen die Wand wirft, sich am Boxsack auspowert oder eine Runde um den Häuserblock dreht. Mit diesen alternativen Handlungsmöglichkeiten kann er vielleicht auch den Sinn, seine Frustration und seine Wut abzubauen, realisieren. Oder jemand zieht sich aus Trauer um den Tod eines geliebten Menschen immer mehr zurück, um durch die Einsamkeit die Trauer zu bewältigen. Hier ist der Sinn der Einsamkeit der Versuch der Trauerbewältigung. Vielleicht kann die Trauerbewältigung auch gelingen, durch Gespräche mit einem Seelsorger, durch das Schreiben eines Abschiedsbriefes oder durch das gezielte Ablenken auf andere Themen.
Reflektionsgespräche können je nach Art des Problems oder der herausfordernden Verhaltensweisen immer wieder von vorn beginnen.
Reflektionsgespräche können gut kombiniert werden mit Feedbackgesprächen, in denen der Klient gezielt ein Feedback erhält, was an dem Tag gut gelaufen und was nicht so gut gelaufen ist. Dies verschafft dem Klienten eine transparente Übersicht, wie seine Mitmenschen sein Verhalten an diesem Tag bewerten und erlebt haben. Gleichzeitig kann das Feedbackgespräch genutzt werden, gezielt Lob und positive Verstärker einzusetzen, um die erwarteten Verhaltensweisen zu verstärken. Durch die klare Formulierung, was nicht so gut funktioniert hat, wird immer wieder markiert, welches Verhalten sich verändern muss und welche Erwartungen an den Klienten gerichtet sind. Die Kombination von positivem und negativem Feedback kann daher verhaltensverändernd wirken.
6 Grenzen setzen
Grenzen setzen stellt eine der Kernkompetenzen von pädagogischen Mitarbeitern in allen möglichen Berufsfeldern der Sozialen Arbeit dar. Durch das Setzen von Grenzen macht der pädagogische Mitarbeiter deutlich, was in einer Situation erlaubt ist und was nicht. Das Setzen von Grenzen markiert, welche Kommunikationsanschlüsse nicht gewählt werden sollen und verweist auf die Kommunikationsanschlüsse, welche gewählt werden sollen und können. Grenzen setzen ist ein wirksamer Weg, Verhaltensweisen zu beeinflussen und zu steuern. Gleichzeitig lernen die Menschen durch Grenzsetzungen die Werte, Regeln und Strukturen eines sozialen Systems (sei es eine Wohngruppe oder eine Familie) kennen und respektieren. Grenzen setzen beinhaltet den Lerneffekt, dass die gesetzten Grenzen von der anderen Person übernommen werden. Sie können dann ihren Niederschlag in der Innenstruktur des psychischen Systems finden. Eine Grenzsetzung von außen ist dann nicht mehr notwendig, weil das psychische System sich automatisch an die Regeln des Systems hält und die Erwartungen der anderen Systemmitglieder erfüllt. Aufgrund seiner Freiheit hat das psychische System aber immer die Möglichkeit, sich gegen die Regeln und Erwartungen zu stellen.
Das Setzen von Grenzen dient der Orientierung von Menschen in sozialen Systemen. Nur so können sie die Regeln des sozialen Systems kennen lernen und einhalten. Das Setzen von Grenzen markiert die nicht-erlaubten Kommunikationen von den erlaubten. Die Grenzen schaffen den Rahmen, in denen sich ein Mensch mit seinen Kommunikationen und Handlungen in einem sozialen System bewegen kann. Sie regulieren das Nähe-Distanz-Verhältnis von Menschen. Sie helfen, Beziehungen zu definieren und sie beeinflussen das Ausmaß von Vertrautheit oder Misstrauen zwischen Menschen. Sie regulieren die Polaritäten der Beziehung, wie die Momente von Augenblick und Dauer, die Befriedigung von Bedürfnissen und die Anerkennung von Menschen. Sie stimulieren andere Menschen in der Beziehung, weil Grenzen setzen Lernfelder eröffnet, wie z.B. den Umgang mit Frustrationen, das Akzeptieren eines Nein, sich gegen die Grenzsetzung behaupten sowie einen Kompromiss auszuhandeln. Das Setzen von Grenzen eröffnet die Möglichkeit, seine Konfliktfähigkeit zu schulen. Grenzen können einer Beziehung klare Strukturen und Stabilität verleihen. Gleichzeitig bietet das Setzen von Grenzen auch die Stimulierung von vielen Entwicklungsmöglichkeiten an. An Grenzen kann man sich reiben und abarbeiten. Sie sind wichtig für die Entwicklung von Kindern zu Erwachsenen.
Zu viele und starr gesetzte Grenzen und deren Nichtveränderbarkeit können aber auch Entwicklungen verhindern und blockieren. Die Luft für die persönliche Entfaltung und Entwicklung wird buchstäblich durch die Regeln und engen Grenzen erstickt. Werden fast überhaupt keine Grenzen gesetzt, so wie es die Antipädagogen propagieren, ist eine Nützlichkeit für die Entwicklung ebenfalls nicht festzustellen, eher das Gegenteil ist der Fall. Die Kinder- und Jugendhilfe ist in den letzten Jahren immer mehr mit Kindern und Jugendlichen konfrontiert, welche „über Tische und Bänke“ gehen. Kinder und Jugendliche, welche überhaupt keine Grenzsetzung erfahren haben, nehmen wenig Rücksicht auf andere und leben ihre Bedürfnisse impulsiv aus. Sie weisen meist eine geringe Empathie für andere Menschen auf und haben ein egozentrisches Weltbild. Sie haben nicht gelernt, sich an Regeln zu halten, außer an die eigenen. Meist führt dies zu herausfordernden Verhaltensweisen, so dass es in einzelnen Funktionssystemen zu Störungen und Konflikten kommt.
Die goldene Mitte zwischen den beiden Extrempolen bietet für Menschen die besten Entwicklungsmöglichkeiten. Erst das Setzen von Grenzen ermöglicht soziales Lernen und unterstützt die Weitergabe vorhandener systeminterner bzw. gesellschaftlicher Wirklichkeitskonstruktionen.
Das Setzen von Regeln kann in vielfältiger Weise stattfinden: Man kann die Augenbrauen hoch heben und der andere erkennt: „bis hier und nicht weiter.“ Man kann die Grenze konkret ansprechen und das Nein kommunizieren. Grenzen kann man auch durch vielerlei Gesten setzen, wie z.B. Kopfschütteln, den erhobenen Zeigefinger oder den finsteren Blick. Oder man umfasst die Schulter des Kindes und entfernt es vom Fernseher, wo es zum hundertsten Mal mit den Knöpfen spielen wollte. Grenzen setzen kann man auch durch das Ankündigen der Ausführung von Konsequenzen bzw. deren tatsächliche Ausführung. So kann man seinem Kind ankündigen, dass, wenn es seine Hausaufgaben nicht zu ende macht, es nicht seine Freunde treffen kann. So kann man ankündigen, dass, wenn das Kind seine Stereoanlage in einem Wutanfall zerstört, es ersteinmal keine Neue bekommt und auch die Playstation aus dem Zimmer entfernt wird. So kann man seinem Kind sagen, dass es um 19.00 Uhr zum Abendessen wieder da sein soll, ohne diese Aussage mit weiteren negativen Konsequenzen zu belegen. Grenzen setzen kann man, muss man aber nicht, mit angekündigten Konsequenzen und deren möglicher Ausführung beschweren. Die Beschwerung von Grenzen mit möglichen Konsequenzen kann aber notwendig sein, da Menschen oft erst durch gemachte Erfahrungen lernen, dass eine Grenzsetzung ernst gemeint war. Auch testen viele Kinder gerade diese Ernsthaftigkeit der gesetzten Grenzen. Hier steht die Glaubwürdigkeit und die Verlässlichkeit des pädagogischen Mitarbeiters auf dem Prüfstand. Daher sollte sich der pädagogische Mitarbeiter immer vor Augen halten, dass es nützlich ist, nur die Konsequenzen als Beschwerung und Untermauerung der Grenzsetzung zu nutzen, welche man im Falle einer weiteren Grenzüberschreitung auch umsetzen kann. Es bringt wenig, einem Klienten als Konsequenz anzukündigen, eine Auszeit im Zimmer zu haben, wenn man sie nicht durchsetzen kann. Wenn man diese Auszeit ausspricht, muss im Vorfeld klar sein, dass man diese Konsequenz auch dann umsetzen kann, wenn der Klient versucht, das Zimmer vor Ablauf der Pause zu verlassen.