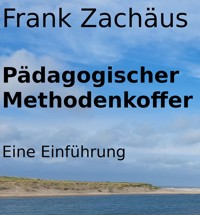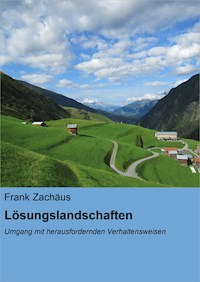
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks Self-Publishing
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das Buch Lösungslandschaften bietet ein Konzept an, wie pädagogische Fachkräfte mit herausfordernden Verhaltensweisen umgehen können und wie sie es schaffen, herausfordernden Verhaltensweisen zu verändern. Das Konzept ist aus der Praxis entwickelt worden und ist dort erprobt. Das Buch beschreibt anschaulich, wie man mit einem System (Team/ Familie) ein EHV-Konzept für die Kinder erarbeiten kann. Das Buch bietet darüber hinaus eine kurze Einführung in die Systemtheorie, in die unterschiedliche Formen von herausfordernden Verhaltensweisen und die Methoden der systemischen Beratung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 632
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Zachäus
Lösungslandschaften
Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen
Dieses eBook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Einleitung
2. Systemische Grundbegriffe und das psychisches System
3. Personenzentrierte soziale Systemtheorie und herausfordernde Verhaltensweisen
4. Formen von herausfordernden Verhaltensweisen
5. Sinn und Funktion von herausfordernden Verhaltensweisen
6. Veränderte Beziehungen durch herausfordernde Verhaltensweisen
7. Entwicklungskonzepte für Menschen mit herausfordernden Verhaltensweisen (EHV)
8. Coaching im EHV – Der Weg zum Ziel beginnt über die Haltungen
9. Der Methodenkoffer des systemischen Coachs
10. Phasenmodell zur Entwicklung eines EHV-Konzeptes
11. Das Ergebnis: ein EHV-Konzept
12. Literaturverzeichnis
Impressum
1. Einleitung
Die Behindertenhilfe hat sich in den letzten zehn Jahren rasant weiterentwickelt. Die Dezentralisierung der großen Komplexeinrichtungen wurde weiter vorangetrieben, so dass Menschen mit einer geistigen Behinderung in kleine gemeindenahe Wohnorte umziehen konnten. Der Gedanke der Förderung wich dem Gedanken der Selbstbestimmung und des Empowerments. Menschen mit einer geistigen Behinderung werden vom Objekt der pädagogischen Förderung und Assistenz zum Subjekt der Dienstleistung. Sie stehen als Kunde im Mittelpunkt der Assistenzleistungen, weil sie entscheiden, welche Assistenzleistungen sie zum Leben in der Gemeinschaft haben wollen.
In Nordrhein-Westfalen wurde hierfür das Individuelle Hilfeplanverfahren von Seiten der überörtlichen Kostenträger entwickelt und installiert, um den Menschen mit einer Behinderung als Subjekt der Assistenzleistungen in den Mittelpunkt allen Tun und Handelns zu stellen. Der Individuelle Hilfeplan (IHP) ist das Steuerungsinstrument für die notwendigen Assistenzleistungen zur Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Zugleich basiert hierauf die Entscheidung des Kostenträgers zur Übernahme der Kosten für die Assistenzleistungen. Der IHP ist das zentrale Element zur Planung, Finanzierung und Durchführung der Assistenzleistungen im Bereich der Behindertenhilfe.
Der Gedanke der Selbstbestimmung findet in der Wohnform des Betreuten Wohnens seinen höchsten Ausdruck. Der Mensch mit einer geistigen Behinderung besitzt einen eigenen Mietvertrag, lebt in den eigenen vier Wänden in einem „normalen“ Wohnumfeld und hat seinen Lebensalltag eigenständig zu organisieren. Gemäß der im Individuellen Hilfeplan festgelegten Anzahl an Fachleistungsstunden erhält er in der Woche direkte Assistenzleistungen durch eine pädagogische Fachkraft. Diese Wohnform richtet sich nach wie vor an Menschen mit einem nicht so hohen Hilfebedarf. Dies hat vor allem auch ökonomische Gründe, da ab 10 Fachleistungsstunden in der Woche die stationäre Wohnform die günstigere ist. Sie wird dann vom Kostenträger präferiert. Diese Entwicklung hört sich erst einmal positiv an, dennoch sollte man kritisch auf die Ambulantisierung der Behindertenhilfe schauen. Ohne das Vorhandensein von sozialen Netzwerken, in denen der alleine in seiner Wohnung lebende Mensch mit Behinderung eingebunden ist, steigt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von psychiatrischen Störungen, Verhaltensauffälligkeiten und Abhängigkeitsproblematiken. Die Selbst-Hilfe-Kräfte der Betroffenen zur Lebensbewältigung werden oft überschätzt (vgl. Theunissen 2003, S. 84).
In den stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe verändert sich das zu betreuende Klientel. In den Wohngruppen leben zunehmend Menschen mit einem erhöhten Hilfebedarf (z.B. schwerer behinderte Menschen oder Rentner mit einem Mehr an Pflege bzw. dementiellen Veränderungen), die viel umfassendere Unterstützung und Assistenz benötigen als früher. Hinzu kommt, dass die Behindertenhilfe heute vielmehr mit herausfordernden Verhaltensweisen konfrontiert wird, so dass sie neben der Herausforderung der demographischen Entwicklung ihrer Kunden auch noch die Herausforderung Verhaltensauffälligkeiten zu bewältigen hat.
In meinen Ausführungen wird es um den Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen gehen. Anhand des EHV-Konzeptes werde ich aus einer systemischen Perspektive mögliche Umgangsmöglichkeiten für herausfordernde Verhaltensweisen beschreiben. Dabei stehen die Elemente Prävention, Haltungen, Beziehungsarbeit, Krisenintervention, Tagesstruktur und spezielle Lösungen zur Veränderungen der herausfordernden Verhaltensweisen im Mittelpunkt meiner Ausführungen.
Eine genaue Beschreibung des Weges, wie man zu Lösungen im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen kommt, gibt es nach meinem Wissenstand bis dato in der deutschen Fachliteratur noch nicht. Es ist viel geschrieben worden über die verschiedenen Begriffsdefinitionen von Verhaltensauffälligkeiten, über die konkreten Formen der herausfordernden Verhaltensweisen und über die pädagogischen Methoden zu deren „Behandlung“. Bisher hat es die deutschsprachige Fachliteratur aber versäumt, den Weg zu beschreiben, wie man zu Lösungen zur Veränderung von herausfordernden Verhaltensweisen kommt und welche wichtige Rolle die Wirklichkeitsbeschreibungen, Haltungen und Einstellungen der sozialen Bezugspersonen für eine erfolgreiche Veränderungsarbeit spielen.
Nach meiner beruflichen Erfahrung liegt der wesentliche Schlüssel für eine erfolgreiche Veränderungsarbeit mit herausfordernden Verhaltensweisen in dem Finden einer nützlichen Wirklichkeitsbeschreibung des Problems sowie in der Haltung bzw. Einstellung der Systemmitglieder zum Problem. Man könnte es plakativ so formulieren: erst kommen die Wirklichkeitsbeschreibungen bzw. die Haltungen und dann die Methoden, wie ich die herausfordernden Verhaltensweisen verändere. Auch habe ich kaum ein Konzept finden können, was die wesentlichsten Elemente beschreibt, die bei komplexen herausfordernden Verhaltensweisen nützlich für Veränderungsprozesse sind. Dies alles will diese Arbeit leisten und nachholen. Sie richtet sich dabei an die pädagogischen Mitarbeiter von Wohngruppen, Leitungskräfte, an Mitarbeiter von heilpädagogischen und psychologischen Fachdiensten und sowie an Frühförderstellen mit einem Beratungsauftrag. Beschrieben wird das EHV-Konzept für den stationären Wohnbereich, es ist aber auch für die Familienberatung übertragbar, auch wenn dort einige Spezifikationen in der Konzeption vorgenommen werden müssen.
Wenn man die Literatur zum Thema herausfordernde Verhaltensweisen studiert, so findet man Theorien zur Entstehung von herausfordernden Verhaltensweisen und eine überschauliche Anzahl an Behandlungskonzepten. Was man in der Regel nicht findet, ist die Beschreibung des Weges zum Ziel. Wie kommt ein pädagogisches Team, welches durch bestimmte Verhaltensweisen herausgefordert wird, zu einem Entwicklungskonzept, um herausfordernden Verhaltensweisen zu verändern? Wie kann die Familie durch gezielte Interventionen, gebündelt in einem Gesamtkonzept, mit den herausfordernden Verhaltensweisen umgehen und diese verändern? Man könnte einfach antworten: indem die Vorschläge der Behandlungskonzepte einfach eins zu eins in die Realität umgesetzt werden. Aber so einfach ist die Realität in der Regel nicht. Eine Eins-zu-Eins-Umsetzung scheitert in der Praxis in der Regel an zwei Faktoren:
1. Die soziale Realität, in der herausfordernde Verhaltensweisen auftreten, ist dermaßen komplex, dass die vorgeschlagenen Behandlungskonzepte immer den Besonderheiten der Situation und vor allem den Besonderheiten der beteiligten Personen angepasst werden müssen, wenn sie wirksam sein sollen.
2. Eltern und pädagogische Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen und Diensten sind durch die herausfordernden Verhaltensweisen dermaßen belastet, dass diese zu einer eingeschränkten Wahrnehmung und oftmals zu festgefahrenen Verhaltensmuster geführt haben. Diese festgefahrenen Verhaltensmuster lassen sich nicht durch das einfache Aufzeigen einer Lösung beseitigen. Die festgefahrenen Verhaltensmuster besitzen eine solche Kraft und Anziehung, dass alle Interaktionspartner es schwer haben, andere Verhaltensweisen zu zeigen. Alle Beteiligte im System haben sich so in eine Sackgasse manövriert, dass sie diese Muster nicht mehr verlassen können, weil sie nicht wissen, wo der Weg zum Ziel (die Veränderung der herausfordernden Verhaltensweisen) ist. Man muss sie unterstützen, einen Weg zu finden, der sie ihren Zielen wieder näherbringt. Um das zu erreichen, muss man an den Wirklichkeitskonstruktionen und Haltungen der beteiligten Systemmitglieder ansetzen. Erst wenn diese sich verändern, vergrößert sich ihr Tunnelblick und andere Wege werden wieder sichtbar. Erst jetzt kann der Weg zum Ziel, die Veränderung der herausfordernden Verhaltensweisen, begangen werden.
2. Systemische Grundbegriffe und das psychisches System
Der Mensch besteht aus vielen System und Subsystemen und erst aus ihrer wechselseitige und zirkuläre Bezogenheit entsteht das, was wir unter dem Begriff des Menschen zusammenfassen. Damit der Mensch konstituiert werden kann, ist er auf das Wechselspiel von biologischem, psychischem und sozialem System angewiesen. Zum biologischen System des Menschen gehören u.a. die Gene, die Zellen der Haut als äußere Begrenzung, das Herz-Kreislauf-System, das Verdauungssystem, das Nervensystem, das Gehirn und das Immunsystem. Sicherlich gibt es noch weitere biologische Systeme im System Mensch, aber zur Veranschaulichung reichen die aufgeführten Beispiele aus. Hinweisen möchte ich an dieser Stelle, dass die oben genannten biologischen Systeme starke Rückwirkungen auf das psychische System haben können und umgekehrt. Wenn der Mensch krank ist und sein Immunsystem zur Abwehr der Krankheitserreger aktiv wird, so hat dies Folgen für das psychische System. Der Körper reagiert mit Schlappheit und Fieber und dies führt zu einer verminderten Belastungsfähigkeit und Aktivität des psychischen Systems, da durch die Krankheit das Ruhebedürfnis aller Systeme des Menschen stark vergrößert wird.
Zum psychischen System des Menschen gehören seine Gedanken, Motivationen, Emotionen, Wirklichkeitskonstruktionen und seine affekt-kognitiven Schemata. Auch sie wirken auf das biologische System ein. Ein Mensch, der sich ständig traurig und leer fühlt, wird eher erkranken. Die Gefühle der andauernde Traurigkeit können zu einem Absinken der körpereigenen Abwehrkräfte führen und die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung zunehmen.
Das soziale System besteht aus Personen und dem Austausch von Kommunikationen. Kommunikationen wirken auf das psychische System ein. Sie wirken auf die Emotionen, Wirklichkeitskonstruktionen, affekt-kognitiven Schemata oder die Motivation eines Menschen. Ohne ein soziales System ist die Entwicklung des Menschen nicht möglich. Aufgrund des Verlustes seiner Instinktprogramme ist der Mensch auf Erziehung und Sozialisation angewiesen, um überleben zu können. Erziehung und Sozialisation wird immer in sozialen Systemen vollzogen, in der Regel in der Familie und Bildungsinstitutionen wie Kindergärten, Schulen, Hochschulen oder Ausbildungsstätten. Sie haben entscheidenden Einfluss auf die Genese der menschlichen Persönlichkeit und seiner Wirklichkeitskonstruktionen. Alle drei Systeme sind eng miteinander verknüpft und tragen wesentlich zur Konstitution „Mensch“ bei.
2.1 System und Umwelt
Ich habe in dem ersten Abschnitt oft von Systemen gesprochen, ohne den Begriff des Systems näher zu definieren. Unter einem System versteht Luhmann, „die Differenz zwischen System und Umwelt…. Ich gehe davon aus, dass ein System die Differenz ist, die Differenz zwischen System und Umwelt.“ (Luhmann 2004, S. 67). In der Systemtheorie geht es um Differenzen, um Unterschiede. Man könnte die Luhmannsche Systemtheorie daher als Differenztheorie bezeichnen. Systeme unterscheiden sich von ihrer Umwelt. Sie lassen sich deutlich und dauerhaft von der Umwelt abgrenzen. Dabei bestehen sie solange, solange sie die Unterschiede zur Umwelt aufrechterhalten können. Können die Systeme die Unterschiede zur Umwelt nicht aufrecht halten, zerfallen sie.
Systeme bestehen aus Elementen und deren Relationen zueinander. Diese Elemente und Relationen bilden in der Art und Weise ihrer Vernetzung den Unterschied zu anderen Systemen, die für sie selbst Umwelt sind (vgl. Kneer/ Nassehi 1997, S. 18ff). Die Elemente und deren Relationen zueinander, das System, besitzen daher eine Grenze zu ihrer Umwelt, um das Fortbestehen ihrer Elemente und deren Relationen untereinander sicherzustellen. Ohne Grenze zur Umwelt würden sie in dieser aufgehen und das System würde zerfallen. Die Grenzen bilden die Unterscheidungslinie zur Umwelt. Der Unterschied zwischen System und Umwelt wird durch eine Grenzbildung sichergestellt und aufrechterhalten. Grenzen sind Kriterien, die zwischen dazugehörigen und nicht-dazugehörigen Elementen und deren Relationen zueinander unterscheiden. Sie regulieren die Differenz zwischen System und Umwelt. Um System und Umwelt zu unterscheiden, kann man die Fragen stellen: Was gehört dazu, was gehört nicht dazu? Grenzen sind die Außenhaut der Systeme. Sie sichern die Abgrenzung zur Umwelt und ermöglichen die Identitätsbildung des Systems in Form der Anschlussbereitschaft des Systems an seiner von der Umwelt verschiedenen Anordnung der Elemente und der Relationen zueinander. Grenzen sichern die operative Schließung der Systeme, sind aber für Energie und Informationen offen (vgl. von Schlippe/ Schweitzer 2007, S. 59). Je nach Systemtyp benutzen sie andere Elemente zu ihrer Konstitution. Gedanken sind die Elemente der psychischen Systeme und Kommunikationen sind die Elemente der sozialen Systeme.
Mit dieser Definition von Systemen ist ein System durch einen Anfang und ein Ende gekennzeichnet. Die Umwelt von Systemen hat auch einen Anfang und ein Ende. Sie ist weitaus komplexer als das System selbst, so dass zwischen System und Umwelt ein Komplexitätsgefälle besteht. Komplexität bezeichnet den Grad der Vielschichtigkeit der Differenzierung eines Systems (z.B. Unterteilung in Subsysteme), die Anzahl der Vernetzungen (z.B. von Elementen untereinander) und die Folgelastigkeit eines Entscheidungsfeldes in Form von in Gang gesetzten Kausalketten und Folgeprozessen. Systeme müssen, damit sie funktionieren und sich aufrechterhalten können, Komplexität reduzieren. Sie müssen aus der unendlichen Vielfalt an Möglichkeiten der Vielschichtigkeit, der Vernetzung der Elemente und der Folgelastigkeit von Entscheidungen, die für die Autopoiesis des Systems notwendigen Konfigurationen auswählen und in einem Kreislaufprozess reproduzieren. Das Treffen einer Auswahl bedeutet, die Komplexität der Umwelt auf ein für das System handhabbares Maß zu reduzieren. Die Beziehung zwischen System und Umwelt ist bezogen auf die Komplexität asymmetrisch. Jedes System muss sich gegen die überbordende Komplexität seiner Umwelt behaupten und abgrenzen, wenn es nicht aufhören will, System zu sein, dass sich von seiner Umwelt unterscheidet (vgl. Luhmann 1987, S. 263.). Die Umwelt besteht aus einer unüberschaubaren Vielzahl an Systemen. Unter „nähere Umwelt“ möchte ich daher die Umwelt bezeichnen, die in Form von Kopplungen direkten Kontakt zu dem System hat. Sie stehen in einer Beziehung zueinander und es kommt zu energetischen und informationellen Austauschprozessen. Unter weiterer Umwelt möchte ich all die Umwelt fassen, die noch keinen direkten Kontakt und keine direkte Beziehung zum System aufgebaut hat.
Die nähere Umwelt stellt durch ihren Komplexitätsüberschuss für das System den Nährboden für dessen Weiterentwicklung und Veränderung dar. Die Systeme sind strukturell an ihrer Umwelt orientiert und konstruieren aktiv die Differenz zu ihrer Umwelt. Das System kann Elemente aus der Umwelt (ich könnte auch von Möglichkeiten sprechen) die Systemgrenzen passieren lassen und sie in seine Anordnung der Elemente und deren Relationen zueinander integrieren. Das System differenziert sich, strukturiert sich neu und wird komplexer. Das System entwickelt und verändert sich, indem es aus der Komplexität der Umwelt bestimmte Elemente in seine interne Struktur aufnimmt. Der Prozess und das Ergebnis der Autopoiesis des Systems verändern sich. Dies ist eine Funktion des Komplexitätsüberschusses der Umwelt gegenüber dem System. Das System muss, um sich zu erhalten und fortlaufend zu konstituieren, eine Reduktion der Komplexität vornehmen. Das System entscheidet, welche Elemente zu ihm gehören sollen und welche nicht. Systembildung ist daher ein coevolutionärer Prozess zwischen dem System und seiner Umwelt. Die Umwelt stellt dem System dabei seine Komplexität zur Verfügung, damit das System sich weiterentwickeln kann.
Abschließend können wir festhalten:
Systeme bestehen aus Elementen und deren Verknüpfung untereinander. Das System unterscheidet sich deutlich von anderen Systemen, die seine Umwelt bilden. Systeme haben daher Grenzen. Die Grenzen markieren, was zu einem System gehört und was nicht. Jedes System muss die überbordende Komplexität seiner Umwelt reduzieren, um im System eine zirkuläre Verknüpfung der Elemente organisieren zu können. Je nach Typ des Systems (ist es ein biologisch, psychisches oder soziales) benutzen sie für ihre Autopoiesis verschiedene Arten von Elementen. Psychische Systeme benutzen als z.B. Gedanken und soziale Systeme benutzen Kommunikationen als ihre Elemente.
2.2 Das psychische System aus systemischer Sicht
Die Elemente des psychischen Systems sind Gedanken und Vorstellungen, die untereinander in Relationen stehen. Damit das psychische System sich erhalten kann und sich nicht in der Umwelt auflöst, ist es notwendig, dass es Gedanken an Gedanken an Gedanken produziert. Dies geschieht auf der Basis von Bewusstsein. Das psychische System erhält dabei die Gedanken nicht von außen, noch kann es die Gedanken nach außen abgeben. Das psychische System stellt seine Gedanken, Vorstellungen selber her in einem rekursiv, zirkulären Prozess. Psychische Systeme sind autopoietische Systeme (vgl. Luhmann 1987. S. 354ff.)
2.2.1 Autopoiesis
Das Konzept der Autopoiesis stammt von Maturana und Varela, zwei Biologen und Neurophysiologen, die die Grundlagen des Autopoiesiskonzeptes in den sechziger und siebziger Jahren entwickelt haben. Autopoiesis meint die Selbsterhaltung und Selbsterzeugung des Systems, indem sie die Elemente, aus denen sie bestehen selbst produzieren und herstellen, so dass am Ende wieder das gleiche zirkuläre und rekursive Netzwerk an Elementen reproduziert worden ist (vgl. Schuldt 2003, S. 24). Dies führt dazu, dass autopoietische (selbstreferentielle) Systeme notwendigerweise im Selbstkontakt operieren müssen. Ihre inneren Operationen müssen als geschlossen zur näheren Umwelt gedacht werden. Autopoietische System sind geschlossene Systeme, um durch diesen Abschluss die Produktion der Elemente aus den Elementen sicherzustellen. Diese Schließung bezieht sich nur auf das Kerngebiet der fundamentalen Operationen zur Sicherstellung der autopoietischen Produktion der Elemente aus den bestehenden Elementen. Diese operationale Schließung des Systems ist die Voraussetzung für dessen Offenheit, Energie und Informationen aus der Umwelt aufnehmen zu können. Einerseits führt operationale Schließung zur Autonomie des Systems von der Umwelt und sichert damit das Fortbestehen, andererseits kann ein System ohne die Möglichkeit der Fremdreferenz sich nicht weiter entwickeln und sein Überleben durch Anpassung sicherstellen. Fremdreferenz meint das operative Handhaben einer Unterscheidung aus der näheren Umwelt. Die Grenzen von sozialen und psychischen Systemen sind operationell geschlossen, aber durch strukturelle Kopplungen zur näheren Umwelt offen für Energie und Informationen. Hierdurch können autopoietische Systeme ihre internen Strukturen, die den Prozess der Selbsterhaltung der Elemente und deren beständige Selbsterzeugung steuern, verändern und weiterentwickeln (vgl. Barthelmess 2001, S. 31ff). Die internen Strukturen determinieren den Prozess der Reproduktion der Elemente aus den Elementen. Autopoietische Systeme sind strukturdeterminiert. Daher können sie nicht von außen instruiert werden, ihre Prozesse und damit ihre Outputleistungen im Sinne des Außenstehenden zu verändern. „Lebende Systeme können jedoch verstört (perturbiert, irritiert) werden, sofern der Reiz auf Zustände im Organismus trifft, die eine Reaktion auf einen solchen Reiz zulassen oder gar vorschreiben.“ (Ludewig 2005, S.22-23) Durch diese Verstörung ist eine Änderung der internen Strukturen des autopoietischen Systems möglich, aber immer nur auf der Grundlage der systemeigenen Strukturen. Die Veränderungen bedürfen der Anschlussfähigkeit an die bestehenden Strukturen des Systems, nur so können sie sich autopoietische Systeme und deren Strukturen verändern und weiterentwickeln. Die Schnittstellen zu anderen Systemen werden über strukturelle Kopplungen (Interpenetrationen nach Luhmann) hergestellt.
Zusammenfassend kann ich sagen:
Das psychische System ist ein autopoietisches System, welches fortlaufend in einem strukturell festgelegten Prozess Gedanken aus Gedanken produziert, sich so selbst erhält und dadurch erkennbar seine Grenzen zur näheren Umwelt aufrechterhält. Um Gedanken aus Gedanken zu produzieren, ist das psychische System auf das Medium Sinn angewiesen.
2.2.2 Sinn
Sinn ist das Medium des Prozessierens, das sowohl soziale als auch psychische Systeme benutzen, um die fortlaufende autopoietische Produktion sicherzustellen. Sinn liefert den Verweisungshorizont auf das Anders-möglich-Sein. Sinn erscheint in der Form des Möglichkeitsüberschusses des Erlebens und Handelns. Es verweist auf weitere Abschlussmöglichkeiten bezogen auf die vorherige Operation. Sinn verweist auf weiteren Sinn. Sinn ist die Differenz zwischen Aktualität und Möglichkeit. Sie öffnet den Raum der Komplexität, indem sie auf all die Anschlussmöglichkeiten verweist, die zur vorherigen Operation passen. Gleichzeitig zwingt Sinn zur Selektion einer Anschlussmöglichkeit und hilft die unüberschaubare Komplexität zu reduzieren (vgl. Luhmann 1987, S. 92ff.).
Sinn verweist dabei immer auf die rechte Seite der binären Logik, auf die unendliche Anzahl der Teile und Vielheiten im unendlichen Welthintergrund. Durch das Prozessieren von Sinn wird ständig die Differenz von Aktualität und Möglichkeit mit produziert. „Sinn ist laufende Aktualisierung von Möglichkeiten.“ (Luhmann 1987, S. 100). Sinn ist die Differenz zwischen aktuell Gegebenem und aktuell Möglichem im Prozess der Gedanken- oder Kommunikationsproduktion. Aus dieser Grunddifferenz reproduzieren psychische wie soziale Systeme Informationen.
Sinn ist zudem selbstreferentiell organisiert, da Sinn immer an Sinn anschließt. Auf Sinn kommt Sinn, kommt Sinn, kommt Sinn….Sinn sichert psychischen und sozialen Systemen den Anschluss an die vorherige Produktion des Elements und sichert so die Autopoiesis des Systems. Sinn ist die aktive Auswahl aus der Fülle der Möglichkeiten des Welthintergrundes und deren Produktion im autopoietischen Prozess des jeweiligen Systems. Erleben und Handeln ist Selektion von Möglichkeiten anhand von Sinnkriterien.
Psychische aber auch soziale Systeme sind Sinnsysteme. Sinn organisiert die Anschlüsse im rekursiven und zirkulären Prozess der Produktion der Elemente aus ihren Elementen.
2.2.3 Selbstreferenz und Fremdreferenz
„Selbstreferenz bedeutet, dass eine Einheit in ihrer Dynamik immer wieder auf sich selbst zurückkommt, an sich selbst anschließt.“ (Barthelmess, S. 31. 2001) Selbstreferenz befindet sich im Wechselspiel zwischen Prozess und Struktur. Beide greifen ineinander ein und bedingen sich. Sie sorgen dafür, dass das System, indem es auf die Umwelt reagiert, auf sich selbst reagiert. Systeme können sich nur zu sich selbst verhalten. Die Selbstreferenz ist die Bedingung für eine weitere Ausdifferenzierung des Systems. Ein Selbst kann nur das sein, was es ist und nicht das sein, wovon es sich unterscheidet. Selbstreferenz meint daher den Prozess des Sich-von-sich-selbst-Unterscheidens. Dadurch wird die Einschleusung von einer neuen Unterscheidung möglich. Aber wie ist das möglich? Wie ist das Einschleusen von etwas Neuem möglich? All diese Fragen verweisen auf den Begriff der Fremdreferenz. Damit sich Selbstreferenz nicht in der Herstellung des ewig Gleichen erschöpft, ist in der Selbstreferenz die Möglichkeit der Fremdreferenz mit eingebaut. Selbstreferenz als die Basis der Prozesse schließt keineswegs die Fremdreferenz aus, sie ermöglicht sie geradezu. Denn als Begleitmelodie der internen in Prozessen organisierten Operationsketten gibt es immer Verweisungsbeziehungen zu anderen Anschlussmöglichkeiten durch das Medium Sinn. Dies kann ein System durch Fremdreferenz gewährleisten. Referenz meint die Handhabung von Unterscheidungen. Durch Fremdreferenz wird eine Unterscheidung zur Umwelt für innersystemische Prozesse nutzbar gemacht. Neuer Sinn wird in die internen Sinnstrukturen des Systems eingeführt und für die selbstreferentiellen Prozesse nutzbar gemacht. Die Verweisungsbeziehungen und Sinnofferten bleiben in der Umwelt, sie werden aber intern abgebildet. „Damit ist Fremdreferenz als Spezialform der Selbstreferenz zu denken, denn auch die Prozesse, welche Umwelt wahrnehmen und die so wahrgenommenen bzw. aus der Umwelt generierten Informationen einer internen Verarbeitung zuführen, schließen permanent an sich selbst an.“ (Barthelmess, S. 33. 2001)
2.2.4 Strukturelle Kopplung (Interpenetration)
Fremdreferenz verweist auf die Fähigkeit von Systemen, spezifische Beziehungen zu anderen Systemen eingehen zu können und diese für den Aufbau der eigenen internen Komplexität zu nutzen. Diese spezifische Beziehung zwischen Systemen bezeichnen Maturana und Varela als strukturelle Kopplungen. Luhmann nennt sie Interpenetration. Ich bleibe bei dem Begriff der strukturellen Kopplung, weil er mir zu der spezifischen Beziehung von Systemen besser zu passen scheint.
Strukturell gekoppelte Systeme sind füreinander nähere Umwelt, sie bilden aber Überlappungsbereiche an ihren Grenzen, in denen es zum Austausch und der Aufnahme von Energie und Informationen kommt. Beim Menschen bilden seine Wahrnehmungsorgane wie Augen und Ohren seine strukturellen Kopplungen zur Umwelt aus. Die Organe nehmen Außenreize wahr und leiten diese an die beteiligten Subsysteme des Menschen zur Weiterbearbeitung weiter. Dabei transformieren sie die Reize in elektrische Impulse, damit das Gehirn sie verarbeiten kann. Das psychische System beobachtet die Zustandsänderungen in Nervenarealen und beschreibt diese dann. Durch diese Beschreibung generiert und konstruiert das psychische System Informationen in Form von Gedanken an Gedanken. In den strukturellen Kopplungen werden neben dem Austausch von Energie und Informationen die dafür nötigen Transformationen durchgeführt, damit das nächste System den Reiz in der Form erhält, wie es ihn verarbeiten kann. Umgekehrt läuft dies auch, wenn das psychische System kommuniziert. Gedanken werden in Kommunikationen transformiert. Dies geschieht indem Moment, wenn aus unserem Mund Laute herauskommen, die dann als verbale Mitteilung das Kommunikationssystem konstituieren.
Durch strukturelle Kopplungen zwischen Systemen können neue Informationen, sofern das System verstört worden ist, in die bestehenden Strukturen des operativ geschlossenen Produktionszentrums des Systems eingebaut werden, sofern sie anschlussfähig sind zu dessen sinnhafter Struktur. Durch strukturelle Kopplungen stellen die Systeme ihre eigene Komplexität anderen Systemen zur Verfügung und nehmen dabei Einfluss auf die Entwicklung deren interner Strukturbildung (vgl. Morel u.a. 1997, S. 230). Dies geschieht nicht im Sinne einer Instruktion, sondern aus der zur Verfügung gestellten Komplexität wird eine Information generiert, die zur Verstörung führen kann und damit die Wahrscheinlichkeit zur Weiterentwicklung des psychischen oder sozialen Systems erhöht. Die Weiterentwicklung geschieht aus dem Bestreben des Systems, die Verstörung aus der Welt zu schaffen. Strukturelle Kopplungen ermöglichen den Zugang zu der Komplexität anderer Systeme, die dann für den Aufbau der eigenen systeminternen Komplexität genutzt werden kann (vgl. Luhmann 1987, S. 290). Ohne Anreize aus der Umwelt könnte sich kein System entwickeln, es würde erstarren. Dabei ist es das System, das entscheidet, welche der vielen Möglichkeiten es aus der Umwelt nach einer Verstörung in seine bestehenden Strukturen integrieren möchte. Dies geschieht anhand einer Ja-Nein-Codierung. Entweder es wird eine neue Möglichkeit (Information) in die bestehende Struktur integriert oder sie wird es nicht. Es gibt kein Dazwischen.
Die Evolution von Systemen und ihrer näheren Umwelt ist durch die gegenseitige Bereitstellung von Komplexität möglich, indem sie strukturelle Kopplungen eingehen und sich in einem wechselseitigen Dialog der Informationen befinden. Strukturelle Kopplungen stellen Überlappungsbereiche zwischen Systemen dar, die Grenzen sozialer Systeme fallen in die der psychischen Systemen und umgekehrt. Dadurch sind soziale Systeme gezwungen, sich dauernd an dem Strom der Gedanken des psychischen Systems zu orientieren und umgekehrt orientiert sich das psychische System dauernd an der fortlaufenden Produktion der Kommunikation im sozialen System. Das Medium Sinn ist Verbindungsglied zwischen den psychischen und sozialen Systemen, wenngleich psychische Systeme mit der autopoietischen Produktion von Gedanken und soziale Systeme mit der autopoietischen Produktion von Kommunikation operieren. Sinn sichert die Anschluss- und Austauschfähigkeit sozialer und psychischer Systeme, im dem es das Verstehen und die fortlaufende Produktion der Elemente beider Systemarten sicherstellt.
Kommunikation ist strukturell an Bewusstsein gekoppelt und umgekehrt ist Bewusstsein an Kommunikation gekoppelt. Beide brauchen einander für den Aufbau ihrer internen Komplexität und ihrer rekursiven Operationsnetzwerke. Bewusstsein regt die Kommunikation an, ja erst durch Bewusstsein kann Kommunikation überhaupt entstehen. Kommunikation gibt dem Bewusstsein Rückmeldungen und Möglichkeiten, mit anderen psychischen Systemen in Kontakt zu treten. Gleichzeitig ist das Bewusstsein auf die Anregungen der Kommunikation angewiesen, damit es sich entwickeln, damit es lernen kann und um gleichzeitig wieder Kommunikation produzieren zu können.
Ich kann den Begriff der strukturellen Kopplung wie folgt zusammenfassen:
Psychische Systeme müssen zum Aufbau der internen Komplexität strukturelle Kopplungen mit ihren näheren Umwelten eingehen. In den strukturellen Kopplungen kommt es zum Austausch von Energie und Informationen. In den strukturellen Kopplungen werden Außenreize transformiert, damit sie für die nächsten verarbeitenden Systeme handhabbar werden.
2.2.5 Erwartungen, Regeln und Strukturen
Damit psychische und soziale Systeme ihre interne Anschlussfähigkeit sicherstellen können, sind sie auf die Ausbildung von Erwartungen angewiesen. Erwartungen stehen für das anzunehmende Eintreten eines bestimmten Ereignis. Man erwartet, dass x passiert und wenn x passiert, dann trägt dies zur Bestätigung der Erwartung bei.
Erwartungen stabilisieren die autopoietischen Prozesse eines Systems. Erwartungen dienen dazu, die internen Operationen der Produktion der Elemente aus den Elementen, aus denen sie bestehen, aufeinander abzustimmen und gleichzeitig dienen sie der Koordination und Abstimmung der Austauschbeziehungen zu anderen Systemen. Sie bilden sich im Laufe der Geschichte eines Systems heraus.
Erwartungen verweisen auf Anschlüsse, die angeschlossen werden sollen und deren Anschluss man annimmt. Erwartungen schließen andere Anschlussmöglichkeiten aus. Sie selektieren und präferieren einen bestimmten Anschluss und helfen so, Komplexität zu reduzieren. Sie geben psychischen wie sozialen Systemen Orientierung, welche gedankliche und kommunikative Operation an die vorherigen angeschlossen werden soll und welche nicht. Dies muss das System im Sinne einer Ja/Nein-Codierung wählen. Man könnte ganz im Watzlawickschen Sinne sagen: man kann nicht nicht entscheiden, welche Anschlussmöglichkeiten getroffen werden sollen.
Erwartungen entstehen durch die antizipierte Vorwegnahme einer gedanklichen oder kommunikativen Anschlussoperation und erhöhen dadurch die Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung. Sie können auch durch das wiederholte Aktualisieren derselben Operationsanschlüsse entstehen. Erwartungen schränken den Möglichkeitsspielraum von Operationanschlüssen ein und sind damit Bedingungen für die Aufrechterhaltung des autopoietischen Prozesses in einem System (vgl. Luhmann 1987, S. 392.) Durch Erwartungen können Verstörungen im System sichtbar gemacht werden. Erwartungen können enttäuscht werden. Diese Enttäuschung ist die Verstörung des Systems. Es kommt zu einem Konfliktzustand im System, da nun entschieden werden muss, ob an der enttäuschten Erwartung festgehalten wird oder ob die Erwartungshaltung verändert wird. Hält man an der enttäuschten Erwartung fest, so besteht die Möglichkeit einer fortlaufenden Erwartungsenttäuschung. Zielrichtung aller weiterer Operationen wird der Versuch sein, die Einhaltung und Beachtung der Erwartung von den anderen Systemmitgliedern einzufordern; mit der Möglichkeit einer anhaltenden Erwartungsenttäuschung. Oder man verändert die enttäuschte Erwartungshaltung und verhindert so das weitere Entstehen einer Verstörung. Verstörungen können den Fortbestand des autopoietischen Prozesses gefährden, müssen es aber nicht. Verstörungen verlangen aber vom System einen erhöhten Energieaufwand, um die fortlaufende Produktion der Elemente aus den Elementen sicherzustellen. Verstörungen können Ausgangspunkt für Veränderung in der autopoietischen Produktionskette sein, weil es zu Änderung in der Prozessabfolge und in der autopoietischen Struktur kommt.
Wenn Erwartungen häufig bestätigt werden, lassen sie sich in Regeln verdichtet beschreiben. Regeln basieren auf Erwartungen und dem Eintreffen des antizipierten kommunikativen oder gedanklichen Anschlusses. Regeln schränken den Möglichkeitsspielraum von Systemen und die Möglichkeiten der Anschlüsse an die vorherige Operation, sei sie gedanklich oder kommunikativ, ein. Regeln beschreiben, was verboten ist, an die vorherige Operation anzuschließen und sie beschreiben gleichzeitig, welche Operationen angeschlossen werden sollen. Regeln enthalten Verbots- und Gebotsinformationen: sie beschreiben, was an Anschlussoperationen verboten und was erlaubt ist. Sie bestimmen die Gedankensequenzen in psychischen Systemen und die Kommunikationssequenzen in sozialen Systemen.
Regeln lassen sich in deskriptive und präskriptive Regeln unterteilen.
Deskriptive Regeln entstehen durch die Beobachtung der Wirklichkeit, indem aus den Beobachtungen Wenn-Dann-Beziehungen konstruiert werden. Der Beobachter analysiert das Gesehene und leitet daraus wieder Regeln ab, die dann sein weiteres Denken und Handeln beeinflussen können. Wenn man neu in eine Gruppe kommt, sich erst einmal still verhält und sich Zeit für Beobachtungen nimmt, ist man in der Lage, die Kommunikationen innerhalb der Gruppe anhand von Wenn-Dann-Beziehungen zu beschreiben. Man kann so die Regeln der Gruppe entschlüsseln, wie man sich zu verhalten hat. Man erkennt, was in der Gruppe an Kommunikationen erlaubt und was untersagt ist. Noch deutlicher wird das an dem Beispiel, wenn man zum ersten Mal ein Volleyballspiel sieht und dessen Regeln nicht kennt. Durch eine Analyse im Sinne der Wenn-Dann-Beziehung kann man sich die Regeln des Volleyballspiels erschließen, ohne dass man sie erklärt bekommen hat. Deskriptive Regeln fließen in unsere Wirklichkeitskonstruktionen mit ein und leiten unser Handeln. Sie verweisen auf die Anschlüsse an die vorherige Kommunikation (vgl. Simon 1993, S.110). Die Basis der deskriptiven Haltungen sind Erwartungen.
Präskriptive Regeln lassen sich in Gebote und Verbote unterteilen. Sie definieren den Möglichkeitsspielraum für das System, Elemente an Elementen anzuschließen. Sie sagen, welche Anschlussmöglichkeiten von Gedanken und Kommunikation verboten und welche erlaubt sind. Sie reduzieren damit Komplexität, steigern die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Gedanken- oder Kommunikationsanschlüsse und stabilisieren so die autopoietische Reproduktion der Elemente des Systems. Durch Verbote sind Wahlmöglichkeiten eingeschränkt, da sie nicht realisiert werden dürfen. Dies besagt aber nicht, dass Verbote nicht überschritten werden können. Psychische Systeme sind zur Freiheit verdammt, sie müssen zwischen den verschiedenen Möglichkeiten wählen, welche sie realisieren wollen. Das beinhaltet auch die Möglichkeit, ein Regelverbot nicht zu akzeptieren und genau diese Wahlmöglichkeit in die Tat umsetzen.
Regelgebote beschreiben, was an die vorherige Operation gedanklich oder kommunikativ angeschlossen werden kann und soll. Dabei handelt es sich meist um Operationsanschlüsse, welche sich in der bisherigen Geschichte des Systems als günstig und nützlich erwiesen haben (vgl. Simon 1993, S. 124). Auch bei Regelgeboten greift die Wahlfreiheit.
Vor jeder Realisierung eines Regelgebotes oder Regelverbotes durchläuft das psychische System einen Entscheidungsprozess im Sinne der Ja/Nein-Codierung: folge ich dem Gebot/Verbot oder nicht? Präskriptive Regeln entstehen durch das direkte Interagieren im System oder zwischen Systemen. Erwartungen werden abgeglichen und verfestigen sich durch ihre kontinuierliche Bestätigung. Präskriptive Regeln können durch Reflektion und Aushandlung im und zwischen Systemen entstehen.
Deskriptive und präskriptive Regeln organisieren und koordinieren den Prozess der rekursiven und zirkulären Vernetzung der Elemente und deren Produktion aus den Elementen, aus denen sie bestehen. Sie sind die Handlungsleitlinien von psychischen und sozialen Systemen.
Erwartungen und deren Verdichtung in deskriptive und präskriptive Regeln stabilisieren sich in psychischen Systemen selbst, indem sie sich für die erfolgreiche Umsetzung selbst positiv verstärken, z.B. durch das Erleben eines Erfolges oder eines gutes Gefühls. In sozialen Systemen wird die Einhaltung der Regeln neben dem Einsatz von positiven Verstärkern auch noch durch den Einsatz von negativen Verstärkern wahrscheinlicher gemacht. Werden präskriptive Regeln nicht eingehalten, so kann derjenige dafür durch einen negativen Verstärker bestraft werden. Über jedem Regelbruch liegt die Androhung des Einsatzes einer Sanktion, unabhängig davon, ob sie zur Anwendung kommt oder nicht. Die angedrohte Sanktion bzw. die durchgeführte Sanktion beschwert die Regel und erhöht die Wahrscheinlichkeit ihrer Einhaltung. Im Berufsalltag stellt die Zahlung eines Lohnes eine positive Verstärkung für die Erbringung der Arbeitsleistung und die Beachtung der dienstlichen Vorschriften dar. Bei Regelverletzungen von Geboten oder Verboten stehen den Arbeitgebern dann z.B. das Disziplinargespräch, die Abmahnung und die Kündigung zur Verfügung.
Psychische und soziale Systeme bestehen aus einer unüberschaubaren Anzahl an deskriptiven und präskriptiven Regeln. Wenn Sie als Leser sich einmal die Mühe machen würden, alle Regeln in ihrer Partnerschaftsbeziehung zu verschriftlichen, dann werden Sie mit einem DIN-4 Papier nicht auskommen. Jedes psychische oder soziale System besteht aus einem Bündel von deskriptiven und präskriptiven Regeln zur Steuerung und Koordinierung der internen Produktion der rekursiv und zirkulär verknüpften Elemente aus den Elementen. Dieses Bündel an Regeln kann als Struktur bezeichnet werden. Strukturen eines Systems sind die Anzahl der vorhanden deskriptiven und präskriptiven Regeln. Sie sichern den Fortbestand der zirkulären Relationierung der Elemente des Systems über den Zeithorizont hinweg. Strukturen schränken die im System zugelassenen zirkulären Relationen ein und regulieren damit auch die mögliche Outputleistung eines Systems. Sie stabilisieren den autopoietischen Prozess eines Systems.
Zusammenfassend bedeutet das für psychische Systeme: ihre internen, sich selbsterzeugenden und selbsterhaltenden autopoietischen Prozesse sind durch Strukturen geleitet. Die Strukturen stabilisieren die Produktion der Gedanken aus den Gedanken und stützen deren zirkuläre Verknüpfung. Sie schränken dabei den Möglichkeitsspielraum der internen zirkulären Prozessrelationen der Gedanken ein und machen dadurch die Komplexität des Welthintergrundes durch Reduktion handhabbar.
2.2.6 Beobachtung
Der Begriff der Beobachtung ist ein zentraler Begriff zum Verständnis von psychischen Systemen. Ein psychisches System, welches bewusste Gedanken an Gedanken produziert, kann nur entstehen, wenn es einen bewussten Selbstbezug entwickelt. Psychische Systeme sind auf Selbstreferenz ihrer internen Gedankenoperationen angewiesen. Die geschieht durch eine Ausdifferenzierung des psychischen Systems. Das neue Subsystem heißt Selbstbeobachtung. Selbstbeobachtung ist selbstreferentiell strukturiert.
Ein psychisches System kann nur anhand der Differenz zu anderen Systemen entstehen und sich aufrechterhalten. Psychische Systeme können daher verstanden werden als eine Beziehung zum Selbst und zu seiner Umwelt. (vgl. Barthelmess 2001, S. 61). Beobachtung ist auf die Wahrnehmung von Innen- oder Außenreizen angewiesen. Für die Wahrnehmung von Außenreizen kann die Beobachtung auf olfaktorische, gustatorische, taktile, visuelle und akustische Sinneskanäle zurückgreifen. Die wahrgenommen Sinnesreize aus der näheren Umwelt werden in Informationen umgewandelt. Informationen sind Unterschiede, die einen Unterschied machen. Beobachten heißt daher, Unterscheidungen zu vollziehen und diese zu benennen. Erst in der Synthese dieser beiden Komponenten kann von Beobachtung gesprochen werden (vgl. Simon 1993, S. 60). Die beobachtbare Unterscheidung muss im zweiten Schritt in eine semantische Figur, die Bezeichnung, eingefügt werden. Ohne symbolische Zeichen gibt es keine Möglichkeit, den beobachtbaren Unterschied zu bezeichnen. Der Prozess der Bezeichnung und Unterscheidung ist eine interne Operation des psychischen Systems. Es ist seine Eigenleistung auf Basis der systemspezifischen Autopoiesis.
Zur Logik der Beobachtung gehört es, dass die Beobachtung aus der Umwelt mehr über das beobachtende System und seine interne autopoietischen Prozessstrukturen aussagt, als über die Wirklichkeit des zu beobachtenden Unterschieds in der Umwelt. Der Bezug der Beobachtung ist nur vordergründig der beobachtbare Unterschied, sondern aufgrund der Konstruktionsleistung des Systems ist die Referenz der Beobachtung immer Selbstreferenz. Sie verweist auf die internen Beobachtungsstrukturen und nur auf diese (vgl. Willke 1996, S. 168). Es ist der Beobachter, der die Unterscheidungen zieht und sie mit Bezeichnungen versieht und sonst niemand. Dabei greift er im Rahmen des Sozialisationsprozesses auf erworbene sprachliche Symbole zurück, über die es einen gesellschaftlichen Grundkonsens gibt. Neben der Bezeichnung der Unterscheidung reichert der Beobachter die bezeichnete Unterscheidung mit individuellen Bedeutungen an. Die beobachtbaren Unterschiede und deren Bezeichnungen und Bedeutungsfüllung werden im Laufe der Entwicklung des psychischen Systems immer weiter ausdifferenziert. Immer neue beobachtete und bezeichnete Unterscheidungen werden hinzugefügt. Es entstehen Ober- und Unterbegriffe. Es entsteht ein Bündel von miteinander vernetzten Bezeichnungen. Ich werde es später als affekt-kognitives Schemata beschreiben. Aus dem Begriff des Hundes wird ein Rüde, ein Welpe, ein Schäferhund und ein Kampfhund abgeleitet und dem Oberbegriff Hund untergeordnet. Diese werden abgegrenzt von der Katze, dem Kater, der Siamkatze usw.
Alle beobachteten und bezeichneten Unterschiede sind Eigenleistungen des Systems. Das psychische System hat sich ein Abbild der Wirklichkeit konstruiert, aber es ist nur ein konstruiertes, subjektives Abbild. Ein anderes psychisches System kann sich ein ähnliches, aber kein gleiches Abbild der Wirklichkeit konstruieren. Die Anzahl der konstruierten Wirklichkeiten ist mit der Anzahl der auf der Erde lebenden Menschen gleichzusetzen.
Die Beobachtungsfähigkeit des psychischen Systems ist auf das Nervensystem und auf das Gehirn zur Gewinnung von beobachtbaren Unterschieden angewiesen sowie auf neuronale Speichermöglichkeiten, um symbolische Zeichen als Bezeichnung der beobachtbaren Unterschiede benutzen zu können.
Wenn eine Information durch die Sinnesorgane in das Nervensystem, als operational geschlossenes, aber energetisch und informationell offenes System, kommt, wird diese in elektronische Impulse übersetzt, die dann bestimmte Nervenareale im Gehirn aktivieren und deren Zustände verändern. Diese internen Zustandsänderungen lassen sich durch das psychische System beobachten. Dass die Beobachtung eher auf interne Zustandsänderungen anspricht als auf externe Informationen, kann man schon an dem Verhältnis zwischen peripheren sensorischen Neuronen (Zuständig für die Aufnahme von Umweltreizen) und Verarbeitungsneuronen im Gehirn und Motoneuronen erkennen. „Beim Menschen dagegen liegt das Verhältnis zwischen 1:100000:1 und 1:1000000:1.“ (vgl. Barthelmess 2001, S.64). Das psychische System beobachtet die Zustandsänderungen in den Relationen der verschiedenen spezialisierten Neuronen des Nervensystems. Wenn man eine Hand auf Eis legt, dann weiß das psychische System allenfalls etwas über die Veränderungen der Zustände in den sensorischen und verarbeitenden Neuronen seines Nervensystems. Das psychische System errechnet aus diesen veränderten Zuständen einen Eigenzustand. Der veränderte Zustand ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Das psychische System kann die Errechnung des Eigenzustands selbst beobachten und bezeichnen. „Nicht also Abbildungen der Welt konstituieren unsere kognitiven Bereichen, sondern interne Errechnungen.“ (Ludewig, S. 2005, S. 24). Von außen kann nichts in das Nervensystem gelangen. Außeninformationen, die durch die Sinnesorgane aufgenommen werden, regen lediglich die Neuronen zur Veränderung ihrer inneren Zustände und Aktivitäten an. Das Nervensystem verarbeitet Unterschiede in den Relationen zwischen seinen Zuständen und errechnet daraus einen Eigenzustand, der dann bezeichnet werden kann. Diese erfahrbaren und bezeichneten Unterschiede konstituieren die Innenwelt des psychischen Systems und sein individuelles sowie subjektives Erleben. Die Bezeichnungen in Form von sprachlichen Symbolen bilden die Schemata aus, aus denen die Innenwelt des Beobachters besteht. Diese Bezeichnungen werden dem Kommunikationssystem zur Verfügung gestellt.
Das Erkennen entsteht aus dem Verstehen der Zusammenhänge, der Wirkweise und den Vernetzungen der zirkulären verknüpften Elemente. Sie lassen sich in deskriptiven und präskriptiven Regeln verdichten. Das Erkennen ist aber kein Erkennen der Welt, wie sie An-Sich ist, sondern das Erkennen ist nichts als die eigene Konstruktion des Erkennens im psychischen System selbst. Beobachtungen erschließen nicht nur einzelne Unterschiede und bezeichnen sie, sie analysieren und beschreiben auch die Regeln der Interaktion zwischen vernetzten Objekten und Systemen in der Umwelt. Dies wird als Kybernetik erster Ordnung bezeichnet. Hier wird noch die alte Annahme hochgehalten, es gäbe eine vom Beobachter unabhängige objektive Erkenntnis von der Welt. Ich habe aber oben dargestellt, dass jegliche Beobachtung Selbstbeobachtung der internen Zustandsänderungen im neuronalen System ist. Daraus werden die Bezeichnungen und die Erkenntnis konstruiert. Das psychische System ist also der Konstrukteur seiner eigenen Welt und Wirklichkeit. Damit ist eine vom Beobachter unabhängige Erkenntnis nicht möglich, da sie immer seine Eigenkonstruktion darstellt und nicht objektivierbar ist. Jegliche Erkenntnis über die Welt ist damit abhängig vom Beobachter. Der Beobachter wird plötzlich zum teilnehmenden Beobachter, der aktiv die ihm umgebende Welt mitkonstruiert (vgl. Simon 2000, S. 34). Daher kann man jegliche Erkenntnis nur beschreiben und auswerten, wenn man den Beobachter als Teil des Erkenntnisprozesses begreift.
Die Kybernetik der zweiten Ordnung erfüllt diese Bedingungen. Sie nimmt die Wechselwirkungen zwischen dem psychischen System und dem Gegenstand seiner Erkenntnis in den Blick. Der Beobachter wird betrachtet, wie er beobachtet und wie er als Beobachter andere Beobachter beobachtet. Daraus ergeben sich hochkomplexe, sich selbstverstärkende zirkuläre Prozesse, in deren Verlauf Erkenntnis- und Glaubensstrukturen entstehen. Der Beobachter konstruiert die Welt nach den Maßgaben seiner internen autopoietischen Prozesse und Strukturen, nach denen seine Wahrnehmung/Beobachtung, seine Emotionen und seine Kognitionen organisiert sind. Durch diesen internen Filter schaut er auf die Welt, konstruiert und errechnet Erkenntnis und Realität. Blinde Flecke, also Bereiche, die nicht beobachtet werden können, sind damit in der Beobachtungsstruktur des Beobachters automatisch mit eingebaut. Man kann nur das beobachten, was die internen autopoietischen Prozesse und Strukturen zu beobachten ermöglichen. Durch Reflektion sowie durch Feedbacks aus der näheren Umwelt lassen sich blinde Flecke entdecken und aufhellen, so dass sie der Beobachtung wieder zugänglich werden.
2.2.7 Erkennen und Wirklichkeitskonstruktion
Erkennen setzt Beobachtung voraus. Beobachtung ist die Eigentätigkeit des psychischen Systems, indem Unterschiede beobachtet und bezeichnet werden. Diese Beobachtung der Unterschiede bezieht sich auf die Veränderungen der Zustände im Nervensystem, aus dem die Beobachtung Erkenntnis errechnet. Erkennen bedeutet, die Wirklichkeit zu konstruieren. Erkennen kann sich auf einzelne Objekte oder auch auf die komplexen wechselseitigen Beziehungen der bezeichneten Unterscheidungen untereinander beziehen. Erkennen konstruiert sich in Bezeichnungen, in Vorstellungen, in deskriptiven und präskriptiven Regeln über die Welt, in emotionalen Zuständen des psychischen Systems, in Haltungen, in Wissen und Glaubenssätze. Dies alles kann in affekt-kognitive Schemata zusammengefasst werden. Die Beobachtung startet den Aufbau der Beschreibung der Welt in Form des Erkennens. Das Fundament der Wirklichkeitskonstruktionen ist das Netzwerk affekt-kognitiver Schemata.
Gleichwohl werden auch Erklärungen generiert, wie die wechselseitigen Beziehungen der Elemente oder der Systeme funktionieren, wer auf was wie eine Wirkung ausübt. Es werden sozusagen sinnhafte Theorien entwickelt, wie etwas zusammenhängt und funktioniert. Wie ich mir die Welt erkläre, so handle ich auch. Neben der Erklärung finden, ausgerichtet an den internen Maßstäben, noch emotionale und kognitive Bewertungen der beobachtbaren Objekte und ihrer wechselseitigen Beziehungen statt. Man bewertet die Unterschiede und ihre wechselseitigen Beziehungen als positiv oder negativ (vgl. Simon 2005, S. 71-73). All dies fließt ebenfalls in die affekt-kognitiven Schemata und deren Kombination zu Wirklichkeitskonstruktionen mit ein. Die affekt-kognitiven Schemata existieren in einer unendlichen Anzahl im psychischen System. Sie sind alle rekursiv und zirkulär untereinander vernetzt und beeinflussen sich immer wechselseitig. Die rekursiv und zirkulär vernetzten affekt-kognitiven Schemata bilden das Gerüst für die Konstruktion unserer Wirklichkeit, als ein aktiver Konstruktionsakt des psychischen Systems.
Die affekt-kognitiven Schemata fungieren im psychischen System als innere Landkarte. Jede Beobachtung wird durch die affekt-kognitiven Schemata gefiltert und sie dienen bei der Errechnung der Wirklichkeit als Fundament. Der Beobachter, so haben es psychologische Forschungen im Bereich der Wahrnehmung bestätigt, konstruiert die Wirklichkeit anhand weniger Punkte, die er im Rahmen der neuronalen Zustandsänderung bei sich selbst wahrnimmt. Die fehlenden anderen Teile des Puzzles der Wirklichkeit werden aus den vorhandenen affekt-kognitiven Schemata rekonstruiert, so dass aus den einzelnen Puzzleteilen ein ganzes Bild wird. Dies lässt sich gut an dem bekannten Beispiel vom Ehemann und dem Friseurbesuch seiner Frau illustrieren. Der Ehemann kommt nach Hause, wo seine Frau auf ihn wartet. Sie war beim Friseur und hat sich eine neue Frisur zugelegt. Sie erwartet, dass ihr Mann dies bemerkt und ihr ein Kompliment macht. Der Ehemann kommt nach Hause, begrüßt seine Frau und geht dann ohne ein Kompliment über die neue Frisur in die Küche, um Abendbrot zu essen. Was ist beim Ehemann passiert? Er hat beim Hereinkommen in die Wohnung seine Frau gesehen. An drei oder vier Merkmalen aus ihrem Gesicht hat er sie wiedererkannt. Die restlichen Merkmale hat er dann aus der Erinnerung reproduziert. Und in seiner Erinnerung hatte seine Frau noch lange Haare gehabt und keine kurzen, also reproduziert er aus der Erinnerung das Bild seiner Frau mit langen Haaren und übersieht die neue Frisur.
Wirklichkeitskonstruktionen beschreiben die Welt aus Sicht des psychischen Systems. Sie definieren den Möglichkeitsspielraum des psychischen und des sozialen Systems, weil die Ideen, Haltungen, Emotionen, Regeln und Strukturen bestimmte Gedanken bzw. Handlungen nahe legen und andere ausschließen. Wirklichkeitskonstruktionen sind immer Eigenleistungen des psychischen Systems.
Ich halte also folgendes fest:
Psychische Systeme sind gekennzeichnet durch eine Beziehung zu ihrem Selbst und zur Umwelt. Sie können beobachten, indem sie Unterschiede markieren und diese bezeichnen. Die daraus entstehenden Wirklichkeitskonstruktionen sind Eigenleistungen des psychischen Systems. Sie konstruieren sich ihre Welt selbst. Damit ist jede Sicht auf die Welt eine individuelle und subjektive. Beobachtungen werden zu Erkenntnissen, zu Konstruktionen der Wirklichkeit. „Unabhängig davon, ob also eine reale Wirklichkeit außerhalb des Beobachters existiert, ist die Strukturierung dieser Wirklichkeit, die Wahrnehmung von Ordnung, Strukturen und Mustern ein Akt des wahrnehmenden Beobachters und nicht der wahrgenommenen Außenwelt.“ (Strunk/ Schiepek 2006, S. 244) Die einzelnen bezeichneten Unterscheidungen werden ausdifferenziert zu einem wechselseitig sich gegenseitig beeinflussenden Netzwerk aus affekt-kognitiven Schemata. Diese bilden das Netzwerk der Wirklichkeitskonstruktionen und sind der Filter der Beobachtung der Umwelt. Die affekt-kognitiven Schemata bestehen aus Bezeichnungen, Vorstellungen, deskriptiven und präskriptiven Regeln, Haltungen, Wissen, Erklärungen, Bewertungen, Glaubenssätzen und emotionalen Einfärbungen. Die Wirklichkeitskonstruktionen beschreiben die Welt und damit den Möglichkeitsspielraum für des psychischen Systems. Wie das psychische System die Welt beschreibt, so verhält es sich auch.
2.2.8 Affekt-kognitive Schemata und die innere Landkarte
Wenn das psychische System Unterschiede, die Unterschiede machen, entdeckt, so werden diese mit einer Bezeichnung versehen, sofern noch keine Bezeichnung dafür abgespeichert ist. Bei diesem Prozess der Informationsverarbeitung durchläuft die Information erst eine emotionale Bewertung und Einschätzung, bevor es durch das Denken zu einer kognitiven Überformung kommt. Das Bezeichnete wird dann mit einem Bündel an Bedeutungen versehen. Dieses Bündel an Bedeutungen besteht z.B. aus Wissensfragmenten, theoretischen Erklärungen, sprachlichen Vokabeln, emotionalen Zuständen und Bewertungen, Handlungsplänen, Zielvorstellungen, deskriptiven und präskriptiven Regeln und subjektiven Bedeutungen, aber auch die persönlichen Überzeugungen, Bewertungen, Glaubenssätze und Wertvorstellungen werden in die Bezeichnung hineingelegt. Dieses Bündel an Bedeutung nenne ich affekt-kognitve Schemata.
Hinter jedem bezeichneten Unterschied verbirgt sich eine lose assoziativer Mind-map von unterschiedlichsten Bedeutungen und Zuschreibungen. Die Verbindung und Vernetzung der Bezeichnungen, Bedeutungen und Zuschreibungen wird in affekt-kognitiven Schemata zusammengefasst. Die interne Vernetzung erfolgt durch das Medium Sinn, indem Sinn auf das aktuell Mögliche verweist. Sinn verweist auf alle möglichen Anschlussoperationen an eine vorherigen Operation.
Hinter dem affekt-kognitiven Schemata der Katze kann folgende lose Assoziationskette von Bedeutungen stehen: vier Beine, Säugetier, nützlich, niedlich, verliert viele Haare, Schmusen, wenig Arbeit, weil man nicht Gassi gehen muss…..Man könnte diese Reihe von Assoziationen noch endlos fortsetzen. Wie weit und wie groß die einzelnen Assoziationsketten im Bedeutungsmuster ausgearbeitet sind, hängt von der Selbstorganisation eines jeden psychischen Systems ab und bestimmt deren Differenziertheit. Je weniger Bedeutungen in einzelnen affekt-kognitiven Schemata hinterlegt sind und je weniger affekt-kognitive Schemata aufgebaut worden sind, umso undifferenzierter ist das psychische System. Dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt: Je mehr Bedeutungen in einzelnen affekt-kognitiven Schemata hinterlegt sind und je mehr affekt-kognitive Schemata aufgebaut worden sind, umso differenzierter ist das psychische System.
Die affekt-kognitiven Schemata des psychischen Systems entstehen in und durch die Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt, so dass die Entwicklung der inneren Landkarte an das Bestehen einer Umwelt gebunden ist. Diese Verbindungen zur Umwelt werden über strukturelle Kopplungen hergestellt. Die affekt-kognitiven Schemata bilden die Basis der Wirklichkeitskonstruktionen. Die Wirklichkeitskonstruktionen werden aus den affekt-kognitiven Schemata zusammengefügt und reproduziert.
Die oben beschriebene innere Landkarte kann man sich als eine mit affekt-kognitiven Schemata überzogene Fläche vorstellen, wobei es Täler und Berge mit unterschiedlichem Höhenausmaßen gibt. Die affekt-kognitiven Schemata sind thematisch unterschieden. Es gibt einfache Schemata, in der eine Bezeichnung wie das Wort Kuh mit Bedeutungen versehen werden. Es gibt abstrakte affekt-kognitive Schemata zu Fragen des Glaubens, der Liebe oder inneren Einstellungen zu den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Themen, angefangen von dem richtigen Umgang mit dem Problem der Arbeitslosigkeit bis hin zum Thema Klimaveränderung usw. In den Tälern oder auf den Berggipfeln liegen bildlich gesprochen die affekt-kognitiven Schemata. Sie fungieren dort als Attraktor für eingehende Informationen. Jeder Attraktor besitzt ein Einzugsgebiet, so dass sich die Informationen zu diesen affekt-kognitiven Schemata hinbewegen und dort entsprechend andocken und verarbeitet werden können (vgl. Strunk/ Schiepek 2006, S. 108-109). Die affekt-kognitiven Schemata auf der inneren Landkarte sind untereinander mit hunderttausenden anderen affekt-kognitiven Schemata vernetzt, so dass jede Information mit einer hohen Geschwindigkeit verarbeitet werden kann. Die assoziativen Netzwerke auf der inneren Landkarte eignen sich daher hervorragend für die komplexen Aufgaben, die ihnen im Rahmen von parallel verlaufenden Informationsverarbeitungsprozessen abverlangt werden. Was beim Computer vor Jahren als Riesenerfolg gewertet wurde, nämlich die Fähigkeit mehrere Aufgaben zeitgleich auszuführen, ist für das psychische System und vor allem für das bio-psycho-soziale System Mensch eine Grundvoraussetzung, um mit der komplexen Bewältigung von Lebensaufgaben und den Anforderungen der Umwelt fertigzuwerden. So koordiniert und verarbeitet der Mensch zeitgleich verschiedenste parallele Informationsprozesse, wie z.B. die Konstruktion der Wirklichkeit, die Verarbeitung von Sinneseindrücken und die Koordination von Körperbewegungen. Zeitgleich unterhalten wir uns mit einem Gesprächspartner und überlegen dazu noch, was wir unserer Frau zum Geburtstag schenken wollen. Daneben laufen noch all die unbewussten Prozesse im biologischen System, angefangen von der Ausschüttung von Neurotransmittern zur Weiterleitung von Nervenimpulsen bis hin zur Regulierung der Körpertemperatur, ab.
Die innere Landkarte darf man sich nicht statisch vorstellen. Sie ist im höchsten Maße flexibel und in ihrer Entwicklung dynamisch, da sie neues Wissen, neue Erfahrungen, neue Informationen und neue Überlegungen beständig in die bestehenden affekt-kognitive Schemata integriert, neue affekt-kognitive Schemata schafft oder bestehende Schemata verändern müssen. Diese Neuintegration der Informationen kann dann eine völlige Neukonfiguration des Netzwerkes der affekt-kognitiven Schemata zur Folge haben. Es werden neue Beziehungen und Verbindungen geknüpft und andere werden gelöst. Aus Tälern werden Berge und Berge werden zu Tälern. Die Landschaft wandelt sich im Laufe der Zeit, sowie sich die Bedeutungsmuster verändern und affekt-kognitive Schemata mit neuen Teilinhalten versehen werden.
Die innere Landkarte, die mit thematisch vernetzten affekt-kognitiven Schemata gefüllt ist, kann sich durch die strukturelle Kopplung an relevante nähere Umwelten entwickeln und weiter ausdifferenzieren.
Wie werden Informationen im psychischen System generiert sowie verarbeitet und dann als Basis für ein Abbild der Wirklichkeit genutzt?
Das psychische System ist in der Lage Informationen selbst zu generieren, wie es dies z.B. beim Reflektieren über ein bestimmtes Thema vollzieht. Durch strukturelle Kopplungen mit der Umwelt ist das psychische System in der Lage, Außenreize wahrzunehmen und diese Fremdreferenz anderer Systeme in die eigene Informationsverarbeitung aufzunehmen. Dies geschieht durch die Beobachtung und Errechnung der veränderten Zustände an den Nervenzellen und deren Transformation in gedankliche Informationen. Die Fremdreferenzen führen neue Informationen oder neue Anschlussmöglichkeiten in die internen autopoietischen Operationsketten mit ein. Fremdreferenz löst sich dann in der Selbstreferenz der autopoietischen Prozesse und Strukturen auf. Ihr Erbe kann die Veränderung von affekt-kognitiven Schemata oder von autopoietischen Prozessen und Strukturen sein.
Die Transformation der beobachteten Zustände der Nervenzellen in gedankliche Informationen geschieht durch einen Vergleich der wahrgenommenen Zustände der Nervenzellen mit neuronal abgespeicherten Informationen und die dazugehörigen Bedeutungsmuster. Der Außenreiz/ der beobachtbare Zustand, der zu einem affekt-kognitiven Schema passt, wird zu einer Information transformiert und mit den Bedeutungen und Emotionen aus dem Schema unterlegt. Wir sehen einen Hund, einen Rotweiler, und dann könnte folgendes im Rahmen der Informationsverarbeitung ablaufen: Der Hund gehört zu den Säugetieren und die Rasse ist der Rottweiler. Rottweiler sind gefährlich und dieser ist besonders groß. Ich bin schon mal gebissen worden. Ich mag große Hunde daher nicht und schon gar nicht schwarze. Ich habe Angst vor ihnen usw.
Anhand des affekt-kognitiven Schemata wird deutlich, dass die generierte Information für den weiteren Entscheidungsprozess, welches Verhalten auf den herannahenden Hund gezeigt wird, eine wichtige Weichenstellung vornimmt: in diesem Fall bleibt der Beobachter des Rottweilers stehen und rührt sich nicht, bis der Hund mit seinem Besitzer vorbeigegangen ist. Auch andere Reaktionen sind selbstverständlich vorstellbar, wie z.B. das Wechseln der Straßenseite, das Vermeiden des Blickkontakts zum Hund oder das sture Weiterlaufen, weil man durch einen Hundetrainer erfahren hat, dass dies die beste Reaktion zur Vermeidung einer bedrohlichen Situation bei Hunden ist.
Die Generierung der Information und die Aktivierung von affekt-kognitiven Schemata sind entscheidend für die Weiterverarbeitung der Information, so dass am Ende des Verarbeitungsprozesses eine Output-Leistung (Gedanken, Gefühle, Handlungen und Kommunikationen) generiert werden kann.
Die innere Landkarte, bestehend aus affekt-kognitiven Schemata, ist darauf angewiesen, dass deren Inhalte abgespeichert sind und für eine spätere Rekonstruktion wieder zur Verfügung stehen können. Dabei funktioniert das Erinnern nicht als Abrufen exakt gespeicherter Informationen, sondern ist als aktive Rekonstruktion zu verstehen. Ankerinformationen bzw. Ankerreize lösen die Rekonstruktion der affekt-kognitiven Schemata aus und erfinden die dazu passenden anderen Informationen neu. Erinnern stellt einen kreativen und assoziativen Akt dar. Dies erklärt den Umstand, dass wir niemals in der Lage sind, eine Begebenheit aus der Vergangenheit völlig identisch zu erinnern, sondern immer werden kleinste Abänderungen in die Erinnerung einfließen. Der Mensch kann sich durch kleinste Wissensbruchstücke oder Episoden an die Vergangenheit erinnern und erfindet zu den Hinweisen die fehlenden Mosaikstücke für das passende Bild. Die Codierung der abgespeicherten Informationen geschieht in Form nicht-linearer assoziativer Muster, ähnlich wie eine Festplatte, die eine Datei durch die beständige Benutzung und Neubeschreibung an verschiedenen Orten auf der Festplatte hinterlegt und diese Orte mit Hinweisen vernetzt.
Das Gedächtnis kann man grob schematisch in drei Teile unterteilen; einen sensorischen Informationsspeicher, eine Kurzzeit- und Arbeitsspeicher sowie einen sekundären und tertiären Langzeitspeicher.
Der sensorische Informationsspeicher kann Sinnesdaten für den Bruchteil von Sekunden speichern, bis eine Mustererkennung und eine Auswahl von relevanten Merkmalen erfolgt ist sowie der Abgleich des Sinneseindruckes mit abgespeicherten Informationen und affekt-kognitiven Schemata stattgefunden hat.
Der Kurzzeit- und Arbeitsspeicher kann Informationen bis zu 30 Sekunden abspeichern, so dass zukünftige Gedächtnisinhalte eingeprägt und im Langzeitspeicher abgespeichert werden können. Zudem ist er für die Bereitstellung von Informationen in Vorstellungs- und Denkprozessen verantwortlich. Aufgrund der begrenzten Speicherkapazität werden Informationselemente bei komplexen Gedankenvorgängen zu Einheiten zusammengefasst. Der Kurzzeitspeicher kann Informationen symbolisch oder bildhaft speichern und für eine kognitive und emotionale Weiterverarbeitung zur Verfügung stellen.
Das sekundäre Langzeitgedächtnis ermöglicht die Speicherung von Informationen von Minuten bis Tagen, während das tertiäre Langzeitgedächtnis die unbegrenzte Speicherung von Wissen erlaubt. Im Langzeitspeicher liegen also unsere Wissensstrukturen und affekt-kognitiven Schemata auf der inneren Landkarte. Das Langzeitgedächtnis speichert die Informationen und die darunter liegenden kognitiven und emotionalen Bedeutungen assoziativ und netzwerkähnlich ab. So können mehrere Informationen auf ein und dasselbe affekt-kognitive Schema zurückgreifen, während genauso die Möglichkeit besteht, dass eine Information auf mehrere affekt-kognitive Schemata verteilt ist. In einem affekt-kognitiven Schema werden persönliche Erfahrungen, Wissen, Theorien, Erklärungen, präskriptiven und deskriptiven Regeln, Informationen, zugewiesenen Bedeutungen, emotionale Untermalung sowie unterschiedliche Handlungskonzepte und Handlungspläne abgelegt. Dabei kann ein affekt-kognitives Schema aus emotionalen Inhalten, Handlungskonzepten, prozeduralem Wissen und Fähigkeiten zur Lösung von Problemen und Konflikten bestehen. Die inhaltliche Füllung von affekt-kognitiven Schemata kann eng und weit sein und wird durch Selbstorganisationsprozesse im psychischen System beeinflusst. Das psychische System ist daher für seine autopoietische Struktur auf die Rekonstruktion von Gedächtnisinhalten in Form von Gedanken an Gedanken angewiesen (vgl. Resch u.a. 1999, S. 149ff).
Die innere Landkarte des psychischen Systems ist thematisch geordnet und untereinander vernetzt. So gibt es affekt-kognitive Schemata für Soziales, für Politik, für Problem- und Konfliktbewältigung, für strategisches Wissen, für Gesundheit, für Mathematik, für Literatur, für Physik und Biologie, für Sport und für die Selbstidentität. Es gibt aber auch ganz spezielle affekt-kognitive Schemata, die sich z.B. auf einen Begriff beziehen (z.B. Katze). Die gerade dargestellten affekt-kognitiven Schemata sind aber nur als Beispiele zu verstehen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da jeder Mensch unendlich viele und für sich individuelle affekt-kognitive Schemata aufbauen kann. Dennoch arbeitet die Vernetzung der affekt-kognitiven Schemata nach Themengebieten, unten denen sich dann die weitere Ausdifferenzierung der emotionalen und kognitiven Inhalte ausgestaltet. Es kommt zu einer thematischen Oberbegriffsbildung und darunter gruppieren sich dann weitere Inhalte, wie Emotionen, individuelle Bedeutungen, Handlungspläne und –konzepte, Strategien, Problemlösungen, Wissen, Erklärungen und spezielle Informationen.
Wie weiter oben schon beschrieben, ist die innere Landkarte einer immer währenden Veränderungsdynamik unterworfen, die eine beständige Aktualisierung der Schemata im Langzeitgedächtnis zur Folge hat. Diese Aktualisierung kann soweit gehen, dass Erinnerungen an die eigene Biographie neu konstruiert werden. Das psychische System kann seine Vergangenheit unter einer anderen Sichtweise sehen und interpretieren .
Für psychische Systeme bedeutet dies: Zum Aufbau ihrer internen Komplexität bildet sie affekt-kognitive Schemata aus. Diese werden netzwerkartig in einem rekursiven und zirkulären Kreis verknüpft. Sie bilden das Fundament aus dem das psychische System seine Wirklichkeit in einem kreativen Akt errechnet und konstruiert. Sie beschreiben damit seine Sicht auf die Welt und seinen Möglichkeitsspielraum. Psychische Systeme sind daher auf die Speicherung der affekt-kognitiven Schemata im Gedächtnis angewiesen. Das Gedächtnis stellt ein eigenes autopoietisches Subsystem des psychischen Systems dar und ist mit seiner Umwelt (z.B. Emotionssystem, kognitives System, motivationales System) strukturell gekoppelt. In den affekt-kognitiven Schemata sind unsere Fähigkeiten zu handeln und auf bestimmte Situationen zu reagieren in Form von Handlungsplänen und –konzepten gespeichert. Auf sie greift das psychische System bei der Generierung von Handlungen, Kommunikationen und Verhalten zurück.
2.2.9 Motivation
Psychische Systeme können Ziele, Bedürfnisse und Wünsche entwickeln. Sie sind der Kern dessen, was man psychologisch als Motivation bzw. als Antrieb für eine Handlung bezeichnen kann.
Das Motivationssystem bezeichnet ein Subsystem innerhalb des psychischen Systems, in welchem die Ziele, Attraktoren, Bedürfnisse und Wünsche eines jeden Menschen organisiert werden. Verhalten, so hat es schon Alfred Adler in seiner Individualpsychologie beschrieben, ist immer zielgerichtet und damit sinnvoll (vgl. Rattner 1974). Systemtheoretisch gesprochen gibt es kein Verhalten ohne eine individuelle Sinnbedeutung und -gebung. Eine Kommunikation mag für andere Beobachter sinnlos erscheinen (z.B. ein Mensch verweigert das Sprechen), dennoch generiert das Verhalten seinen Sinn aus den eigenen, im Motivationssystem hinterlegten, Bedürfnissen, Sinngebungen, Wünschen und Zielen. Jeder Mensch wählt seine Kommunikationen aus und verknüpft sie mit seinem individuellen und subjektiven Sinn. Sinn ist das Bindeglied zwischen den Anschlüssen gedanklicher oder kommunikativer Operationen. Sinn verweist auf das aktuell Mögliche und auf weitere andere mögliche Operationsanschlüsse. Sinn zwingt damit zur Selektion zwischen Anschlussmöglichkeiten. Eine Möglichkeit wird ausgewählt und realisiert, aber gleichzeitig produziert der Sinn auch all die anderen Möglichkeiten von Anschlüssen mit (die rechte Seite der binären Logik: all die Möglichkeiten des bisher Nichtunterschiedenen).
Was sinnvoll für das psychische System ist, entscheidet das psychische System selbst, auch wenn es aus den Augen eines Beobachters sinnlos erscheint.
Im Motivationssystem sind die Bedürfnisse, Ziele und Wünsche des psychischen Systems organisiert und hinterlegt. Daraus werden die Ziele eines psychischen Systems generiert sowie unbewusst oder bewusst ausformuliert und verfolgt. Ziele werden zu handlungsleitenden Orientierungsleitlinien in der Generierung des gedanklichen oder kommunikativen Outputs und in der Weiterentwicklung der Selbstorganisation des gesamten psychischen Systems (vgl. Resch u.a. 1999, S. 157ff.). Sie korrelieren damit eng mit dem Subsystem der affekt-kognitiven Schemata wie ich sie oben beschrieben haben. Sie geben die Richtung der Entwicklung eines psychischen Systems vor und sie aktivieren Energien und Ressourcen zu deren Erreichung. Insofern wirken sich Ziele, als ausformulierte Bedürfnisse und Wünsche, auf die Energetisierung menschlichen Verhaltens aus. Ziele beeinflussen Einsatzbereitschaft und fördern die Bereitschaft zur Anstrengung. Das psychische System strengt sich an, die notwendigen Kompetenzen für die Zielerreichung bereitzustellen, was auch die Kompetenzerweiterung in Form von Lernprozessen beinhaltet. Das psychische System versucht sich dem selbst gesteckten Ziel anzunähern und es zu erreichen. Ziele sind die Richtungsschilder in einem dynamischen, chaotischen und selbstreferentiellen Entwicklungsprozess sowie in der Generierung von Verhalten durch das Zusammenwirken einer Vielzahl an unterschiedlichen Subsystemen im psychischen System.
Bisher habe ich ausschließlich von der intrinsischen Motivation gesprochen. Dabei gibt es auch Ziele und Motivationsfaktoren außerhalb des psychischen Systems, welche motivationsfördernd wirken können (z.B. Ziele im sozialen System). Dies kann die Gunst eines anderen Menschen, aber auch die Erhöhung des Gehaltes für die Erbringung einer höherqualifizierten Arbeitsleistung sein. Hier spricht man von extrinsischer Motivation. Wenn man sich die Theorie der autopoietischen Systeme oder der nichtlinearen dynamischen Systeme vor Augen führt, dann ist das Konstrukt einer extrinsischen Motivation nur zu erklären, wenn man von einer Überführung des extrinsischen Attraktors in einen intrinsischen ausgeht. Der externe Anreiz einer höheren Entgeltung als Ansporn für eine erhöhte und produktivere Arbeitsleistung kann nur funktionieren, wenn das Motivationssystem des psychischen Systems diesen externen Anreiz als internen übernimmt, es also für das psychische System erstrebenswert ist, mehr Geld zu verdienen. Durch diesen Übergang kann erklärt werden, warum ein und derselbe äußere Attraktor sich für ein psychischen System motivationsfördernd auswirkt, während ein anderes System beim gleichen äußeren Attraktor keine Veränderung seiner Ziele, Motivationen und Verhaltensweisen erkennen lässt. Systemtheoretisch formuliert: Das psychische System nutzt seine strukturellen Kopplungen zur näheren Umwelt und seine Fähigkeit zur Fremdreferenz, um einen externen Attraktor in die eigenen autopoietische Prozesse und Strukturen einzubauen und aus ihm einen intrinsischen Attraktor zu machen. Aus der Fremdreferenz wird Selbstreferenz, sprich die eingeführten Veränderung wird nun fortwährend aus den Elementen des Systems selbst reproduziert.
Ziele wirken aber nicht nur als Handlungsleitlinien und Orientierungspunkte, sie helfen auch bei der Koordination und Ausrichtung der verschiedenen Subsysteme des psychischen Systems. Denn Ziele aktivieren eine Vielzahl an unterschiedlichen Elementen, um das Verhalten so zu generieren, dass das angestrebte Ziel erreicht wird. Ziele koordinieren dabei die Outputleistungen des emotionalen, des kognitiven und des neuronalen Systems. Die gedanklichen und kommunikativen Outputleistungen werden in den Dienst der Zielerreichung gestellt und vereinigen sich in der Generierung des Verhaltens des psychischen Systems. Ziele können sich daher leistungssteigernd auswirken, wenn die Gesamtkoordination aller Subsysteme des psychischen Systems im Sinne des Zieles gelingt.
Gleichwohl haben Ziele Rückwirkungen auf das Selbstbild und die Identität des Systems, aber auch auf die innere Landkarte, da sie diese im Sinne des Zieles dauerhaft verändern können. Ziele wirken selektiv auf unsere Wahrnehmung ein. Sie schärfen die Wahrnehmung für den Korridor der anvisierten Ziele. So kennen wir das Phänomen, das wir bei einem geplanten Kauf einer bestimmten Automarke (Ziel) dann genau diese Automarke vermehrt im Straßenverkehr wahrnehmen. Ziele verursachen eine Fokussierung der Wahrnehmung.
2.2.10 Selbstidentität