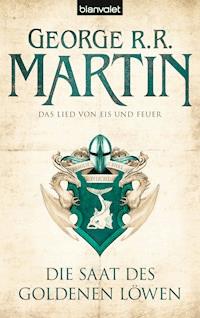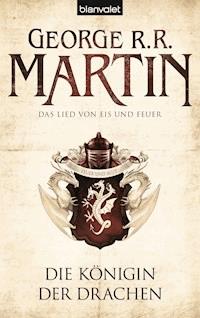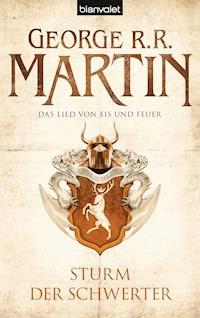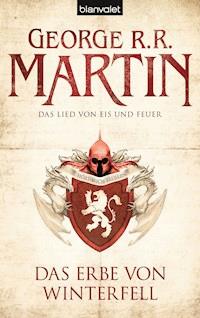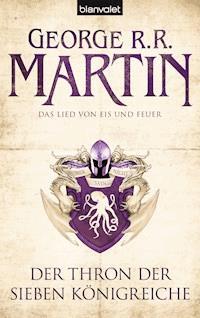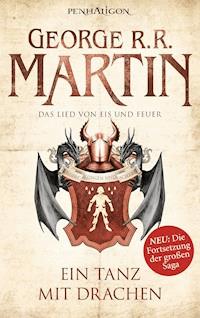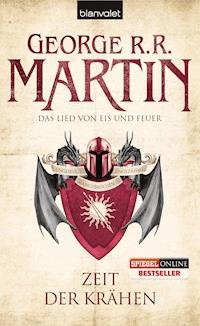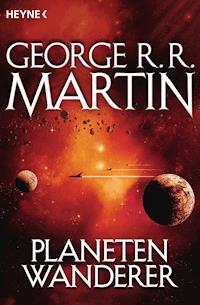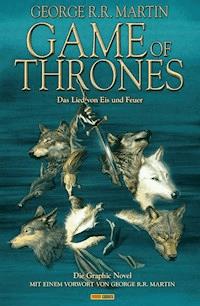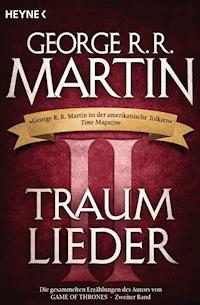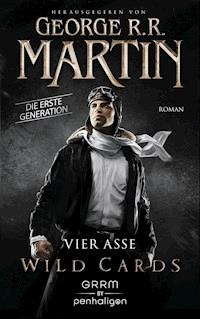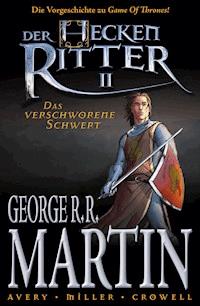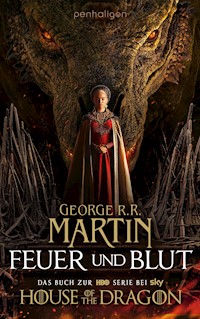6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Ab 10 Euro
- Sprache: Deutsch
Gefährliche Frauen aller Art – Kriegerinnen, Königinnen, Zauberinnen und viele mehr – sind das Thema dieser spannenden Anthologie. Sie enthält 21 bislang unveröffentlichte Erzählungen von Bestsellerautoren wie Joe Abercrombie, Brandon Sanderson und Diana Gabaldon – die eine brandneue Outlander-Story beisteuert. Kernstück und Höhepunkt dieser Sammlung ist ein Kurzroman aus der Feder von George R.R. Martin über den »Tanz der Drachen«, jenen großen Bürgerkrieg, an dem der Kontinent Westeros zweihundert Jahre vor den Ereignissen in der Saga Das Lied von Eis und Feuer beinahe zerbrochen wäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1520
Veröffentlichungsjahr: 2015
Sammlungen
Ähnliche
George R. R. Martin & Gardner Dozois
präsentieren
Königin im Exil
und 20 weitere Kurzromane
Übersetzt von Andreas Helweg, Karin König, Barbara Schnell und Wolfgang Thon
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »Dangerous Women« bei Tor Books, New York.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2015
bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © by George R. R. Martin & Gardner Dozois
Published by agreement with the author and author’s agents, Lotts Agency, Ltd.
Copyright der einzelnen Romane: siehe am Ende des Buches
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by Blanvalet Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz, Inkcraft
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-15838-5www.blanvalet.de
INHALT
EINFÜHRUNG VON GARDNER DOZOIS
JOE ABERCROMBIE
WELCH EIN DESPERADO!
MEGAN ABBOTT
ENTWEDER IST MEIN HERZ GEBROCHEN
CECELIA HOLLAND
NORAS LIED
MELINDA SNODGRASS
DIE HÄNDE, DIE NICHT DA SIND
JIM BUTCHER
BOMBIGE MUSCHELN
CARRIE VAUGHN
RAISA STEPANOWA
JOE R. LANSDALE
RINGEN MIT JESUS
MEGAN LINDHOLM
NACHBARN
LAWRENCE BLOCK
ICH WEISS, WIE MAN SIE RAUSPICKT
BRANDON SANDERSON
SCHATTEN FÜR STILLE IN DEN WALDUNGEN DER HÖLLE
SHARON KAY PENMAN
KÖNIGIN IM EXIL
LEV GROSSMAN
DAS MÄDCHEN IM SPIEGEL
NANCY KRESS
ZWEITE ARABESQUE, SEHR LANGSAM
DIANA ROWLAND
STADTLAZARUS
DIANA GABALDON
UNSCHULDSENGEL
SHERRILYN KENYON
DIE HÖLLE KENNT KEINEN ZORN
S. M. STIRLING
VERKÜNDER DER STRAFE
SAM SYKES
BENENNE DIE BESTIE
PAT CADIGAN
KÜMMERER
CAROLINE SPECTOR
LÜGEN, DIE MEINE MUTTER MIR ERZÄHLT HAT
GEORGE R. R. MARTIN
DIE PRINZESSIN UND DIE KÖNIGINODERDIE SCHWARZEN UND DIE GRÜNEN
COPYRIGHT
EINFÜHRUNG VON GARDNER DOZOIS
Übersetzt von Wolfgang Thon
Die Belletristik war immer schon geteilter Ansicht, wie gefährlich Frauen wirklich sind.
In der realen Welt ist diese Frage natürlich längst geklärt. Selbst wenn Amazonen mythische Wesen sind (und wenn sie es nicht wären, hätten sie sich höchstwahrscheinlich nicht die rechte Brust amputiert, um ihren Bogen leichter spannen zu können), wurden die Legenden um sie von den wilden Kriegerinnen der Skythen inspiriert, die ganz sicher keine mythologischen Wesen waren. Gladiatorinnen fochten in den Arenen des antiken Roms bis zum Tod gegen andere Frauen – und manchmal auch gegen Männer. Es gab weibliche Piraten wie Anne Bonny und Mary Read und sogar weibliche Samurai. Frauen dienten im Zweiten Weltkrieg in der russischen Armee an der Front und waren ob ihrer Wildheit gefürchtet. In Israel tun sie das heute noch. Bis zum Jahr 2013 war für Frauen der Dienst in der Armee der US-Streitkräfte auf Funktionen beschränkt, in denen sie nicht an Kampfhandlungen teilnehmen konnten. Trotzdem haben viele tapfere Frauen in Irak und Afghanistan ihr Leben gelassen, da sich weder Kugeln noch Landminen je darum gekümmert haben, ob man Zivilist ist oder nicht. Frauen, die für die Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs als Pilotinnen dienten, durften ebenfalls nicht aktiv an Kampfhandlungen teilnehmen. Trotzdem wurden viele von ihnen während der Ausübung ihrer Pflicht getötet. Russische Frauen dagegen griffen als Kampfpilotinnen in das Geschehen ein und wurden manchmal sogar Fliegerasse. Eine russische Scharfschützin bekam während des Zweiten Weltkriegs mehr als fünfzig Abschüsse zugeschrieben. Königin Boudicca vom Stamm der Icener führte eine der furchteinflößendsten Revolten gegen das Römische Imperium an, die es je gegeben hatte, und es wäre ihr beinahe gelungen, die römischen Invasoren aus Britannien zu vertreiben. Ein junges französisches Bauernmädchen inspirierte die französischen Truppen und führte sie so erfolgreich gegen den Feind, dass sie ewigen Ruhm erntete und als Jeanne d’Arc, Jungfrau von Orleans, unsterblich wurde.
Auf der dunklen Seite gab es weibliche Straßenräuber wie zum Beispiel Mary Frith, Lady Katherine Ferrers und Pearl Hart. Letztere war die letzte Person, die jemals eine Postkutsche ausraubte. Dazu gesellten sich berüchtigte Giftmörderinnen wie Agrippina und Caterina de’ Medici, moderne weibliche Verbrecherinnen wie Ma Barker und Bonnie Parker und sogar Serienmörderinnen wie Aileen Wuornos. Elizabeth Báthory soll angeblich im Blut von Jungfrauen gebadet haben, und selbst wenn das mittlerweile fraglich scheint, besteht kein Zweifel daran, dass sie in ihrem Leben Dutzende, vielleicht sogar Hunderte von Kindern gefoltert und ermordet hat. Königin Maria I. von England hat Hunderte von Protestanten auf dem Scheiterhaufen verbrennen lassen; Königin Elizabeth von England hat das später mit der Hinrichtung einer großen Zahl von Katholiken vergolten. Die wahnsinnige Königin Ranavalona von Madagaskar hat so viele Leute mit dem Tod bestraft, dass sie während ihrer Regentschaft fast ein Drittel der gesamten Bevölkerung Madagaskars auslöschte. Sie ließ Leute exekutieren, nur weil sie ihr im Traum erschienen waren.
Unterhaltungsliteratur hatte jedoch schon immer einen sehr schizophrenen Blick auf die Gefährlichkeit von Frauen. In den Science-Fiction-Romanen der dreißiger, vierziger und fünfziger Jahre war die Rolle von Frauen, falls sie überhaupt auftauchten, im Allgemeinen auf die Person der wunderschönen Tochter des Wissenschaftlers beschränkt, die während der Kampfszenen möglicherweise kreischte, aber ansonsten wenig mehr zu tun hatte, als anschließend schmachtend am Arm des Helden zu hängen. Legionen von Frauen schwanden vor Hilflosigkeit die Sinne, während sie darauf warteten, von dem unerschrockenen Helden mit seinem kantigen Kinn vor allem Möglichen gerettet zu werden, angefangen bei Drachen bis hin zu glupschäugigen Monstern, die sie immer, zumindest wenn man den Covern der Trivial-SF-Magazine glauben durfte, für höchst unersprießliche Zwecke wegzuschleppen trachteten, sei es um den Speiseplan zu bereichern oder für romantischere Zwecke. Hoffnungslos zappelnde Frauen wurden an Bahngleise gefesselt, ohne dass ihnen etwas anderes übrig blieb, als quiekend zu protestieren und darauf zu hoffen, dass der Gute rechtzeitig auftauchte, um sie zu retten.
Gleichzeitig jedoch konnten Kriegerinnen wie Edgar Rice Burroughs’ Dejah Toris und Thuvia, das Mädchen vom Mars, ebenso gut mit der Klinge umgehen und waren ebenso tödlich im Kampf wie John Carter und ihre anderen männlichen Kameraden. Weibliche Abenteurerinnen wie C. L. Moores Jirel von Joiry bahnten sich tollkühn den Weg durch die Seiten von Weird-Tales-Magazinen und schlugen dabei eine Bresche für spätere weibliche Draufgängerinnen wie zum Beispiel Joanna Russ’ Alyx. James H. Schmitz schickte Agenten der Vega wie Granny Wannatel und furchtlose Teenager wie Telzey Amberdon und Trigger Argee in die Schlacht gegen finstere Bedrohungen und Monster aus dem Weltall. Robert A. Heinleins gefährliche Frauen waren durchaus fähig, als Kapitän eines Raumschiffes zu dienen, und vermochten Feinde im Nahkampf zu erledigen. Sir Arthur Conan Doyles schlaue und düstere Irene Adler war eine der ganz wenigen Personen, die Sherlock Holmes jemals übertölpeln konnten, und wahrscheinlich eine Quelle der Inspiration für die Legionen von raffinierten, gefährlichen, verführerischen und hinterhältigen Femmes fatales, die in den Werken von Dashiell Hammett und James M. Cain auftauchten und später zu Dutzenden im Film noir reüssierten. Sie sind bis heute in Filmen und Fernsehproduktionen zu sehen. Spätere TV-Heldinnen wie Buffy, die Vampirjägerin und Xena, die Kriegerprinzessin etablierten die Wahrnehmung der Frau als furchteinflößend und tödlich genug, um Horden von fürchterlichen, übernatürlichen Bedrohungen zu bekämpfen, und halfen bei der Entstehung des Subgenres der paranormalen Romanze, was inoffiziell manchmal auch »Kick Ass Heroine«-Genre genannt wird.
Da unsere Anthologie Königin im Exil als genreübergreifende Anthologie verstanden wird, eine, in der sich alle Arten von Fiktion versammeln, haben wir Schreiber, Frauen und Männer, aus jedem Genre, der Science-Fiction, der Fantasy, dem Krimi, historischen Romanen, Horror, Paranormal Romance, gebeten, das Thema »Gefährliche Frauen« anzugehen. Unser Ruf wurde von den besten Schreibern erhört, sowohl von Neulingen als auch von Titanen auf ihrem Gebiet, wie zum Beispiel Diana Gabaldon, Jim Butcher, Sharon Kay Penman, Joe Abercrombie, Carrie Vaughn, Joe R. Lansdale, Lawrence Block, Cecelia Holland, Brandon Sanderson, Sherilynn Kenyon, S. M. Stirling, Nancy Kress und George R. R. Martin.
Sie werden hier keine hilflosen Opfer finden, die furchtsam wimmernd zusehen, wie der männliche Held die Monster bekämpft oder mit dem Bösewicht die Klingen kreuzt; falls Sie diese Frauen an Straßenbahnschienen ketten wollen, dürfen Sie sich auf einen erbitterten Kampf gefasst machen. Stattdessen finden Sie hier schwertschwingende Kriegerinnen, unerschrockene Kampfpilotinnen und weitgereiste Raumfahrerinnen, tödliche Serienmörderinnen, furchteinflößende Superheldinnen, raffinierte und verführerische Femmes fatales und Zauberinnen, ausgekochte böse Mädchen, weibliche Banditen und Rebellinnen, kampfbereite weibliche Überlebende postapokalyptischer Zukünfte, Privatdetektivinnen, strenge, gnadenlose Richterinnen, hochmütige Königinnen, die Nationen regieren und deren Eifersucht und Ehrgeiz Tausende in einen grauenvollen Tod schicken, wagemutige Drachenreiterinnen und noch viele mehr.
Viel Vergnügen!
JOE ABERCROMBIE
Wie die spannende, schnelle und actiongeladene Geschichte, die jetzt folgt, demonstriert, kann die Verfolgung eines Flüchtigen manchmal für die Jäger ebenso gefährlich sein wie für die Gejagte – vor allem, wenn die Beute mit dem Rücken an der Wand steht …
Joe Abercrombie ist einer der leuchtenden Sterne der zeitgenössischen Fantasy. Er wird von Lesern und Kritikern gleichermaßen für seine harte und nüchterne Herangehensweise an das Genre gelobt und ist vor allem durch seine Klingen-Trilogie bekannt geworden. Der erste Roman Kriegsklingen wurde im Jahr 2006 veröffentlicht; ihm folgten in den nächsten Jahren Feuerklingen und Königsklingen. Er hat auch die beiden Einzeltitel Racheklingen und Heldenklingen geschrieben. Sein neuester Roman ist Blutklingen. Außer als Schriftsteller arbeitet Abercrombie auch als freiberuflicher Filmcutter und lebt und wirkt in London.
WELCH EIN DESPERADO!
Übersetzt von Wolfgang Thon
Shy rammte dem Pferd die Hacken in die Flanke. Die Vorderläufe des Tieres gaben nach, und bevor sie auch nur wusste, wie ihr geschah, hatte sich ihr Sattel von ihr verabschiedet.
Ihr wurde ein kurzer, armrudernder luftiger Moment gewährt, um die Lage zu sondieren. Nur war sie nicht sonderlich gut darin, irgendetwas auf die Schnelle einzuschätzen, und die ihr entgegensausende Erde ließ ihr keine Zeit für eine genauere Prüfung. Sie versuchte so gut wie möglich, sich nach der Landung abzurollen, wie sie es bei den meisten ihrer Missgeschicke versucht hatte, aber der Boden spielte nicht mit; er entrollte sie, klopfte sie ordentlich durch und schleuderte sie dann Hals über Kopf in einen von der Sonne ausgedörrten Busch.
Langsam legte sich der Staub.
Sie nahm sich einen Moment Zeit, um Atem zu schöpfen. Dann einen zweiten, um zu stöhnen, als die Welt aufhörte, sich um sie herum zu drehen. Und noch einen, in dem sie vorsichtig einen Arm und ein Bein bewegte und auf den ekelerregenden Schmerz wartete, der ihr sagen würde, dass etwas gebrochen und der erbärmliche Abklatsch ihres Lebens zu Staub zerronnen war. Sie hätte diese Information begrüßt, wenn sie sich dann einfach hätte ausstrecken und aufhören können wegzulaufen. Doch der Schmerz kam nicht. Jedenfalls überstieg er nicht den gewohnten Rahmen. Was ihr elendes Leben anging, erwartete sie also weiterhin den Urteilsspruch.
Shy rappelte sich hoch, zerkratzt, zerschlagen, vollkommen staubbedeckt, und spuckte Sandkörner aus. Sie hatte in den letzten Monaten viel zu viel Dreck geschluckt, aber ihr schwante, dass das noch nicht alles gewesen war. Ihr Pferd lag ein paar Schritte von ihr entfernt. Die schweißbedeckte Flanke des Tieres hob und senkte sich bebend, und seine Vorderläufe waren schwarz von Blut. Nearys Pfeil hatte es in die Schulter getroffen, war jedoch nicht tief genug eingedrungen, um das Pferd zu töten oder es merklich zu verlangsamen. Aber er saß so tief, dass es ständig Blut verlor. So hart wie sie geritten war, hatte sie das Tier ebenso sicher getötet, als wäre ihm der Pfeil ins Herz gedrungen.
Früher einmal hatte Shy Pferde gemocht. Damals war sie ungewöhnlich liebevoll zu Tieren gewesen, obwohl sie Menschen oft abweisend behandelt hatte, meistens zu Recht. Das war schon lange her. Jetzt hatte Shy nichts Liebevolles mehr an sich und nichts Weiches, weder am Körper noch im Kopf. Also überließ sie das Tier seinen letzten, von rotem Schaum begleiteten Atemzügen, ohne es tröstend zu streicheln, und machte sich auf den Weg in die Stadt. Zuerst trottete sie nur, aber schon bald gefiel ihr diese körperliche Anstrengung. Was Laufen anging, hatte sie einen ganzen Haufen Übung.
»Stadt« war eine Übertreibung. Der Ort bestand aus sechs Gebäuden, wobei für zwei oder drei die Bezeichnung »Gebäude« äußerst wohlwollend war. Sie bestanden aus unbehauenem Holz, ein rechter Winkel war offenbar ein Fremdwort, sie waren von der Sonne verbrannt, vom Regen ausgebleicht und verstaubt. Sie scharten sich um einen schmutzigen Platz und einen Brunnen, dessen steinerne Fassung zerbröckelte.
Das größte Gebäude sah aus wie ein Saloon, ein Bordell oder eine Handelsniederlassung und war wahrscheinlich alles drei gleichzeitig. Ein wackeliges Schild klammerte sich an die Bretter über dem Eingang, aber der Wind und der Sand hatten den Namen darauf zu ein paar grauen Streifen auf der Maserung des Holzes abgeschliffen. Nichts und nirgendwo, war alles, was es jetzt noch verkündete. Sie lief die Treppe hoch, nahm zwei Stufen auf einmal. Die alten Bretter ächzten unter ihren nackten Füßen. Ihre Gedanken überschlugen sich, als sie überlegte, was sie tun würde, sobald sie drin war, mit welchen Lügen sie die Wahrheit würzen musste, um das glaubwürdigste Rezept zusammenzuköcheln.
Ich werde von Männern gejagt! Sie rang nach Luft, als sie in der Tür stand, und gab sich Mühe, vollkommen verzweifelt auszusehen. Was ihr im Augenblick nicht sonderlich schwerfiel; genau genommen war es in keinem Moment der letzten zwölf Monate schwierig gewesen.
Diese Mistkerle sind zu dritt! Dann weiter, vorausgesetzt niemand erkannte sie aufgrund ihrer vielen Steckbriefe: Sie haben versucht, mich auszurauben! Das war eine Tatsache. Unnötig hinzuzufügen, dass sie das Geld selbst der neuen Bank in Hommenaw geraubt hatte, und zwar in Begleitung ebendieser drei ehrenwerten Herrschaften sowie eines Vierten, der allerdings von den zuständigen Behörden erwischt worden war und mittlerweile längst am Galgen baumelte.
Sie haben meinen Bruder ermordet! Sie sind im Blutrausch! Ihr Bruder saß sicher zu Hause, wo sie auch gerne gewesen wäre, und wenn ihre Verfolger trunken waren, dann höchstwahrscheinlich von billigem Fusel, wie gewöhnlich. Aber sie würde all das mit diesem kleinen Triller in ihrer Kehle herausschreien. Shy konnte sehr gut trällern, wenn es sein musste. Sie hatte es geübt. Sie stellte sich vor, wie die Stammgäste aufsprangen, bemüht, einer Frau in Not zu Hilfe zu eilen. Sie haben mein Pferd erschossen! Sie musste einräumen, wie wenig wahrscheinlich es war, dass jemand, der hier draußen leben wollte, deshalb vor lauter Ritterlichkeit ins Schwitzen kam, aber vielleicht würde ihr das Schicksal dieses eine Mal gnädig gestimmt sein.
So etwas kam doch sicher hin und wieder vor …
Sie trat durch die Schwingtür des Saloons und öffnete den Mund, um mit ihrer Geschichte loszulegen, blieb dann aber wie angewurzelt stehen.
Der Laden war leer.
Was nicht hieß, es war einfach nur niemand anwesend, sondern es war gar nichts da. In dem gesamten Schankraum befand sich nicht das kleinste Möbelstück. Eine schmale Treppe führte an der Wand links von ihr zu einer Galerie hoch, auf der leere Türöffnungen gähnten. Überall funkelte Licht, wo die aufgehende Sonne ihre Strahlen durch die vielen Löcher in dem schlecht gezimmerten Dach bohrte. Möglicherweise lief immerhin eine Echse durch die allgegenwärtigen Schatten, und alles war von einer dicken Staubschicht bedeckt, die sämtliche Oberflächen grau färbte und sich in jeder Ecke häufte. Shy stand einen Moment da und blinzelte, dann stürmte sie zurück, die baufällige Veranda entlang zum nächsten Gebäude. Als sie die Tür aufstieß, fiel sie von ihren rostigen Angeln.
Dieses Haus hatte nicht einmal ein Dach oder einen Boden. Nur blanke Dachbalken, zwischen denen der gleichgültige, rosafarbene Himmel schimmerte, und kahle Bodendielen mit einer staubigen Fläche dazwischen, die ebenso trostlos aussah wie die endlosen Meilen Staub draußen.
Als sie wieder auf die Straße trat und ihr Blick nicht mehr von Hoffnung getrübt war, erkannte sie es. In den Fenstern war kein Glas, nicht einmal Wachspapier. Neben dem zerfallenen Brunnen lag kein Seil. Nirgendwo waren Tiere zu sehen, bis auf ihr totes Pferd, was die ganze Sache nur noch zu betonen schien.
Das hier war die vertrocknete Hülle einer Stadt, die schon lange tot war.
Shy stand auf dem verlassenen Platz, auf den Ballen ihrer nackten Füße, als wollte sie irgendwohin losrennen, wüsste nur nicht, wohin. Sie schlang einen Arm um sich, während die Finger ihrer anderen Hand ziellos zuckten und flatterten. Sie biss sich auf die Lippen und sog die Luft scharf und schnell durch den schmalen Spalt ihrer Schneidezähne.
Selbst nach ihren derzeitigen, nicht allzu optimistischen Maßstäben war das ein mieser Augenblick. Aber sie hatte in den letzten Monaten gelernt, dass man immer noch tiefer sinken konnte. Als sie in die Richtung blickte, aus der sie gekommen war, sah sie die Staubwolke. Drei kleine graue Staubfahnen erhoben sich in der schimmernden Hitze über dem grauen Land.
»Ach, zur Hölle!«, flüsterte sie und biss sich fester auf die Lippe. Sie zog das Küchenmesser aus dem Gürtel und wischte den lächerlichen Metallsplitter an ihrem schmutzigen Hemd ab, als würde es ihre Chancen verbessern, wenn sie das Messer reinigte. Man hatte Shy schon oft vorgeworfen, sie hätte eine sehr rege Fantasie, trotzdem fiel es ihr schwer, sich eine erbärmlichere Waffe vorzustellen. Sie hätte gelacht, wenn sie nicht kurz davor gewesen wäre zu weinen. Wenn sie darüber nachdachte, musste sie zugeben, dass sie in den letzten Monaten viel zu oft den Tränen nahe gewesen war.
Wie hatte es nur so weit kommen können?
Diese Frage hätte einem Mädchen, das sitzen gelassen worden war, besser angestanden als einer Gesetzlosen, auf deren Kopf viertausend Silbermünzen ausgesetzt waren. Trotzdem stellte sie sich diese Frage immer wieder. Sie war wirklich ein toller Desperado! Gut, Desperados wurden gehetzt, und darin war sie Expertin, aber der Rest war ihr nach wie vor ein Rätsel. Die traurige Wahrheit lautete jedoch, dass sie ganz genau wusste, wie es zu alldem hatte kommen können, nämlich so wie immer. Ein Desaster folgte so schnell dem nächsten, dass sie förmlich zwischen ihnen hin und her hüpfte wie eine Motte, die in einer Laterne gefangen war. Dann stellte sie sich die zweite, übliche Frage, die der ersten stets unmittelbar folgte.
Was, verflucht, sollte sie jetzt machen?
Sie zog den Bauch ein, was sie zurzeit wenig Mühe kostete, und nahm den Beutel an der Zugkordel aus der Tasche. Die Münzen klickten auf diese besondere Weise, die nur Geld macht. Zweitausend Mäuse in Silber, mehr oder weniger. Eigentlich hätte man denken können, dass eine Bank mehr Geld aufbewahrte. Den Kunden erzählten sie immer, dass sie jederzeit fünfzigtausend Dollar bereit hätten. Wie sich herausstellte, konnte man Banken ebenso wenig trauen wie Bankräubern.
Sie streckte die Hand in den Beutel, nahm eine Handvoll Münzen heraus und verstreute das Geld auf der Straße. Es schimmerte im Staub. Sie tat das aus demselben Grund wie fast alles, was sie zurzeit machte, instinktiv, ohne genau zu wissen, warum. Vielleicht schätzte sie ihr Leben ja höher ein als zweitausend Silberstücke, auch wenn niemand sonst das tat. Vielleicht hoffte sie, dass sie einfach das Silber nehmen und sie in Ruhe lassen würden. Sie hatte noch nicht darüber nachgedacht, was sie tun sollte, wenn man sie in dieser Geisterstadt zurückließ, ohne Pferd, Essen oder eine Waffe. Und ganz sicher hatte sie keinen Plan geschmiedet, jedenfalls keinen, der besonders wasserdicht gewesen wäre. Diese lückenhafte Planung war schon immer ihr Problem gewesen.
Sie verteilte die funkelnden Silbermünzen, als streute sie Saat auf dem Hof ihrer Mutter aus, viele Meilen, viele Jahre und ein Dutzend brutaler Morde weit entfernt. Wer hätte je gedacht, dass sie diesen Ort vermissen würde? Dieses vollkommen verarmte Haus, die heruntergekommene Scheune und die Zäune, die immer repariert werden mussten. Oder die störrische Kuh, die niemals Milch gab, die widerspenstige Zisterne, die nie Wasser lieferte, und die eigensinnige Erde, in der nur Unkraut gedieh. Ihre dickköpfige kleine Schwester und ihren genauso dickköpfigen Bruder. Oder den großen, narbigen, schwachsinnigen Lamb. Was würde Shy nicht dafür geben, jetzt die schrille Stimme ihrer Mutter zu hören, die sie ausschimpfte. Sie schniefte heftig. Ihre Nase tat weh, und ihre Augen brannten. Sie fuhr mit der Rückseite ihres ausgefransten Ärmels darüber. Keine Zeit für tränenreiche Erinnerungen. Sie sah jetzt unter den Staubfahnen die drei dunklen Punkte der Reiter. Sie schleuderte den leeren Beutel weg, lief zum Saloon zurück und …
»Au!« Sie hüpfte auf einem Bein über die Schwelle, nachdem sie sich die nackte Fußsohle an einem hervorstehenden Nagel aufgerissen hatte. Die Welt war nichts weiter als ein gemeiner Schläger, das war Tatsache. Selbst wenn einem ein großes Unglück auf den Kopf zu fallen droht, nutzen auch kleine Missgeschicke jede Gelegenheit, einem in die Wade zu beißen. Hätte sie doch nur die Chance gehabt, sich ihre Stiefel zu schnappen! Und wenn auch nur, um einen Hauch von Würde zu bewahren. Aber sie hatte, was sie hatte, und auf dieser kurzen Liste standen weder Stiefel noch Würde. Und auch hundert große Wünsche waren keine einzige, noch so kleine Tatsache wert, wie Lamb immer wieder monoton wiederholte, wenn sie ihn und ihre Mutter, ihre Geschwister und ihr Schicksal verfluchte und schwor, dass sie am nächsten Morgen verschwinden würde.
Shy erinnerte sich daran, wie sie damals gewesen war. Sie wünschte, sie könnte ihrem früheren Selbst eins in die Fresse hauen. Nun, das konnte sie immer noch, wenn sie erst einmal aus diesem Schlamassel heraus war.
Zuerst aber galt es, eine ganze Prozession von anderen schlagbereiten Fäusten zu überstehen.
Sie lief die Treppe hinauf, leicht humpelnd und laut fluchend. Als sie das Obergeschoss erreichte, sah sie, dass sie auf jeder Stufe Abdrücke ihrer blutigen Zehen hinterlassen hatte. Sie kam sich ziemlich blöd vor, weil sie diese feucht schimmernde Spur hinterließ, die direkt bis zu ihrem Bein führte, als sich so etwas wie eine Idee schüchtern durch ihre aufkeimende Panik drängte.
Sie ging zurück zur Galerie und in einen leeren Raum am Ende der Empore, wobei sie darauf achtete, ihren blutigen Fuß fest aufzusetzen. In dem Zimmer hob sie den Fuß an, packte ihn mit einer Hand, um die Blutung zu stoppen, und hüpfte den Weg zurück, den sie gekommen war, bis in den ersten Raum neben dem Treppenabsatz, wo sie sich in den Schatten neben der Türöffnung drückte.
Zweifellos ein armseliger Versuch. Genauso erbärmlich wie ihre nackten Füße, ihr Küchenmesser, ihre Zweitausend-Silberstücke-Beute und ihr großer Traum, es wieder nach Hause in das Scheißloch zu schaffen, das zu verlassen einmal ein anderer großer Traum gewesen war. Es bestand nur eine sehr geringe Chance, dass diese drei Mistkerle darauf hereinfallen würden, auch wenn sie strohdumm waren. Andererseits, was hätte sie sonst tun können?
Wenn man nur noch wenig Einsatz hat, kann man nicht auf große Gewinne hoffen.
Ihr Atem war ihre einzige Gesellschaft. Er füllte die Leere, laut beim Ausatmen, zitternd beim Einatmen, und schmerzte ihr in der Kehle. Es waren die Atemzüge von jemandem, der so viel Angst hatte, dass er sich fast in die Hose schiss, und dem die Ideen ausgegangen waren. Sie konnte einfach nicht sehen, wie sie aus der Sache herauskommen sollte. Sollte sie es jemals wieder zurück zu diesem Hof schaffen, würde sie jeden Morgen, an dem sie aufwachte, aus dem Bett springen und einen kleinen Tanz aufführen, ihrer Mutter einen Kuss für jeden Fluch geben, ihre Schwester und ihren Bruder niemals anfahren und Lamb auch nicht mehr verspotten, weil er ein Feigling war. Sie versprach es und wünschte, sie wäre ein Mensch, der seine Versprechen auch hielt.
Sie hörte Pferdegetrappel auf der Straße und kroch zum Fenster. Von dort aus konnte sie ein Stück der Straße sehen. Sie warf so vorsichtig einen Blick über das Fensterbrett, als spähte sie in einen Eimer mit Skorpionen.
Da waren sie.
Neary trug die dreckige alte Decke, die er sich mit einem Strick um die Hüfte gebunden hatte. Sein fettiges Haar stand in alle möglichen Richtungen ab, er hielt die Zügel in einer und den Bogen, mit dem er auf Shys Pferd geschossen hatte, in der anderen Hand. Die Klinge der schweren Axt an seinem Gürtel war so makellos sauber, wie der Rest seiner abstoßenden Person verwahrlost war. Dodd hatte seinen ramponierten Hut tief in die Stirn gezogen und hockte mit zusammengezogenen, runden Schultern im Sattel, wie er es immer tat, wenn er mit seinem Bruder zusammen war. Wie ein junger Hund, der einen Schlag erwartet. Shy hätte diesem treulosen Mistkerl gern in diesem Moment einen Schlag versetzt. Einen für den Anfang. Dann war da noch Jeg. Er saß hoch aufgerichtet im Sattel wie ein vornehmer Herr in seinem langen roten Mantel, dessen schmutzige Schöße über den Rumpf seines großen Pferdes hingen, während er die Gebäude höhnisch und verächtlich musterte. Der große Hut, auf den er so stolz war, saß leicht schief auf seinem Kopf wie der Schornstein eines ausgebrannten Farmhauses.
Dodd deutete auf die Münzen, die im Staub rund um den Brunnen lagen. Ein paar von ihnen blitzten in der Sonne. »Sie hat das Silber zurückgelassen.«
»Sieht so aus.« Jegs Stimme war so hart, wie die seines Bruders sanft war.
Sie beobachtete, wie sie abstiegen und ihre Pferde anbanden. Sie ließen sich Zeit. Als würden sie sich nach einem netten Ritt den Staub aus den Kleidern klopfen und sich auf einen hübschen kleinen Abend in kultivierter Gesellschaft freuen. Es gab auch keinen Grund zur Eile. Sie wussten, dass sie hier war, und sie wussten, dass sie nirgendwo hingehen würde. Außerdem wussten sie, dass sie keine Hilfe bekommen würde. Und das wusste sie ebenfalls.
»Mistkerle«, flüsterte Shy und verfluchte den Tag, an dem sie sich mit ihnen eingelassen hatte. Aber man muss sich mit irgendjemandem einlassen, oder nicht? Und man kann sich nur das aussuchen, was im Angebot ist.
Jeg reckte sich, sog die Luft durch die Nase, spuckte aus und zückte dann sein Schwert. Es war der geschwungene Kavalleriesäbel, auf den er so stolz war. Der mit dem protzigen Korb am Griff, den er angeblich bei einem Duell gegen einen Unionsoffizier gewonnen, in Wirklichkeit aber, wie Shy wusste, gestohlen hatte. Ebenso wie alles andere, was er jemals besessen hatte. Wie sie ihn wegen dieses albernen Säbels verspottet hatte! Trotzdem hätte sie nichts dagegen, wenn sie es jetzt in der Hand halten würde und er stattdessen mit ihrem Küchenmesser bewaffnet wäre.
»Smoke!«, brüllte Jeg, und Shy zuckte zusammen. Sie hatte keine Ahnung, wer sich diesen Namen für sie ausgedacht hatte. Irgendein Witzbold hatte ihn auf einen Steckbrief geschrieben, und jetzt benutzten ihn alle. Wahrscheinlich lag das an ihrer Neigung, wie Rauch zu verschwinden. Der Grund könnte aber auch ihre Angewohnheit sein, wie Rauch zu stinken, Leuten in der Kehle stecken zu bleiben und vom Wind verweht zu werden.
»Komm raus, Smoke!« Jegs Stimme peitschte hallend zwischen den toten Fassaden der Gebäude, und Shy schrumpfte in der Dunkelheit ein bisschen weiter zusammen. »Komm raus, dann tun wir dir nicht allzu weh, wenn wir dich finden!«
Von wegen, das Geld nehmen und verschwinden! Sie wollten auch das Kopfgeld, das auf sie ausgesetzt war. Sie drückte ihre Zunge in den Spalt zwischen ihren Zähnen. Schwanzlutscher, sagte sie lautlos. Es gibt Männer, die immer mehr wollen, je mehr man ihnen gibt.
»Wir müssen sie holen«, brach Neary die Stille.
»Klar.«
»Ich hab gesagt, wir müssen losgehen und sie suchen.«
»Offenbar pisst du dir vor Freude darüber schon in die Hose, was?«
»Hab nur gesagt, wir müssen sie holen.«
»Hör auf zu quatschen und mach’s einfach.«
Sie hörte Dodds leicht atemlose Stimme. »Hör zu, das Silber liegt doch da. Wir könnten es zusammenklauben und verschwinden. Es ist nicht nötig …«
»Sind du und ich wirklich aus demselben verdammten Loch gekrochen?«, verhöhnte Jeg seinen Bruder. »Du bist echt der blödeste Mistkerl von allen.«
»Der Blödeste«, bekräftigte Neary.
»Glaubst du, dass ich die viertausend Kröten den Krähen überlasse?«, erkundigte sich Jeg. »Sammel du das Silber auf, Dodd. Wir reiten derweil die Stute zu.«
»Wo glaubst du, ist sie?«, wollte Neary wissen.
»Ich dachte, du wärst der große Spurenleser?«
»Draußen, in der Wildnis, aber wir sind nicht in der Wildnis.«
Jeg sah spöttisch auf die leeren Gebäude. »Du nennst das hier wohl den Gipfel der Zivilisation, ja?«
Sie sahen sich einen Moment an, während der Staub um ihre Beine von einem Windstoß aufgewirbelt wurde und sich dann wieder legte.
»Sie ist hier irgendwo«, erklärte Neary dann.
»Tatsächlich? Gut, dass ich die laut deiner eigenen Beschreibung schärfsten Augen westlich der Berge bei mir habe, damit ich ihr verdammtes totes Pferd zehn verfluchte Schritte von uns entfernt nicht übersehe. Ja, sie ist hier irgendwo.«
»Wo, glaubst du, ist sie?«
»Wo würdest du dich verstecken?«
Neary betrachtete die Gebäude, und Shy duckte sich rasch, als er mit zusammengekniffenen Augen den Saloon musterte.
»Da, denke ich, aber ich bin nicht sie.«
»Natürlich bist du verflucht noch mal nicht sie. Und weißt du auch, woher ich das weiß? Du hast größere Titten und weniger Hirn. Wenn du sie wärst, müsste ich jetzt verdammt noch mal nicht nach ihr suchen, oder?«
Schweigen. Eine Bö wirbelte Sand auf. »Denke nicht«, erklärte Neary.
Jeg nahm den großen Hut ab, kratzte sich mit den Fingernägeln sein verschwitztes Haar und setzte den Hut dann wieder schräg auf den Kopf. »Sieh du da nach. Ich nehme mir das nächste Haus vor. Aber bring das Miststück nicht um, kapiert? Das halbiert die Belohnung.«
Shy duckte sich tiefer in die Schatten und spürte, wie ihr unter dem Hemd der Schweiß herunterlief. Dass sie auch an einem so elenden Ort erwischt werden musste! Von diesem abgehalfterten Dreckskerl! Mit nackten Füßen. Sie hatte das nicht verdient. Sie wollte doch nur jemand sein, von dem man sprach. Nicht jemand, den man vergaß, sobald er tot war. Jetzt begriff sie, dass es eine schmale Grenze zwischen zu wenig Aufregung und zu viel davon gab. Aber wie die meisten ihrer etwas lahmen Eingebungen kam ihr auch diese ein Jahr zu spät.
Sie zog die Luft durch die kleine Lücke zwischen ihren Zähnen, als sie hörte, wie Neary über die knarrenden Bretter im Schankraum schlich. Hörte sie da sogar das metallische Klappern der großen Axt? Sie zitterte am ganzen Körper. Sie fühlte sich plötzlich so schwach, dass sie nicht einmal ihr Küchenmesser hochhalten konnte, ganz zu schweigen davon, dass sie damit hätte zustechen können. Vielleicht war es Zeit aufzugeben. Vielleicht sollte sie das Messer durch die Tür werfen und sagen: »Ich komme raus! Ich mache keinen Ärger! Ihr habt gewonnen!« Sie sollte lächeln, nicken, ihnen für ihren Verrat danken und für ihre Freundlichkeit, wenn sie die Scheiße aus ihr heraustraten oder sie auspeitschten, ihr die Beine brachen oder was ihnen sonst noch auf dem Weg zum Galgen so alles einfiel.
Sie hatte genug Leute am Galgen baumeln sehen und das Spektakel nie sonderlich genossen. Sie hatte Leute da stehen sehen, gefesselt, während man ihre Namen und Verbrechen verlas, hatte zugesehen, wie sie auf Begnadigung in letzter Sekunde hofften, die nicht kam, während sich die Schlinge zusammenzog, wie sie schluchzend um Gnade flehten oder wilde Flüche ausstießen, ohne dass irgendetwas davon auch nur den geringsten Unterschied gemacht hätte. Man trat zappelnd ins Leere, die Zunge quoll einem aus dem Mund, und man schiss sich voll, und das zur Belustigung von Abschaum, der nicht besser war als man selbst. Sie stellte sich Jeg und Neary vor, wie sie ganz vorne in dem grinsenden Pöbel vor dem Podest standen und zusahen, wie sie am Ende des Stricks den Diebestanz tanzte. Wahrscheinlich waren sie noch lächerlicher gekleidet, in Klamotten, die sie mit dem Geld von der Belohnung gekauft hatten.
Scheiß auf sie!, sagte sie lautlos in die Dunkelheit. Sie fletschte die Zähne, als sie hörte, wie Neary seinen Fuß auf die unterste Stufe setzte.
Sie war höllisch widerspenstig, die gute Shy. Schon als Kleinkind hatte sie angefangen sich zu überlegen, wie sie etwas anders machen konnte, wenn jemand ihr sagte, wie etwas sein sollte. Ihre Mutter hatte immer behauptet, sie wäre so störrisch wie ein Maultier, und es ihrem Geisterblut zugeschrieben. »Das ist dein verdammtes Geisterblut!«, hatte sie gesagt, als wäre es Shys Entscheidung gewesen, dass sie zu einem Viertel eine Wilde war, und nicht die ihrer Mutter, die sich mit einem wilden, herumstreunenden Halbgeist ins Bett gelegt hatte, der sich, nicht sonderlich überraschend, als ekelhafter Trunkenbold entpuppt hatte.
Shy würde kämpfen. Zweifellos würde sie verlieren, aber sie würde kämpfen. Sie würde diese Mistkerle dazu bringen, sie zu töten, und ihnen damit zumindest die Hälfte der Belohnung wegnehmen. Man sollte nicht denken, dass solche Gedanken einen ruhiger machen konnten, aber bei ihr funktionierte es. Das Küchenmesser zitterte immer noch in ihrer Hand, aber jetzt, weil sie es so fest umklammerte.
Für einen Mann, der sich selbst als einen großartigen Spurenleser bezeichnete, hatte Neary mächtige Probleme damit, leise zu sein. Sie hörte, wie er schnaufend durch die Nase atmete, als er am oberen Treppenabsatz stehen blieb. Er war so nah, dass sie ihn hätte berühren können, wäre nicht die Bretterwand zwischen ihnen gewesen.
Eine Bodendiele knarrte, als er sein Gewicht verlagerte, und Shy spannte sich an, während die Härchen auf ihrer Haut zu Berge standen. Dann sah sie ihn. Er stürmte nicht durch die Tür auf sie zu, die Axt in der Faust und Mordlust in den Augen, sondern schlich langsam die Galerie entlang, den blutigen Fußabdrücken folgend, die sie als Köder ausgelegt hatte. Sein gespannter Bogen zielte genau in die falsche Richtung.
Wenn man Shy ein Geschenk gab, dann hatte sie schon immer lieber mit beiden Händen zugepackt, statt lange zu überlegen, wie sie sich bedanken könnte. Sie stürzte sich von hinten auf Neary, die Zähne gefletscht und mit einem bösen Knurren. Sein Kopf fuhr herum, und sie sah das Weiße in seinen Augen. Der Bogen folgte seiner Bewegung. Die Pfeilspitze schimmerte in dem spärlichen Licht, das sich durch die Löcher in den Brettern dieses gottverlassenen Ortes verirrte.
Sie duckte sich und warf sich gegen seine Beine. Sie rammte mit der Schulter seinen Schenkel, woraufhin er schmerzhaft knurrte, schob ihren Arm zwischen seine Beine und packte ihr Handgelenk mit der anderen Hand, fest unter Nearys Arsch. Sein säuerlicher Schweißgeruch und der Gestank nach Pferd stiegen ihr in die Nase. Er ließ die Bogensehne los, aber Shy richtete sich bereits auf, knurrend, mit einem wilden Schrei, wuchtete sich mit aller Kraft hoch und hob Neary, trotz seiner Größe, über das Geländer, ebenso geschickt, wie sie einen Sack Getreide auf dem Hof ihrer Mutter hochgehievt hatte.
Er hing einen Moment in der Luft, Mund und Augen vor Schreck weit aufgerissen, dann stürzte er mit einem Keuchen in die Tiefe und zertrümmerte die Bodenbretter im Erdgeschoss.
Shy blinzelte und konnte es kaum glauben. Ihre Kopfhaut brannte, und sie legte vorsichtig einen Finger darauf. Sie erwartete fast, den Pfeil zu ertasten, der in ihrem Schädel steckte, aber als sie sich umdrehte, sah sie, dass er in der Wand hinter ihr gelandet war. Von ihrem Standpunkt aus gesehen, ein erheblich besseres Ergebnis. Aber das Blut klebte in ihren Haaren und lief ihr in die Stirn. Vielleicht hatte das harte Ende des Bogens sie erwischt. Wenn sie sich diesen Bogen holen konnte, hatte sie vielleicht eine Chance. Sie machte einen Schritt zur Treppe, hielt dann jedoch abrupt inne. Jeg stand in der offenen Tür; sein Säbel hob sich wie ein langer, krummer Strich vor der grellen Sonne auf der Straße ab.
»Smoke!«, brüllte er. Sie stürmte wie ein Karnickel von der Galerie, folgte ihrer eigenen Spur aus blutigen Fußabdrücken ins Nichts, hörte, wie Jeg mit seinen schweren Stiefeln zur Treppe trampelte. Sie warf sich aus vollem Lauf mit der Schulter gegen die Tür am Ende der Galerie und landete, in gleißendem Sonnenschein, auf einem Balkon hinter dem Gebäude. Sie sprang mit einem nackten Fuß auf das niedrige Geländer, getreu ihrem Motto, immer das Gegenteil von dem zu tun, was vernünftig war. Sie hoffte einfach, dass sie diesen Sprung irgendwie überstehen würde, statt innezuhalten und nachzudenken. Sie sprang, versuchte, den baufälligen Balkon an dem Gebäude auf der anderen Seite der schmalen Gasse zu erreichen, und ruderte wie wild mit Armen und Beinen, als hätte sie einen Anfall und als würde sie das irgendwie weitertragen.
Sie erwischte das Geländer mit den Händen, krachte mit ihrer Brust gegen das Holz, rutschte herunter, stöhnte, suchte nach Halt, bemühte sich verzweifelt, sich hochzuziehen und über das Geländer zu klettern, spürte, wie etwas nachgab …
Mit gequältem Ächzen brach das ganze verfluchte, verwitterte Ding aus der Wand des Gebäudes.
Wieder wurde Shy ein Moment gewährt, in dem sie mit Händen und Füßen um sich schlagend durch die Luft flog, um über ihre Lage nachzudenken. Aber sie war immer noch nicht besser darin geworden, ihre Situation rasch einzuschätzen. Sie wollte gerade anfangen zu schreien, als ihr alter Feind, der Boden, sie einholte, wie der Boden es immer tat. Er schleuderte ihr linkes Bein hoch, wirbelte sie herum, schlug dann gegen ihre Seite und presste ihr sämtliche Luft aus der Lunge.
Shy hustete, stöhnte und spuckte Dreck aus. Es war nur ein schwacher Trost, dass sie recht behalten hatte, als sie vorhin dachte, es wäre nicht der letzte Mund voll Staub, den sie fressen würde. Sie sah Jeg, der auf dem Balkon stand, von dem sie gesprungen war. Er schob sich den Hut in den Nacken, lachte und verschwand dann wieder in dem Gebäude.
Sie hatte immer noch ein Stück des Geländers in der Hand, auch wenn es ziemlich verrottetes Holz war. Ebenso verrottet wie ihre Hoffnungen. Sie warf es weg, als sie sich herumrollte, und wartete erneut auf dieses widerliche Gefühl, dass sie erledigt war und sich etwas gebrochen hatte. Wieder wartete sie vergeblich. Sie konnte sich bewegen. Sie zog die Füße an und vermutete, dass sie sogar aufstehen könnte. Aber sie nahm sich vor, es einstweilen zu lassen. Es war sehr wahrscheinlich, dass sie es nur noch ein einziges Mal schaffen würde.
Sie befreite sich von den Holztrümmern an der Wand, und ihr Schatten fiel bis zur Tür. Sie stöhnte vor Schmerz, als sie Jegs schwere Schritte hörte. Sie krabbelte auf Hintern und Ellbogen zurück, zog ein Bein nach und hatte das Küchenmesser im Ärmel an ihrem Handgelenk versteckt. Die andere Hand grub sie in den Dreck.
»Wohin willst du denn?« Jeg duckte sich unter den niedrigen Türsturz und trat auf die Gasse. Er war ein großer Mann, aber jetzt kam er ihr vor wie ein Gigant. Er war mindestens einen Kopf größer als Shy, selbst wenn sie stand, und wahrscheinlich fast doppelt so schwer wie sie, selbst wenn sie an diesem Tag etwas gegessen hätte. Er stolzierte zu ihr, die Zunge gegen die Unterlippe gedrückt, so dass sie sich vorwölbte, und den Säbel locker in der Hand. Er genoss seinen großen Auftritt.
»Hast Neary mächtig reingelegt, was?« Er schob den Rand seines Hutes ein wenig hoch und entblößte den sonnengebräunten, staubigen Rand auf seiner Stirn. »Du bist stärker, als du aussiehst. Allerdings ist dieser Bursche so blöd, dass er auch ohne deine Hilfe runtergefallen wäre. Mich verarschst du nicht.«
Das würden sie noch sehen, aber sie wollte ihrem Messer die Antwort überlassen. Auch ein kleines Küchenmesser kann ein verdammt überzeugendes Stück Metall sein, wenn man es in die richtige Stelle eines Körpers steckt. Sie krabbelte weiter zurück und trat Staub hoch, damit es so aussah, als würde sie vergeblich versuchen hochzukommen. Dann sackte sie mit einem Wimmern zurück, als sie ihren linken Fuß aufsetzte. Es kostete sie keine allzu große Mühe, auszusehen, als wäre sie schwer verletzt. Sie spürte, wie Blut über ihre Stirn quoll. Es kitzelte. Jeg trat aus dem Schatten. Die tief stehende Sonne schien ihm ins Gesicht, und er blinzelte. Genau das hatte sie gewollt.
»Ich erinnere mich noch daran, wie ich dich zum ersten Mal gesehen habe«, fuhr er fort. Er liebte es, sich reden zu hören. »Dodd ist zu mir gekommen, vollkommen aufgeregt, und hat gesagt, er hätte Smoke getroffen, die Frau, deren Killerfresse auf allen Steckbriefen bis nach Rostod zu sehen ist und für deren Ergreifung viertausend Mäuse ausgeschrieben sind. Was sie alles für Geschichten über dich erzählt haben!« Er johlte spöttisch, und sie krabbelte weiter zurück, wobei sie das linke Bein unter ihren Körper zog und sich vergewisserte, dass es funktionieren würde, wenn sie es brauchte. »Man hätte glauben können, du wärst ein Dämon mit zwei Schwertern in einer Hand, so wie sie deinen Namen geflüstert haben. Stell dir meine verfluchte Enttäuschung vor, als ich feststellen musste, dass du nur ein verängstigtes Mädchen mit einer Zahnlücke bist, das schrecklich nach Pisse stinkt.« Als würde Jeg wie eine Sommerwiese duften! Er trat noch einen Schritt vor und griff mit seiner großen Hand nach ihr. »Und jetzt kratz mich nicht; du bist für mich lebendig mehr wert. Ich will dich nicht …«
Sie schleuderte ihm mit der linken Hand den Dreck ins Gesicht, während sie sich mit dem rechten Bein vom Boden abstieß und aufsprang. Er riss den Kopf zur Seite und knurrte wütend, als der Dreck in sein Gesicht flog. Dann schlug er blindlings nach ihr, als sie sich geduckt auf ihn stürzte. Das Schwert zischte über ihren Kopf hinweg, und der Luftzug fing sich in ihrem Haar. Das Gewicht der Waffe riss ihn herum. Sie packte seinen Mantelschoß mit der linken Hand und rammte ihm ihr Küchenmesser mit der anderen in die Schulter.
Er stieß ein ersticktes Knurren aus, als sie das Messer wieder herauszog und erneut auf ihn einstach. Die Klinge durchtrennte den Ärmel seines Mantels, streifte den Arm darunter und hätte sich fast in ihr eigenes Bein gegraben. Sie holte erneut mit dem Messer aus, als seine Faust gegen ihren Mundwinkel krachte und sie zurücktaumelte. Ihre nackten Füße suchten Halt im Dreck der Straße. Sie erwischte die Ecke des Gebäudes und klammerte sich einen Augenblick dort fest, während sie versuchte, das Licht aus ihrem Schädel zu schütteln. Sie sah Jeg ein oder zwei Schritte von ihr entfernt. Er schäumte vor Wut und hatte die Zähne gefletscht, während er versuchte, den Säbel von seiner schlaff herunterhängenden rechten Hand in seine Linke zu bekommen. Aber seine Finger klemmten in dem schicken Korbgriff aus Messing fest.
Wenn etwas schnell gehen musste, hatte Shy den Bogen heraus. Sie handelte einfach, ohne Gedanken an Gnade oder an ein Ergebnis zu verschwenden, eigentlich ohne überhaupt viel zu denken. Das hatte sie bis jetzt in dieser ganzen Scheiße am Leben gehalten. Und sie überhaupt in diesen ganzen Mist hineinmanövriert. Viele Segnungen erweisen sich als sehr fragwürdige Wohltaten, sobald man mit ihnen leben muss, und sie war verflucht, zu viel nach irgendwelchen Handlungen nachzudenken. Aber das war eine andere Geschichte. Wenn Jeg seine Waffe wieder richtig zu packen bekam, wäre sie tot, so einfach war das. Also stürzte sie sich auf ihn, noch bevor die Straße aufgehört hatte, sich um sie zu drehen. Er versuchte, seinen Arm zu befreien, aber es gelang ihr, den Arm mit ihrer linken Hand zu packen, ihn gegen den Mann zu drücken und sich an seinem Mantel festzukrallen, während sie blindlings mit dem Messer zustach, immer wieder, in den Bauch, die Rippen, noch mal in die Rippen – sie fauchte ihn an, und er ächzte bei jedem Stoß der Klinge, deren Griff in ihrer schmerzenden Hand immer glitschiger wurde.
Schließlich erwischte er ihr Hemd, und die Nähte rissen, als der Ärmel sich halb löste. Er versuchte sie wegzustoßen, als sie wieder auf ihn einstach, aber es lag keine Kraft in dem Stoß, und sie taumelte nur einen Schritt zurück. Allmählich klärte sich ihr Kopf, und sie hatte ihr Gleichgewicht wieder, aber Jeg schwankte und sank auf ein Knie. Sie hob das Messer mit beiden Händen hoch in die Luft und hämmerte es mitten in diesen albernen Hut. Sie presste ihn platt, während sich das Messer bis zum Griff in Jegs Schädel bohrte.
Dann taumelte sie zurück und erwartete, dass er einfach aufs Gesicht fiel. Stattdessen zuckte er plötzlich hoch wie dieses Dromedar, das sie einmal auf einem Jahrmarkt gesehen hatte. Der Rand seines Hutes war über seine Augen bis zur Nasenwurzel hinuntergerutscht, und der Griff des Messers ragte senkrecht aus seinem Kopf.
»Wo steckst du?« Die Worte klangen undeutlich, als hätte er Kies im Mund. »Smoke?« Er schwankte nach links, dann nach rechts. »Smoke?« Er schlurfte auf sie zu, wirbelte Staub auf, und der Säbel baumelte in seiner blutigen rechten Hand. Die Spitze kratzte kleine Furchen in den Dreck neben seinen Füßen. Er hob die Linke, die Finger steif ausgestreckt, aber mit schlaffem Handgelenk, und stupste gegen seinen Hut, als hätte er etwas im Auge und wollte es wegwischen.
»Smoke?« Eine Seite seines Gesichts zuckte, bebte und flatterte auf eine höchst unnatürliche Art und Weise. Vielleicht war es aber auch ganz natürlich für einen Mann, dem ein Messer im Hirn steckte. »Sssmoke?« Blut tropfte von der verbogenen Krempe seines Hutes und lief in langen Rinnsalen über seine Wange. Sein Hemd war schon halb davon durchtränkt. Aber er kam weiter auf sie zu, während sein blutiger rechter Arm zuckte und das Heft seines Säbels gegen sein Bein klapperte. »Schmoee?« Sie wich zurück, starrte ihn an, ihre Hände fühlten sich schlaff an, und ihre ganze Haut prickelte, bis sie mit dem Rücken gegen die Hauswand stieß. »Sooee?«
»Halt dein Maul!« Sie stürzte sich mit ausgestreckten Händen auf ihn, stieß ihn zurück, sein Säbel flog aus seiner Hand, während sein blutiger Hut immer noch mit ihrem Messer auf seinen Kopf genagelt war. Er stürzte aufs Gesicht, während sein rechter Arm wie ein Fisch auf dem Trockenen zuckte. Dann schob er die andere Hand unter seine Schulter, als wollte er sich hochstemmen.
»Oh«, nuschelte er in den Staub. Dann verstummte er.
Shy drehte langsam den Kopf zur Seite und spie Blut aus. In den letzten Monaten hatte sie zu viel Blut gespuckt. Ihre Augen waren nass, und sie wischte sich die Tränen mit ihrem zitternden Handrücken weg. Sie konnte nicht glauben, was da passiert war. Es kam ihr fast so vor, als hätte sie nichts damit zu tun gehabt. Als hätte sie einen Albtraum, aus dem sie gleich erwachen würde. Sie kniff die Augen zu, öffnete sie wieder, und da lag er immer noch.
Sie holte tief Luft und stieß sie zischend aus. Speichel flog aus ihrem Mund. Blut tropfte von ihrer Stirn, und sie atmete erneut tief ein und presste den Atem heraus. Dann packte sie Jegs Säbel und biss die Zähne zusammen, um sich nicht zu erbrechen. Der Ekel stieg in Wellen in ihr hoch, zusammen mit dem pochenden Schmerz in ihrem Kiefer. Scheiße, sie hätte sich so gerne hingesetzt! Wollte einfach nur aufhören. Aber sie zwang sich dazu, sich abzuwenden. Sie zwang sich, zur Hintertür des Saloons zu gehen. Die Tür, durch die Jeg gekommen war, lebendig, noch vor wenigen Augenblicken. Es braucht ein ganzes Leben harter Arbeit, um einen Menschen zu erschaffen. Und es braucht nur ein paar Augenblicke, um ihm ein Ende zu bereiten.
Neary hatte sich aus dem Loch gearbeitet, das er bei seinem Sturz in die Bodendielen geschlagen hatte, umklammerte sein blutiges Hosenbein und wirkte dadurch ziemlich gehandicapt. »Hast du dieses verfluchte Miststück erledigt?« Er sah mit zusammengekniffenen Augen zur Tür.
»Na selbstverständlich.«
Er riss die Augen auf und versuchte sich zu seinem Bogen zu schleppen, der nicht weit von ihm entfernt auf dem Boden lag. Dabei wimmerte er die ganze Zeit. Sie hob Jegs Säbel, als sie näher trat, und Neary drehte sich um, die Augen vor Entsetzen weit aufgerissen und einen Arm verzweifelt erhoben. Sie hämmerte die flache Seite des Säbels mit voller Wucht auf den Arm, und er stöhnte, presste ihn an seine Brust. Der nächste Schlag traf ihn seitlich am Kopf. Er wurde auf die Bodenbretter geschleudert und wimmerte. Dann ging sie an ihm vorbei, schob den Säbel in ihren Gürtel, hob den Bogen auf und zog ein paar Pfeile aus dem Köcher. Sie ging zur Tür und legte einen Pfeil an die Sehne, bevor sie auf die Straße hinausblickte.
Dodd war immer noch dabei, Münzen aus dem Staub zusammenzuklauben und in den Beutel zu stopfen. Er arbeitete sich langsam zum Brunnen vor, gleichgültig, was das Schicksal seiner beiden Kumpane betraf. Was nicht so überraschend war, wie man hätte glauben können. Wenn ein Wort Dodd hinlänglich beschrieb, dann war es das Wort »gleichgültig«.
Sie trat vorsichtig die Stufen vom Saloon herunter, dicht am Rand, wo sie möglicherweise nicht so schnell knarrten und ihn warnten. Dann spannte sie den Bogen und zielte genau auf Dodd. Er hockte gebückt im Staub, den Rücken zu ihr gekehrt. Zwischen seinen Schultern zeichnete sich auf seinem Hemd ein dunkler Schweißfleck ab. Sie überlegte lange, ob sie diesen Schweißfleck als Zielscheibe nehmen und ihm auf der Stelle einen Pfeil in den Rücken jagen sollte. Aber es ist nicht so einfach, einen Mann zu töten, schon gar nicht, wenn man lange darüber nachdenkt. Sie sah zu, wie er die letzte Münze aufhob, sie in den Beutel fallen ließ, sich langsam aufrichtete, die Schnüre zusammenband und sich dabei lächelnd umdrehte. »Ich habe das ganze …«
Sie verharrten eine Weile so. Er stand geduckt mitten auf der staubigen Straße, den Beutel mit Silber in einer Hand und ein unsicheres Lächeln auf dem sonnenbeschienenen Gesicht. Aber im Schatten seines billigen Hutes sahen seine Augen eindeutig verängstigt aus. Sie stand auf der untersten Stufe des Saloons, mit blutigen, nackten Füßen, einer blutigen, aufgeplatzten Lippe, blutigem Haar, das auf ihrer blutigen Stirn klebte, aber den Bogen gespannt und ruhig in den Händen.
Er leckte sich die Lippen, schluckte und leckte sie sich erneut. »Wo ist Neary?«
»Dem geht’s nicht gut.« Sie war überrascht, wie hart ihre Stimme klang. Wie die von jemandem, den sie nicht einmal kannte. Vielleicht die Stimme von Smoke.
»Wo ist mein Bruder?«
»Dem geht’s noch schlechter.«
Dodd schluckte, reckte das Kinn vor, so dass sie seinen verschwitzten Hals sah, und machte Anstalten, langsam zurückzugehen. »Du hast ihn umgebracht?«
»Vergiss die beiden und rühr dich nicht von der Stelle.«
»Hör zu, Shy, du wirst mich doch nicht erschießen? Nicht nach allem, was wir durchgemacht haben. Du wirst nicht schießen. Nicht auf mich. Oder?« Seine Stimme wurde immer höher, aber er wich immer noch rückwärts zum Brunnen zurück. »Ich wollte das alles hier nicht. Es war nicht meine Idee!«
»Natürlich nicht. Du musst denken können, um eine Idee zu haben, und das kriegst du nicht hin. Du hast einfach nur mitgemacht. Selbst wenn das zufällig bedeutet hat, mich an den Galgen zu bringen.«
»Hör zu, Shy …«
»Bleib stehen, hab ich gesagt!« Sie spannte den Bogen, und die Sehne schnitt in ihre blutigen Finger. »Bist du verdammt noch mal taub, Junge?«
»Hör zu, Shy, lass uns einfach darüber reden, ja? Einfach reden.« Er hob zitternd die Hand, als könnte er damit einen Pfeil aufhalten. Er hatte den Blick seiner blassblauen Augen fest auf sie gerichtet, und plötzlich erinnerte sie sich an ihre erste Begegnung, als er an der Wand des Mietstalls lehnte, lächelnd. Er war nicht allzu schlau, aber man konnte viel Spaß mit ihm haben. Sie hatte einen sehr großen Mangel an Spaß gehabt, seit sie von zu Hause weg war. Man hätte nicht glauben sollen, dass sie von zu Hause weggelaufen war, um Spaß zu haben.
»Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber … Ich bin ein Idiot.« Er versuchte zu lächeln, aber es war genauso zittrig wie seine Handfläche. Dodd hatte sie zum Lachen gebracht, jedenfalls am Anfang. Und auch wenn er weder ein großer Künstler noch ein großer Liebhaber gewesen war, hatte er das Bett gewärmt, was schon etwas bedeutete. Und er hatte ihr das Gefühl gegeben, dass sie nicht allein auf der einen Seite stand und die ganze restliche Welt auf der anderen, was noch mehr bedeutet hatte.
»Bleib stehen«, sagte sie, aber es klang etwas sanfter.
»Du wirst mich nicht erschießen.« Er ging immer noch langsam rückwärts zum Brunnen. »Ich bin’s, richtig? Ich. Dodd. Erschieß mich jetzt nur nicht.« Er ging immer weiter. »Denn was ich machen werde, ist …«
Sie schoss auf ihn.
Mit einem Bogen ist das so eine Sache. Wenn man die Sehne befestigt und spannt, einen Pfeil einnockt und zielt … All das kostet Mühe, erfordert Geschicklichkeit und eine Entscheidung. Die Sehne loszulassen ist dagegen gar nichts. Man hört einfach nur auf, sie festzuhalten. Sobald man sie gespannt und gezielt hat, ist es sogar leichter, sie loszulassen, als es nicht zu tun.
Dodd war weniger als ein Dutzend Schritte entfernt, und der Schaft zischte über die Entfernung zwischen ihnen hinweg, verfehlte haarscharf seine Hand und grub sich lautlos in seine Brust. Das Ausbleiben eines Geräuschs überraschte sie. Andererseits, Haut und Fleisch sind weich, vor allem im Vergleich mit einer Pfeilspitze. Dodd machte noch einen taumelnden Schritt, als hätte er noch nicht begriffen, dass er von einem Pfeil getroffen worden war. Er riss die Augen weit auf. Dann blickte er blinzelnd auf den Schaft.
»Du hast auf mich geschossen«, flüsterte er und sank auf die Knie. Das Blut durchtränkte sein Hemd bereits in einem dunklen Oval.
»Ich habe dich verdammt noch mal gewarnt!« Sie warf den Bogen zu Boden, wütend auf Dodd und auf den Bogen.
Er starrte sie an. »Ich habe nicht geglaubt, dass du’s tun würdest.«
Sie erwiderte seinen Blick. »Ich auch nicht.« Einen Moment herrschte Stille, und der Wind frischte kurz auf und wirbelte den Staub um sie herum. »Tut mir leid.«
»Es tut dir leid?«, krächzte er.
Es war vielleicht das Dümmste, was sie jemals gesagt hatte, obwohl die Konkurrenz in der Hinsicht groß war, aber was hätte sie sonst sagen sollen? Worte würden diesen Pfeil nicht zurückholen. Sie zuckte die Achseln. »Ich glaube schon.«
Dodd zuckte zusammen, hob den Beutel mit dem Silber hoch und drehte sich zu dem Brunnen um. Shys Kiefer klappte herunter, und sie rannte los, als Dodd seitlich umkippte und den Beutel in die Luft schleuderte. Er drehte sich immer wieder um die eigene Achse, flog hoch, und dann sank er, mit flatternder Zugkordel. Shy streckte die Hand danach aus, während sie rannte, sprang, stürzte …
Sie stieß ein lautes Keuchen aus, als ihre ohnehin schon schmerzenden Rippen gegen den gemauerten Rand des Brunnens prallten und ihr rechter Arm in die Dunkelheit hinabzuckte. Einen Moment lang fürchtete sie, sie würde dem Beutel in die Tiefe folgen, was wahrscheinlich ein durchaus passender Schluss gewesen wäre, dann jedoch landeten ihre Knie wieder auf dem Dreck vor der Mauer.
ENDE DER LESEPROBE
COPYRIGHT
(Welch ein Desperado!) »Some Desperado« by Joe Abercrombie. Copyright © 2013 by Joe Abercrombie.
(Entweder ist mein Herz gebrochen) »My Heart Is Either Broken« by Megan Abbott. Copyright © 2013 by Megan Abbott.
(Noras Lied) »Nora’s Song« by Cecelia Holland. Copyright © 2013 by Cecelia Holland.
(Die Hände, die nicht da sind) »The Hands That Are Not There« by Melinda Snodgrass. Copyright © 2013 by Melinda Snodgrass.
(Bombige Muscheln) »Bombshells« by Jim Butcher. Copyright © 2013 by Jim Butcher.
(Raisa Stepanowa) »Raisa Stepanova« by Carrie Vaughn. Copyright © 2013 by Carrie Vaughn
(Ringen mit Jesus) »Wrestling Jesus« by Joe R. Lansdale. Copyright © 2013 by Joe R. Lansdale.
(Nachbarn) »Neighbors« by Megan Lindholm. Copyright © 2013 by Megan Lindholm.
(Ich weiß, wie man sie rauspickt) »I Know How To Pick ’Em« by Lawrence Block. Copyright © 2013 by Lawrence Block.
(Schatten für Stille in den Waldungen der Hölle) »Shadows for Silence in the Forests of Hell« by Brandon Sanderson. Copyright © 2013 by Brandon Sanderson.
(Königin im Exil) »A Queen in Exile« by Sharon Kay Penman. Copyright © 2013 by Sharon Kay Penman.
(Das Mädchen im Spiegel) »The Girl in the Mirror« by Lev Grossman. Copyright © 2013 by Lev Grossman.
(Zweite Arabesque, sehr langsam) »Second Arabesque, Very Slowly« by Nancy Kress. Copyright © 2013 by Nancy Kress.
(Stadtlazarus) »City Lazarus« by Diana Rowland. Copyright © 2013 by Diana Rowland.
(Unschuldsengel) »Virgins« by Diana Gabaldon. Copyright © 2013 by Diana Gabaldon.
(Verkünder der Strafe) »Pronouncing Doom« by S. M. Stirling. Copyright © 2013 by S. M. Stirling.
(Benenne die Bestie) »Name the Beast« by Sam Sykes. Copyright © 2013 by Sam Sykes.
(Kümmerer) »Caregivers« by Pat Cadigan. Copyright © 2013 by Pat Cadigan.
(Lügen, die meine Mutter mir erzählt hat) »Lies My Mother Told Me« by Caroline Spector. Copyright © 2013 by Caroline Spector.
(Die Hölle kennt keinen Zorn) »Hell Hath No Fury« by Sherilynn Kenyon. Copyright © 2013 by Sherilynn Kenyon.
(Die Prinzessin und die Königin) »The Princess and the Queen« by George R. R. Martin. Copyright © 2013 by George R. R. Martin.