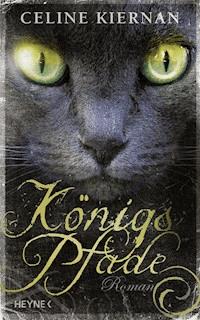
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Moorehawke Trilogie
- Sprache: Deutsch
Der Höhepunkt der großen irischen Fantasy-Saga
In einer Welt, in der Magie Teil des täglichen Lebens ist ... einer Welt, in der Geister, Katzen und Wölfe Geheimnisse ausplaudern ... einer Welt, in der dunkle Mächte nach der Herrschaft greifen ... ist ein junges Mädchen die einzige Hoffnung ... Die große Fantasy-Entdeckung aus Irland: Celine Kiernan verzaubert ihre Leser.
Lange währte die Irrfahrt der jungen adeligen Wynter durch die dunklen Wälder des Königreiches. Doch endlich ist sie an ihrem Ziel angelangt: dem geheimen Lager des abtrünnigen Prinzen Alberon. Ihr zur Seite steht ihr treuer alter Freund Razi, der Halbbruder des Prinzen. Und Christopher, mit dem Wynter eine zarte Liebe verbindet, obwohl er ein düsteres Geheimnis hütet. Gemeinsam versuchen die Gefährten, den Prinzen zur Aussöhnung mit seinem Vater zu bewegen. Aber Alberon, der fest an seine kriegerische Überlegenheit glaubt, will nichts von ihrer friedvollen, diplomatischen Lösung wissen. Kann Wynter ihn noch von seinem halsbrecherischen Plan abbringen, in dem ihr eigener Vater eine verhängnisvolle Rolle spielt? Oder ist ihre Welt und alles, was ihr etwas bedeutet, endgültig dem Untergang geweiht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Für Mam und Dad, ich liebe euch.
Für Noel, Emmet und Grace, immer und von ganzem Herzen.
Für Angela Oelke (Moore) und Ellen ›Sam‹ Samberg,die von Anfang bis Ende meine unerschütterlich ehrlichenFreunde und Unterstützer waren.
Ein Riesendankeschön an Svetlana Pironko von der Author Rights Agency für ihren Schutz und ihren Rat. Eine wunderbare Agentin und Freundin. Auch an meinen ersten Verlag The O’Brien Press, der das Wagnis eingegangen ist, es mit mir zu probieren, und der mich unterstützt und mir geholfen und während dieses ganzen Abenteuers meine Hand gehalten hat. Ganz besonders danke ich Michael O’Brien für seine Furchtlosigkeit. Meinen Dank und alles Liebe auch an Sorcha De Francesco (Ní Chuimín) und Phil Ó Cuimin, die mir ihre wunderschöne irische Alltagssprache zur Verfügung gestellt haben. Danke an Pat Mullan, dessen Freundlichkeit und menschliche Größe eine Tür aufstießen, von der ich allmählich befürchtet hatte, sie wäre auf immer verschlossen. Und wie immer: Danke, Catherine und Roddy. Schließlich noch ganz besonderen Dank an Elise Jones, meine Lektorin bei Allen & Unwin: Du bist eine Gottgesandte, und eine saukomische noch dazu. Ohne dich wäre ich verloren gewesen.
Inhaltsverzeichnis
Die scharlachrote Furt
Als Wynter fünf war, hatte ihr Vater ihr ein rotes Mäntelchen angezogen, sie auf den Rücken seines Pferdes gesetzt und zu einem Picknick mitgenommen. Wynter erinnerte sich noch an die trägen Bewegungen des Tiers unter ihr und an die Wärme ihres Vaters, an dessen Brust sie sich auf dem Weg über die Waldpfade geschmiegt hatte. Sie erinnerte sich an seine starken Arme, die sie umfingen, an den Duft von Holzspänen und Harz in seinen Kleidern. Sie erinnerte sich an das Licht, das durch das Laub fiel, und wie es über ihre Hände gewandert war, die auf dem dicken Lederknauf von Lorcans Sattel so klein aussahen.
Lorcans Freund Jonathon war bei ihnen gewesen, wie auch dessen Söhne Razi und Alberon. Alle waren sie glücklich gewesen und hatten gelacht, was damals recht häufig vorgekommen war. Einfach nur zwei Freunde und ihre geliebten Kinder auf einem Ausflug an einem warmen Herbsttag, um das gute Wetter auszunutzen, ehe der Winter endgültig Einzug hielt.
Rückblickend wusste Wynter, dass irgendeine Art Begleitschutz dabei gewesen sein musste, aber sie konnte sich an keine Soldaten oder Leibwachen erinnern. Vielleicht war sie so an die Anwesenheit von Soldaten im Umfeld des guten Freundes ihres Vaters gewöhnt gewesen, dass sie die Männer gar nicht mehr wahrgenommen hatte. Damals war Jonathon für sie nie »der König« gewesen; sie wusste noch, dass sie in ihm immer nur Jon gesehen hatte, diesen großen Mann mit dem goldenen Haupt, der so rasch in Zorn geriet, aber ebenso bereitwillig seine Zuneigung zeigte. Er war der beste Freund ihres Vaters und Vater ihrer eigenen beiden besten Freunde, ihrer Brüder im Herzen: des dunklen, ernsthaften, fürsorglichen Razi und des überschwänglichen, liebevollen Alberon mit dem breiten Grinsen.
Razi war die ganze Zeit vorausgetrottet, das braune Gesicht leuchtend vor Freude über die unerwartete Freiheit dieses Tages. Alberon saß zum ersten Mal auf seinem eigenen Pferd, und Wynter wusste noch, dass sie gleichzeitig belustigt und etwas neidisch beobachtet hatte, wie er das kleine Tier vorantrieb und versuchte, mit seinem älteren Halbbruder Schritt zu halten. Immer wieder hatte er ängstlich gerufen »Razi! Razi! Lass mich nicht allein!«, und Razi hatte sich lächelnd umgedreht und gewartet.
An einer Furt hatten sie Rast gemacht, und die Männer hatten sich bis auf die Unterwäsche ausgezogen und waren ins flache Wasser gelaufen, hatten gejauchzt, einander bespritzt und gelacht, weil es so kalt war. Wynter war am Rande des Flusses von einem Bein auf das andere gehüpft und hatte zugesehen, wie sich Alberon in die Arme seines Vaters warf. Jon hatte ihn hoch ins helle Licht gehalten, und Albis kleines Gesichtchen hatte in der glitzernden Sonne vor Freude gestrahlt.
Ein warmes Gefühl an ihrer Seite, und sie hatte in Razis lächelnde Miene geblickt.
»Komm schon, mein Liebling.« Er hatte ihr seine Hand entgegengestreckt. »Es ist nur im ersten Augenblick kalt.« Vorsichtig hatte er sie ins Wasser geführt, ihre Hand fest in seiner, dann war Wynters Vater zu ihnen gewatet, hatte sie beide hochgehoben und sie, einen unter jedem Arm, ins klare Wasser getragen, um sie das Schwimmen zu lehren.
Beinahe elf Jahre später saß Wynter Moorehawke auf den warmen, glatten Kieseln einer ähnlichen Furt und lauschte dem verstohlenen Geraschel des Waldes um sie herum. Die Hälfte ihrer Aufmerksamkeit war der für sie unverständlichen Unterhaltung der merronischen Krieger gewidmet, die zu ihrer Rechten auf dem Felsen saßen, die andere Hälfte den Schatten des Waldes und allem, was dort lauern konnte.
Unten am Ufer hockte der inzwischen einundzwanzigjährige Razi und betrachtete mit gerunzelter Stirn das flache Wasser. Einen wohltuenden Moment lang machte es den Eindruck, als wollte er tatsächlich ausruhen und sich hinsetzen, aber Wynter wusste, dass es nicht von langer Dauer sein konnte. Und da fuhr sich der dunkle junge Mann auch schon wieder mit der Hand durchs Haar, seufzte bedrückt und erhob sich.
Fang bloß nicht an, auf und ab zu tigern, dachte Wynter, aber natürlich tat Razi genau das.
Seine schlanke Gestalt stapfte aus dem Sichtkreis ihres Augenwinkels, und im Nu kam er auch schon wieder zurück, so dass Wynter den Kopf abwenden musste, um von seinem rastlosen Auf und Ab nicht in den Wahnsinn getrieben zu werden. Seit Emblas Tod rauschte dicht unter Razis Oberfläche ein tiefer und wütender Strom der Ungeduld, und er offenbarte sich in ständigem Bewegungsdrang, der die Langmut seiner Umgebung auf eine harte Probe stellte. Wynter empfand aufrichtiges Mitgefühl für Razis Verlust, aber in diesem Augenblick nagte das Knirsch, Knirsch, Knirsch seiner Schritte auf den Kieseln an ihren ohnehin bis zum Zerreißen gespannten Nerven. Heftig biss sie die Zähne aufeinander, um dem Drang zu widerstehen, ihn anzufahren.
Ein ärgerliches Grunzen war aus der Kriegergruppe zu vernehmen. »Tabiyb«, knurrte Ùlfnaor, »setz dich, bevor ich dir haue mein Schwert über den Schädel.« Razi verzog wütend die Miene, und der schwarzhaarige Merronerführer runzelte die Stirn. »Hinsetzen«, befahl er. »Du gehst mir auf die Nerven.« Razi gehorchte, und Ùlfnaor nickte beifällig. »Sie kommen bald zurück«, sagte er. »Nutze diese Zeit, dich auszuruhen.«
Der große Mann klang ruhig, doch mit den Augen suchte er unentwegt besorgt das jenseitige Ufer ab. Seine Krieger saßen um ihn herum, die drei Frauen schärften ihre Schwerter, die drei Männer ließen die Bäume auf der gegenüberliegenden Seite der Furt nicht aus den Augen. An diesem Morgen waren sie mit der Erwartung aufgebrochen, Alberon zu treffen und diplomatische Gespräche mit ihm aufzunehmen, weswegen sowohl die Männer als auch die Frauen in den festlichen Merronerstaat gekleidet waren. Er bestand aus den prachtvollen blassgrünen, bestickten Gewändern und Hosen, die Arme und Hände geziert von ihrem schweren Stammesschmuck. Aber der Tag war ohne ein Zeichen des Rebellenprinzen zur Neige gegangen, und der Abend stand kurz bevor. Allmählich fürchtete Wynter, sie wären irregeleitet worden.
Sie begegnete dem Blick der Heilerin Hallvor. Die sehnige Frau lächelte aufmunternd, doch Wynter konnte die Anspannung in ihrem Gesicht lesen. Ùlfnaors zwei riesige Kriegshunde schnüffelten am Rande des Wassers herum; als Hallvor aufstand und zum Ufer ging, hoben sie die Köpfe. Im Gehen schob die Heilerin ihr Schwert in die Scheide, und die Hunde wedelten hoffnungsvoll mit den Schwänzen, vielleicht würde endlich etwas passieren. Doch Hallvor legte nur jedem eine schwielige Hand auf den struppigen Kopf und beobachtete weiterhin den gegenüberliegenden Wald. Niedergeschlagen murmelte sie etwas auf Merronisch, das Ùlfnaor in besänftigendem Ton beantwortete.
Wynter wünschte, Christopher wäre bei ihr, und nicht nur, weil er dann für sie übersetzen könnte. Während sie ihn mit aller Kraft herbeisehnte, bildeten sich tiefe Falten auf ihrer Stirn. Als sich Razi erneut rührte, knirschte es hinter ihr im Kies. Sein langer Schatten fiel über Wynter, dann ging er neben ihr in die Hocke, die Ellbogen auf den Knien, die Augen auf das jenseitige Ufer gerichtet.
»Ich glaube nicht, dass wir hier Glück haben werden«, sagte er leise.
Wynter nickte. Seit dem frühen Morgen zogen die Merroner an diesem Fluss entlang und machten immer wieder an im Voraus vereinbarten Treffpunkten halt, um auf Alberons Männer zu warten, die sie ins Rebellenlager führen sollten. Dies war bereits der vierte Treffpunkt, und wie bei allen vorigen hatte sich auch hier keine Menschenseele gezeigt. Sie warteten nun schon weit über eine Stunde, doch Ùlfnaor wollte nur ungern weiterreiten. Nach diesem Ort verblieb lediglich eine Stelle, an der sie hoffen konnten, auf Alberons Männer zu stoßen. Sollte sich auch diese als verwaist herausstellen, wäre die gesamte merronische Mission gescheitert. Die nördlichen Krieger müssten in ihre Heimat zurückkehren, ohne ihre Pflicht erfüllt zu haben, und Razi, Wynter und Christopher wären ihrem Ziel, Alberons Feldlager zu finden, keinen Schritt näher als vor fast drei Wochen.
»Chris und Sòl sind schon zu lange weg«, murmelte Wynter.
Razi seufzte nur und rieb sich das Gesicht. Die Mühe einer Entgegnung machte er sich nicht; er hatte schon ausreichend Bemerkungen dieser Art von Wynter gehört, doch das war ihr ganz egal. Vor lauter Unruhe war sie reizbar. Es blieben ihnen nur mehr knappe vier Stunden Tageslicht, und sie wollte Christopher in Sichtweite haben, wollte ihn an ihrer Seite wissen, nicht draußen in den Wäldern, wo vielleicht die Loups-Garous umherschlichen und die Männer des Königs immer noch Jagd auf die Rebellen machten.
»Ùlfnaor hätte Chris und Sòl niemals allein nach dort draußen lassen dürfen«, sagte sie nun. »Zum Teufel mit der Auskundschafterei! Um ehrlich zu sein, glaube ich, er hat sie nur gehen lassen, damit sie Ruhe geben und etwas zu tun haben.«
Razi brummelte etwas Zustimmendes. Christopher war ein unverbesserlich leichtsinniger Bursche, und was Sòlmundr betraf – seit dem Verlust seines geliebten Ashkr schien der merronische Krieger geradezu besessen von einer gefährlichen, unüberwindlichen Ruhelosigkeit. Er und Christopher stachelten einander an, beide scharrten mit den Hufen, wollten unbedingt etwas tun. Für Wynters Geschmack waren sie mit viel zu großer Begeisterung und viel zu wenig Umsicht in den Wald gezogen. Wenn sie doch nur zurückkämen! Selbst in Begleitung von Sölmundrs Kriegshund Boro waren ihre Freunde dort draußen ihrer Meinung nach furchtbar verletzlich.
Gerade klappte Wynter den Mund auf, um diese Ansicht zu äußern, als plötzlich unten am Fluss Hallvor und die Kriegshunde aufmerkten. Die Heilerin machte einen Schritt nach vorn und suchte den Wald ab; die Hunde knurrten, und Hallvor befahl ihnen mit einer knappen Geste, ruhig zu sein.
Razi und Wynter erhoben sich. Auch die Merroner auf dem Felsen standen auf.
»Cad é, a Hallvor?«, fragte Ùlfnaor.
Hallvor bedeutete ihm, still zu sein, den Blick weiterhin nach vorn gerichtet. Dann deutete sie auf die Bäume. »Coinin«, sagte sie. »Agus é ag rith.«
Tatsächlich, es war Christopher, der lautlos und sehr schnell durch den Wald rannte, das lange schwarze Haar hinter sich her wehend, die schlanken Arme und Beine vor und zurück schnellend. Er stürmte ins Sonnenlicht und durchquerte die flache Furt mit einem Flimmern spritzender Schritte, Boro und Sölmundr dicht auf den Fersen.
»Rasch!«, zischte Christopher. »Da kommt jemand, und es sind ganz bestimmt keine diplomatischen Gesandten!«
Die Merroner rannten zu ihren Pferden, doch Sölmundr rief sie zurück. Er selbst erklomm unverzüglich die Felsen und stürzte sich auf den Waffenstapel, um seinen Langbogen und die Pfeile an sich zu reißen. Seine Begleiter gesellten sich zu ihm, und er zischte ihnen atemlos Erklärungen zu, während sie sich mit Kampfgerät versahen.
Christophers graue Augen suchten die von Wynter, während er schlitternd neben ihr zum Stehen kam. »Keine Zeit zu fliehen«, sagte er. »Macht euch bereit zum Kampf! Sie sind knapp hinter uns.«
Wynter zückte ihr Schwert. »Wie viele?«
»Habe ich noch Zeit, die Muskete zu laden?«, fragte Razi.
Christopher schüttelte den Kopf »Keine Ahnung, wie viele, ich glaube sogar, sie wissen nicht einmal, dass wir hier sind. Aber sie kommen genau auf uns zu, und sie haben es verdammt eilig. Keine Zeit für die Muskete, Razi. Zieht beide eure Schwerter und bleibt hinter den Bogenschützen.«
Sölmundr rief etwas, und Christopher wirbelte gerade noch rechtzeitig herum, um die Armbrust aufzufangen, die ihm der Krieger zugeworfen hatte. Der Köcher mit Christophers schwarzen Bolzen kam hinterhergesegelt, und Wynter fing ihn mit einer Hand, während Christopher schon am Hebel zog. Sie reichte ihm einen Bolzen, und er spannte ihn ein. Dann drehte er sich mit dem Gesicht zur Furt, und Wynter trat neben ihn, das Schwert in der Hand.
Sòlmundr schüttelte sich das sandfarbene Haar aus den Augen und zielte mit seinem Langbogen in die Bäume, die anderen Merroner verteilten sich am Strand, die Bögen gespannt, die Kriegshunde gehorsam und ohne einen Mucks von sich zu geben neben sich. Holz und Leder der Bögen knarzten, als die Krieger nur eben so viel Druck auf die Sehnen legten, um die Pfeile gespannt zu halten, ohne jedoch ihre gesamte Kraft aufzuwenden. Die schwirrende Stille des Abends legte sich um sie herum, während sie warteten.
Christopher schob sich die Armbrust in die Schulterkuhle und nahm festen Stand ein. »Da sind sie«, flüsterte er.
Auch Wynter konnte sie jetzt hören, sie näherten sich schnell. Es war ganz anders als bei Christophers geräuschloser Ankunft gerade: So lärmte jemand, der achtlos durch den dichten Wald trampelte. Es klang nach einem Menschen in Todesangst, einem Verzweifelten. Die Merroner spannten ihre Bögen bis zum Anschlag und zielten.
Der Mann, der durch die Bäume gestürzt kam, nahm sie überhaupt nicht wahr. Er taumelte aus dem Schatten ins Sonnenlicht und platschte mitten ins helle Wasser, ohne die Reihe stattlicher Krieger am anderen Ufer, die ihm mit ihren Pfeilen folgten, auch nur zu bemerken. Den Kopf hielt er gesenkt, die Arme um den Bauch geschlungen, und er schien all seine Kraft zu benötigen, um einfach nur einen Fuß vor den anderen zu setzen.
»Halt!«, rief Wynter. »Nicht schießen!«
Beim Klang ihrer Stimme kam der Mann stolpernd zum Stehen. Sobald ihn der Schwung der Vorwärtsbewegung verließ, verlor er allem Anschein nach auch die Fähigkeit zu stehen; unvermittelt sank er auf die Knie und fiel mit dem Gesicht voran in den flachen Fluss. Sofort färbte sich das Wasser rot.
Einen Augenblick lang herrschte benommenes Schweigen, alle beobachteten, wie das Blut des Mannes wirbelte und sich ausbreitete und als dunkles Band von seinem Körper forttrieb. Dann schleuderte Razi klirrend sein Schwert beiseite und watete in den Fluss, um den Mann auf den Rücken zu drehen.
Wynter hatte angenommen, der arme Teufel wäre bewusstlos, doch sobald Razi sein Gesicht aus dem Wasser hob, tat er einen keuchenden Atemzug und umklammerte Razis Kragen mit einer blutigen Faust.
»Helft mir«, ächzte er. »Helft mir ...« Seine halb geöffneten Augen lagen auf den Merronern, die nun wieder auf die Bäume zielten und ihre Wachsamkeit zwischen dem Verletzten und seinen möglichen Verfolgern aufteilten.
Razi hievte den Mann hoch, und Wynter lief zu ihm, um zu helfen, gefolgt von Christopher. Ohne seine Deckung zu vernachlässigen, schob er sich vor sie und Razi, die Armbrust auf das gegenüberliegende Ufer gerichtet.
»Los, hinter die Bogenschützen mit Euch«, befahl er schroff.
»Kavallerie ... Kavallerie ...«, stöhnte der Verwundete, während sie ihn an Land schleppten. »Geflohen ... der Prinz.«
Als sie ihn auf die warmen Steine des Strands legten, blickte Razi Wynter über den Kopf des Mannes hinweg an. »Gehört Ihr der Kavallerie des Königs an?«, fragte er, drehte den Verwundeten und öffnete seine Jacke, um seine Verletzungen zu begutachten. Beim Anblick einer pulsierenden Wunde in der Seite des armen Kerls krümmte sich Wynter unwillkürlich. Sie musste den Blick von dem freigelegten Knochen und den hervortretenden Eingeweiden abwenden.
»Ich hole deine Arzttasche«, erbot sie sich.
Doch Razi schüttelte mit finsterer Miene den Kopf, und Wynter wusste, dass man nichts mehr tun konnte.
Razi beugte sich herab. »Gehört Ihr der Kavallerie an?«, wiederholte er sanft.
»Ja ... nein ... nicht ... sie sind hinter mir her. O Gütiger, hilf mir ...« Der Mann versuchte fortzukriechen, seine blutigen Hände tasteten über die glatten Kiesel, das Gesicht war vor Schmerz verzerrt. Blut quoll in furchtbaren Mengen aus seiner Wunde und sammelte sich auf den Steinen um ihn herum.
»Ganz ruhig.« Wynter legte ihm die Hand aufs Gesicht. »Bleibt ruhig liegen ... ganz ruhig, mein Freund.«
Der Mann hielt still und legte ächzend den Kopf auf den Boden.
»Wer verfolgt Euch?«, fragte Wynter.
»Die Kavallerie ... die Kavallerie ... die Männer des Königs ...«
Wynter warf Razi einen Seitenblick zu. Die Männer des Königs.
»Ihr arbeitet für meinen Bruder«, sagte Razi leise.
Zum ersten Mal sah der Mann in Razis dunkles Gesicht empor, und seine Augen weiteten sich vor Angst. »O lieber Gott, steh mir bei«, raunte er. »Ihr seid der Araber.« Er schloss die Augen. »O weh, ich bin verloren.«
»Verfolgen dich die Männer meines Vaters?«, fragte Razi nun. »Suchst du den Schutz des Rebellenlagers?«
»Fürst Razi hofft, seinen Bruder im Rebellenlager zu finden«, flüsterte Wynter. »Er wünscht, ihn mit dem König zu versöhnen. Wir können Euch in Sicherheit bringen, wenn Ihr uns den Weg zum Prinzen weist.«
Doch der Mann drehte sein Gesicht nur in die Steine hinein, überzeugt, sich unter Feinden zu befinden, und entschlossen, kein Wort mehr über seine Lippen kommen zu lassen.
»Razi.« Christopher drehte sich kurz zu seinem Freund um. »Die Merroner können nicht zulassen, dass die Männer des Königs sie ergreifen.«
Auch Sölmundr und Ùlfnaor blickten Razi über die Schulter an. Der Rest der Merroner konnte der Unterhaltung nicht folgen und zielte weiterhin auf den Waldrand, doch ihre Augen flackerten hin und her zwischen ihren Anführern und dem dunkelhäutigen Mann, den zu beschützen sie geschworen hatten.
»Razi«, beharrte Christopher. »Wenn die Männer deines Vaters eintreffen, müssen wir auf sie schießen! Sonst verurteilst du diese Menschen zum Tod – und deine Mission wäre gescheitert.«
Razi schüttelte den Kopf, ohne die Augen von dem Verwundeten abzuwenden.
Wynter legte ihm eine Hand auf den Arm. Dann blickte sie in Christophers gequälte Miene.
»Die Männer des Königs werden uns töten, Wynter«, sagte Christopher. »Entweder wir kämpfen gegen sie, oder wir sterben; daran geht kein Weg vorbei.«
»Andere kommen!«, rief , und Wynter sprang auf die Füße, als sie schnelles Hufgetrappel durch die Bäume vernahm. Mit dem Schwert in der Hand stellte sie sich wieder an Christophers Seite, ihr Herz pochte laut vor Wut und Furcht. Lieber Gott, war es nun wirklich dazu gekommen? Musste sie treuen Soldaten der Krone entgegentreten und sie entweder töten oder selbst sterben?
Die Merroner riefen ihre Hunde bei Fuß und spannten erneut ihre Bögen bis zum Anschlag. Ein Aufblitzen von Sonne auf Metall leuchtete durch das schwankende Laub des Waldes, dunkle Gestalten näherten sich. Ùlfnaor, die massigen Arme zitternd vor Anstrengung, hielt den Bogen gespannt und murmelte seinen Kriegern leise etwas zu. Offenbar wies er sie an: »Wartet ... wartet noch ...«
Wynter sank in die Hocke und hob ihr Schwert höher. Ihr Entschluss stand fest: Sie würde hier nicht sterben. Sie würde nicht sterben!
Unterdessen sah sich Christopher zu Razi um, er wollte die Erlaubnis zu schießen einholen.
Die Augen fest zugekniffen, neigte Razi den Kopf. Dann griff er nach seinem Schwert, erhob sich und nahm seinen Platz an Christophers Seite ein. Als die Soldaten des Königs die Baumreihe gerade durchbrachen, legte Christopher an.
Es waren nur zwei, und sie erreichten die Furt mit beinahe kindlicher Selbstvergessenheit. Wynter wusste, dass sie den Ausdruck in ihren Gesichtern niemals vergessen würde, als sie sich – in Erwartung eines einzelnen, zu Fuß flüchtenden Soldaten – plötzlich einer Reihe finsterer Bogenschützen gegenüberfanden.
Es gab nur einen kurzen Moment der Verzögerung, einen winzigen Bruchteil Zeit, dann griff der jüngere Kavallerist nach seinem Schwert. Christophers Armbrustbolzen traf ihn zwischen den Augen und riss ihn rückwärts vom Pferd. Alle sonstigen Geräusche wurden begraben unter dem schweren Plopp der Langbögen, dem Zischen und Aufprallen der merronischen Pfeile, die ihr Ziel suchten und fanden. Die schlaffen Leiber der Soldaten stürzten in das hoch aufspritzende Wasser; ihr Blut strömte flussabwärts, genau wie das des Rebellensoldaten vorher.
Wynters Schwertarm sank herab, sie sah den Männern des Königs beim Sterben zu.
Die prächtigen Kavalleriepferde schwankten unter einem zweiten Pfeilhagel, dann gingen auch sie zu Boden, und ihr Blut vermischte sich mit dem ihrer Reiter, strudelte hinaus ins klare Wasser, tränkte den Fluss rot. Rasch erfüllte die dunkle Farbe die Furt, wirbelte und floss und reckte die Arme, bis sie in leuchtenden, von der Sonne umspielten kleinen Wogen ans Ufer schwappte und die gleichgültigen Kiesel zu Wynters Füßen verfärbte.
Razi hinter ihr wandte sich von diesem Schauspiel des Todes ab und kniete sich erneut neben den Rebellensoldaten. Unter Wynters traurigem Blick schloss er dem armen Teufel die leblosen Augen. Ganz kurz blieb Christopher an Wynters Seite stehen, den Arm teilnahmsvoll um ihre Taille gelegt. Dann rannte er in die blutrote Furt hinein und half den Merronern, ihre ins Wasser gefallenen Pfeile einzusammeln.
Das Rebellenlager
Es war Abend, und die Schatten des Waldes verdichteten sich bereits zur Finsternis, als Christopher vor Wynter seine Stute zügelte und ihr den Weg versperrte. Er fluchte unterdrückt. Beunruhigt ließ Wynter ihr eigenes Pferd die wenigen Schritte bis zu ihm weiterlaufen und hielt neben ihm an. Sie spähte durch das Laub, um zu sehen, was ihn aufgeschreckt haben mochte. Um sie füllte sich die Luft mit dem Schnauben von Pferden und dem Klimpern von Zaumzeug, als der Rest der merronischen Reiter ebenfalls zum Stehen kam. Gemurmel und leise Rufe der Besorgnis waren zu hören.
Als sie sich nach vorn beugte, um besser sehen zu können, sank Wynter der Mut; nur etwa zwei Meter vor ihnen hörten die Bäume unvermittelt auf, und die sichere Deckung wurde von einer großen Fläche felsigen Untergrunds abgelöst – eine Lücke von etwa zwanzig Metern zwischen dem diesseitigen und dem jenseitigen Abschnitt aus dichtem Gehölz. Das offene Gelände erstreckte sich weithin zu beiden Seiten, ein langer Steinrücken, der den Wald in zwei Teile spaltete.
»O je, Christopher, das ist nicht gut.«
Christopher nickte. »Wenn wir hier durchreiten, sind wir verletzlich wie Neugeborene.«
Wynter wandte sich der Spitze ihres Trupps zu, wo Razi neben Ùlfnaor und Sòl die vorderste Stellung einnahm. Alle drei betrachteten die Lichtung mit sorgenvollen Mienen.
»Mir gefällt nicht«, sagte Sòlmundr ruhig. »Schlecht. Wir sollten Umweg machen.«
Ùlfnaor wechselte einen Blick mit Razi, der knapp den Kopf schüttelte. »Ich sage, wir reiten hier durch.«
Der Aoire nickte. »Dann wir reiten hier durch«, befand er. »Wari, Coinin, Soma und Frangok geben Rückendeckung. Dann sie kommen nach, wenn alles gut.« Er bemerkte Sölmundrs missbilligenden Blick und seufzte. »Die Zeit wird knapp, Sòl. Wir dürfen nicht riskieren, unsere Route zu ändern. Wir müssen vertrauen dem Urteil von Tabiyb. Wir reiten hier durch.«
Einen Moment lang sah Sòlmundr Razi, der den Blick weiter geradeaus gerichtet hielt und mit ausdrucksloser Miene wartete, finster an; dann willigte er widerstrebend brummelnd ein. Auf Merronisch wurden Befehle erteilt, die Wachmannschaft zückte ihre Bögen.
Als er seine Armbrust lud, sah Wynter Christopher eindringlich an. »Ich warne dich, Mädel«, sagte er feierlich. »Wenn wir es ohne Löcher im Leib auf die andere Seite schaffen, stehle ich sieben Küsse der Hohen Protektorin Moorehawke.«
Er wirkte so von sich überzeugt, so selbstsicher und lebendig, dass Wynter einfach die Hand nach ihm ausstrecken und ihre Faust um sein Hemd schließen musste. Lächelnd ließ er sich von ihr über die Lücke zwischen ihren Pferden ziehen, dann presste sie ihre Lippen auf seine, fest und leidenschaftlich und beschützend. Nach dem Kuss verharrten sie in dieser Stellung, ihre Stirnen berührten sich, die Augen waren halb geschlossen.
»Pass gut auf dich auf«, flüsterte sie.
»Wenn ich das mache, schuldest du mir noch sechs von der Sorte.«
Sie grinste. »Komm heil auf die andere Seite, Freier Garron, und ich gewähre dir unter Umständen noch mehr als Küsse.«
Als er den Mund breit verzog, bildeten sich Grübchen in seinen Wangen. »Da hast du aber einige Versprechungen einzuhalten«, murmelte er.
Sie küssten sich noch einmal, die Pferde tänzelten unter ihnen. Dann rückte Wynter von ihm ab, zog sich das Tuch über das Gesicht und reihte sich, ohne noch einmal zurückzublicken, in den Vortrupp ein, der nun seine Reittiere in den grellen Schein der Abendsonne trieb.
Froh, der Enge des Waldes entflohen zu sein, sprangen die Kriegshunde mit heraushängenden Zungen vor ihren Herren her, mit den langen Schwänzen freudig die Luft peitschend. Die Merroner behielten sie im Auge. Als die riesenhaften Geschöpfe auf halber Strecke über die Lichtung plötzlich ihr übermütiges Erforschen einstellten und erstarrten, hob Ùlfnaor sofort den Arm, und der Vortrupp hielt argwöhnisch an.
Mit gesenkten Köpfen beobachteten die Hunde den Wald vor sich. Dann heulte Boro jäh auf, machte einen Satz nach vorn und bellte wild die Bäume an. Die anderen Hunde taten es ihm gleich.
Erschrocken warf Wynters Pferd den Kopf nach hinten und wollte kehrtmachen, bis Wynter ihm hart die Fersen in die Flanken drückte. »Ganz ruhig, Ozkar!«, zischte sie.
Vor ihnen, verborgen zwischen den Bäumen, wieherte ein weiteres Pferd furchtsam auf, und Wynter suchte die Schatten nach den Reitern ab, die sich dort ganz offensichtlich versteckten.
Etwas unwillig gehorchten die Kriegshunde Ùlfnaors Befehl, zurück zu den Reitern zu kommen, und liefen immer noch bellend hin und her. Der Lärm war ohrenbetäubend.
»Ciúnas!«, brüllte Sòlmundr, und sofort gaben die Tiere Ruhe. Winselnd trippelten sie vor ihren Herren herum, die Augen nach wie vor starr auf die dunklen Bäume gerichtet.
Immer noch blieb der Wald jenseits der Lichtung still, die Schatten für Wynters von der Sonne geblendete Augen undurchdringlich. Um sie herum hielten die Merroner gespannt den Atem an. Wynter hatte keinen Zweifel, dass Christopher hinter ihr im Wald in genau diesem Augenblick den Hebel seiner Armbrust zurückklappte, und sie widerstand dem Drang, über die Schulter zu blicken, versuchte, sich nicht das Heulen der durch die Luft schwirrenden Pfeile, nicht ihren dumpfen Aufprall vorzustellen, wenn sie ihr Ziel trafen. Mit Gewalt schob sie die Erinnerung an blutiges Wasser und Leichen aus ihrem Kopf und schnupperte nach dem verräterischen Geruch einer Lunte. Nichts zu riechen. Gut. Wenigstens wurde nicht mit einer Kanone auf sie gezielt. Das war doch schon mal etwas.
Rechts von ihr zog Razi den Kopf ein und schob das Tuch vor seinem Gesicht etwas höher. Wynter pries insgeheim den grellen Sonnenschein, denn so trugen sie alle die Hüte tief in der Stirn, und auch die Fliegenschwärme, wegen derer ihre verhüllten Gesichter weniger verdächtig wirkten, waren hilfreich. Als sich Razi wieder im Sattel aufrichtete, entdeckte sie zu ihrer Erleichterung, dass das Zusammenspiel von Hutschatten und Tuch es unmöglich machte, seine dunkle Haut zu erkennen. In seinem geborgten grünen Umhang und mit seiner beachtlichen Größe war er von den anderen merronischen Kriegern nicht zu unterscheiden. Wynter hoffte, ihre eigene kleine Statur wäre daneben nicht allzu auffällig.
Ein Pfeifen durchschnitt die Luft, und als sie das Signal vernahm, das Alberons Verbündete benutzten, machte Wynters Herz einen Satz. Ùlfnaor pfiff die korrekte Entgegnung. Darauf folgte ein Moment Stille, ehe eine vornehme Stimme auf Südlandisch rief: »So weit?«
Der erste Teil von Alberons Losung! Konnte es sein, dass sie endlich ihr Ziel erreicht hatten?
Ùlfnaor rief die Antwort. »Und noch nicht da?«
Ein Reiter löste sich aus dem Schatten der Bäume und brachte sein tänzelndes Pferd neben dem riesigen Felsblock am oberen Ende des Pfads zum Stehen. Er zog den Hut hinab, um sich gegen die Sonne abzuschirmen, und blinzelte die Hunde an. Der Mann trug keine Uniform, doch Zaumzeug und Waffen waren die eines Soldaten, und er ritt ein Kavalleriepferd, das er gut zu handhaben wusste, obgleich es in der Nähe der Hunde die Augen weit aufgerissen hatte und schreckhaft war. Mit Sicherheit war er ein Offizier aus Jonathons Armee. Kühl betrachtete Wynter ihn unter ihrer Hutkrempe hervor. Ein Offizier aus Jonathons Armee, ohne Uniform und auf Alberons Seite gegen den König. Was sollte sie da empfinden?
Unwillkürlich kam ihr das Wort verräterisch in den Sinn, doch dann dachte Wynter wieder an die toten Soldaten am Fluss, an ihr Blut, das sich im Wasser vermischte, an ihre Gefolgschaftstreue, die sich zu beiden Seiten der königlichen Kluft aufgespaltet hatte. Alle waren sich so sicher gewesen, wo ihre Pflicht lag, einer wie der andere; alle waren unwiederbringlich tot. Sie bemühte sich, ihre Feindseligkeit zu bezwingen. Warten wir ab, welche Erklärungen dieser Abend, noch bringt, dachte sie.
Ùlfnaor warf den Hut in den Nacken, so dass ihm das lange dunkle Haar auf die Schultern fiel. Dann schüttelte er seinen Umhang zurück, wodurch die Stammesarmreife zum Vorschein kamen. Sòlmundr lenkte sein Pferd neben das seines Anführers und entblößte ebenfalls Haar und Arme. Einen schrecklichen Augenblick lang dachte Wynter, alle Merroner würden ihrem Beispiel folgen, doch Hallvor und die rotschöpfigen Brüder hielten ihre Gesichter bedeckt und die Hüte aufgesetzt. So blieb Razis Andersartigkeit verborgen.
In seinem gebrochenen Hadrisch rief Ùlfnaor: »Ich bin Ùlfnaor, Aoire an Domhain, Gesandter der königlichen Prinzessin Marguerite Shirken der Nordländer. Ich bringe Dokument für königlichen Prinzen, Alberon Königssohn. Ich erbitte freies Geleit zu seinem Lager.«
Der Offizier riss sich von den aufgebrachten Hunden los und betrachtete Ùlfnaor eingehend. Dann wanderte sein Blick nacheinander von Reiter zu Reiter. Als seine Augen Razi erreichten, versteifte sich Wynter, doch der Fremde schenkte ihrem Freund nicht mehr Beachtung als allen anderen, und als sie selbst an der Reihe war, ging er ohne Verzug zum nächsten über. Schließlich wandte er sich erneut Ùlfnaor zu und sprach ihn in fehlerfreiem Hadrisch an. »Ihr habt Männer im Wald«, stellte er fest.
»Genau wie ihr«, sagte Ùlfnaor.
Der Offizier schnaubte. »Ganz schön großer Trupp für einen gewöhnlichen Boten«, bemerkte er.
Ùlfnaor schwieg einen Augenblick. Als er das Wort wieder ergriff, schwang etwas Warnendes in seiner Stimme mit. »Ich bin Gesandter«, sagte er. »Ich bin Fürst der merronischen Völker, beauftragt von der königlichen Prinzessin der nordländischen Völker, zu unterstützen sie bei ihren Verhandlungen.«
Wynter beäugte den Offizier. Falls Alberon kein untragbar schlampiges Lager führte, hatte dieser Mann sicherlich genaueste Anweisungen, was seine Behandlung jedes Besuchers betraf: Seine Haltung Ùlfnaor gegenüber müsste die des Prinzen ganz bewusst widerspiegeln.
»Vergebt mir«, murmelte er trocken. »Es war nicht meine Absicht, Euch zu beleidigen.«
Wynter gefiel sein Ton nicht. Ùlfnaor betrachtete ihn kalt und schwieg.
Der Offizier machte eine Geste über die Schulter, und ein weiterer Reiter tauchte aus dem Wald auf »Mein Leutnant wird Euch ins Lager begleiten. Auf Befehl seiner königlichen Hoheit Prinz Alberon wird Euch freies Geleit gewährt. Ihr könnt Eure verborgene Wachmannschaft zu Euch rufen.«
Ùlfnaor neigte lediglich den Kopf, und sofort ertönte hinter Wynter das Trappeln von Hufen und das Klirren von Zaumzeug, als die anderen aus ihrem Versteck kamen. Jemand näherte sich ihr von links, das Pferd schnaubte und schüttelte den Kopf Sie schielte zur Seite; es war Christopher, das Gesicht verhüllt, die Augen starr in die Bäume gerichtet.
Auf ein Nicken seines Vorgesetzten wendete der Leutnant sein Pferd, und der Merronertrupp folgte ihm in den Wald.
Es dauerte einen Moment, bis sich Wynters Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, doch dann sah sie sich zu ihrem Schrecken von Soldaten umzingelt. Fünfzehn oder gar zwanzig gut bewaffnete Reiter flankierten den Pfad und beobachteten stumm den Zug der Merroner durch ihre Reihen.
Als die Reisenden vorbeigetrabt waren, wandte die Hälfte der Soldaten ihre Reitpferde zur Lichtung um; die anderen ritten den Merronern nach, überwachten schweigend ihr Vorrücken durch die Bäume. Wynter achtete genau auf ihre jeweilige Position und Bewaffnung, dann richtete sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Weg.
Sie zogen bergauf, der Boden stieg steil an, der Wald wurde noch dichter, so dass die Merroner gezwungen waren, einzeln hintereinander zu reiten. Die Soldaten, die sie bewachten, waren nichts als verstohlene Schatten in der Finsternis, der Mann an der Spitze schweigsam und unnahbar. Licht fiel in schweren Säulen durch die Wipfel, und Wynter bemerkte, dass es ständig die Richtung wechselte; erst kam es von rechts, dann schien es langsam nach links zu schwenken, schließlich erneut nach rechts. Wir gehen im Kreis, dachte sie. Ein Blick nach hinten zeigte ihr die Tiefe der Schatten, die Undurchdringlichkeit des Waldes. Niemals würden sie den Weg zurück durch dieses Dickicht finden. Nicht ohne Führer.
Christopher ritt hinter ihr. Nachlässig hing er in seinem Sattel und machte den Eindruck, als schenkte er seiner Umgebung kaum Beachtung. Doch gerade als Wynter den Kopf wieder nach vorn drehen wollte, sah sie ihn den linken Arm ausstrecken und einen Ast abbrechen. Die Bewegung war kaum wahrzunehmen, doch der Ast hing nun nach unten und zeigte in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Christopher begegnete ihrem erschrockenen Blick, und seine Augen leuchteten durch ein unverkennbar schelmisches Grinsen.
Verblüfft wandte sich Wynter im Sattel um. Ein paar Augenblicke später ließ Sòlmundr den linken Fuß hervorschnellen, so dass sein Stiefel eine Kerbe in die Rinde eines Baumstamms trieb. Weiter vorn duckte sich Hallvor unter einem Zweig hindurch. Als sie ihn beiseite schob, knickte sie die Spitze ab; das abgebrochene Stück zeigte rein zufällig in die Richtung, aus der sie kamen.
Nach einer kurzen Pause warf Wynter abermals einen Blick über die Schulter auf Christopher. Er blinzelte ihr zu. Wynter musste grinsen und drehte sich nach vorn. Diese Menschen hätten keine Schwierigkeiten, den Weg nach Hause zu finden, ob Alberon nun wollte oder nicht.
Urplötzlich hörten die Bäume auf, und vor ihnen erhob sich ein massiger Erdwall. Eine Schar Männer blickte von oben auf sie herab, die Armbrüste im Anschlag, und die Reisenden fanden sich eingeklemmt zwischen diesen Wachposten und den schweigenden Reitern wieder, die sie hierher geleitet hatten.
Wortlos trabte Alberons Leutnant an der Wache vorbei und verschwand im Lager. Die Merroner ihrerseits mussten sich auf dem engen Fleck zusammendrängen, während die auf dem Wall postierten Männer sie mit kalter Neugier beobachteten. Wynter drängte Ozkar durch die Menge und lenkte ihn Hals an Hals neben Razis Stute.
Razi sah durch einen Spalt in dem Wall, und Wynter spähte an ihm vorbei, um ebenfalls einen Blick auf Alberons Lager zu erhaschen. Dem Anschein nach war es außerordentlich günstig gelegen: Dadurch, dass es sich auf einer Anhöhe befand und sich an seinen Fuß ein Fluss und in seinen Rücken eine steile Felswand schmiegte, war es nicht nur leicht zu verteidigen, sondern auch im Falle einer Flucht leicht zu verlassen.
»Kluger Mann«, brummte Razi.
Wynter gab ihm Recht. Wirklich klug. Albi hatte einen guten Platz ausgesucht.
Sie betrachtete die Soldaten über sich; sie machten einen gut genährten und höchst disziplinierten Eindruck, nicht annähernd das, was man von einem zerlumpten Haufen vor dem Zorn des Königs geflohener Rebellen erwarten würde. Offenbar hatte sich ihr Freund aus Kindertagen zu einem exzellenten Heerführer entwickelt.
Als sie sich nun erneut dem Lager zuwandte, fand Wynter, was sie suchte: Auf der vom Tor am weitesten entfernten Anhöhe stand ein quadratisches Zelt, größer als alle anderen und in einigem Abstand zu ihnen aufgestellt, der einzige Schmuck daran war der an seinem Mittelpfosten flatternde königliche Wimpel. Sie starrte die Leinwand an, als könnte sie Alberon durch ihren bloßen Willen dazu bringen, aus dem Inneren aufzutauchen.
Jetzt kehrte der Leutnant zu den Neuankömmlingen zurück. »Ihr müsst die Waffen ablegen«, sagte er zu Ùlfnaor. »Sagt Euren Leuten, sie sollen alles an den Sätteln befestigen. Euch wird gestattet, durch das Lager zu reiten, aber sobald Ihr das königliche Quartier erreicht, müsst Ihr absteigen.«
Auf Ùlfnaors Nicken hin übersetzte Sòlmundr diese Anweisung, und die Merroner kamen ihr nach. Christopher und Wynter lenkten ihre Pferde zu beiden Seiten Razis, schirmten ihn vor den Blicken der Soldaten ab, so gut es ging, und begannen ebenfalls, sich ihrer Waffen zu entledigen.
»Ich hoffe, sie lassen sich nicht einfallen, uns zu durchsuchen«, raunte Christopher, während er sein Katar an der Satteltasche festband. »Denn ich bezweifle, dass unser brauner Bursche hier als bleicher Herr des Nordens durchginge.«
»Stimmt«, versetzte Wynter.
Jeden Moment rechnete sie damit, dass der Leutnant ihnen befehlen würde, ihre Gesichter zu enthüllen und die Arme auszubreiten, um sich durchsuchen zu lassen. Doch sobald die Merroner ihre Waffen gut sichtbar verstaut hatten, wendete der Leutnant einfach nur sein Pferd und ritt voran ins Lager.
Erstaunt drehte sich Wynter zu Razi, und er sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen über den Schal hinweg an. Sie wurden durchgelassen? Einfach so?
Die Merroner schritten bereits langsam und würdevoll durch die Öffnung im Erdwall, aber Razi und Wynter zögerten weiter. Die einzige Verbindung, die sie seit Beginn dieser ganzen Geschichte zu Alberon gehabt hatten, waren die Meuchelmörder gewesen, die er ganz offensichtlich ausgesandt hatte, um Razis Leben ein Ende zu setzen. Welchen Empfang konnten sie beide hier erwarten, und wie wäre er heute, der Junge, den sie beide einst geliebt hatten und der nun ein Mann war, von dem sie nichts wussten?
Christopher zügelte sein Pferd dicht neben ihnen und sah Razi eindringlich an. »Na, dann mal los«, befand er trocken. »Bisschen spät, es sich jetzt noch anders zu überlegen.«
Razi atmete sehr langsam und hörbar aus. Dann straffte er die Schultern, zog den Hut noch tiefer in die Stirn und trieb sein Pferd durch den Wall in das Heerlager seines Bruders.
Alberon
Sie wurden mitten durch das Lager auf das große Zelt zugeführt, das gewiss Alberons Quartier sein musste. Mit argwöhnischer Bewunderung beäugte Wynter ihre Umgebung; das war keine träge königliche Entourage, schwerfällig durch Luxusgüter und sperrig durch Personal. Nein, dies hier war ein leichtes, klug strukturiertes Feldlager. Es strahlte disziplinierte Beweglichkeit aus, und Wynter war sicher, dass das gesamte Lager innerhalb einer Stunde verpackt und verschwunden sein könnte. Hier spürte man eine unangefochtene Autorität, und Wynter musste zugeben, dass sie beeindruckt war.
Links vom Hauptdurchgang — umgeben von Soldatenzelten und genau unter dem aufmerksamen Auge des königlichen Quartiers — befand sich eine Reihe ziviler Unterkünfte. Wynter entdeckte die leuchtenden Farben der Haunardierjurten, sie sah mit den Symbolen der Comberer bemalte Zelte und einen hellblauen Pavillon, der mit Einhörnern und anderem Firlefanz der Mittelländer verziert war. Haunardier, Mittelländer und Comberer: Vertreter der drei stärksten Gegner des Königreichs, gekommen, um mit Alberon hinter dem Rücken seines Vaters zu verhandeln. Es war schwierig, zu glauben, dass es dafür eine harmlose Erklärung geben konnte.
In feierlicher Formation ritten die Merroner durch das Lager, Ùlfnaor und Sòlmundr an der Spitze. Die beiden Edelmänner ließen ihre Köpfe und Arme unbedeckt, wie es der merronischen Tradition entsprach, doch zu Razis Schutz hielt der Rest des Trupps die Gesichter verhüllt, die Umhänge verbargen größtenteils ihre kostbaren Gewänder. Der Schritt ihrer stämmigen Merronerpferde war so leicht wie der eines gut abgerichteten Arabers, ihre riesigen Kriegshunde trabten mit höfischer Disziplin und Herablassung einher. Keine königliche Gefolgschaft hätte majestätischer aussehen können, fand Wynter.
Die Nachricht ihrer Ankunft sickerte durch das Lager, und zwischen den Soldatenzelten hielten Männer in ihrer Arbeit inne, um sie anzugaffen. Manche schlüpften durch Eingänge, andere kamen um Ecken gerannt, um einen Blick zu erhaschen. In den Quartieren der Zivilisten standen zwei Comberer im Schatten ihres Vordachs und beobachteten die Neuankömmlinge misstrauisch. Als die Merroner näher kamen, verfinsterte sich die Miene des einen angesichts der auf die Pferde gemalten heidnischen Zeichen; er bekreuzigte sich und spuckte aus.
Haunardier waren keine zu sehen, und ihre Unterkünfte machten einen ausgestorbenen Eindruck, die bunten Leinwände wirkten im Abendlicht schwer und reglos.
Etwas erregte Wynters Aufmerksamkeit, eine dunkle Gestalt, die sich zwischen den Soldatenzelten bewegte. Unauffällig lehnte sie sich zurück, um besser sehen zu können, dann erschrak sie über den unerwarteten Anblick eines mittelländischen Priesters, der sich, eine Schüssel in der Hand, einen Weg durch das Lager suchte. Schließlich stieß er ein Stück vor dem Merronertrupp auf den Hauptweg. Dem Anschein nach bemerkte er sie gar nicht, und Wynter sah ihn den von der Kapuze bedeckten Kopf einziehen und durch den niedrigen Eingang des blauen Pavillons ins Innere treten. Sie erschauerte. Im Rahmen seiner diplomatischen Pflichten war Wynters Vater gezwungen gewesen, geraume Zeit am mittelländischen Hofe zuzubringen, daher plagten Wynter einige furchtbare Erinnerungen an die mittelländischen Priester und ihre allzu eifrige Rolle in der dortigen Inquisition.
Sie warf einen Seitenblick auf Razi, der hoheitsvoll auf seiner glänzend schwarzen Stute saß, die Augen auf das stumm wartende königliche Quartier gerichtet. Inzwischen war der Rand des Wegs von Soldaten gesäumt, die ihn unbewusst immer dichter umzingelten. Unwillkürlich tastete Wynters Hand nach dem leeren Gürtel an ihrer Hüfte.
Neben ihr kicherte Christopher. »Ich greife auch ständig danach«, raunte er ihr zu. Vor sich sahen sie Waris Schwerthand ebenfalls nach unten gleiten und zurückzucken, als ihm die leere Scheide wieder einfiel. »Wir sehen so sicher aus«, sagte Christopher. »Dabei sind wir nichts als Enten, die über Eis laufen.«
Sie kamen zum Fuße der Anhöhe, auf der das königliche Quartier stand, und der Leutnant bedeutete ihnen anzuhalten. Es folgte ein Augenblick atemloser Spannung, während dessen die Merroner nach oben blickten; das einzige wahrnehmbare Geräusch war das Klirren des Zaumzeugs und das Schnauben der Pferde. Oben am Hang flatterte und bebte die Leinwand des königlichen Zelts in der schwachen Brise, ein leerer Landkartentisch und Stühle kauerten sich finster unter das Vordach.
Nun drangen Stimmen zu ihnen herab, die Worte waren in der stillen Abendluft nicht auszumachen. Ein Mückennetz wurde am Haupteingang zur Seite gezogen, und zwei Haunardier kamen heraus. Als sie aus dem Schutz des Vordachs traten, blieben sie stehen und zogen sich die bunten Hüte tief in die Stirn. Der Jüngere ließ den Blick über die Baumwipfel schweifen, als wäre er tief in Gedanken, doch sein Gefährte sah den Hügel hinab. Beim Anblick der Merroner erstarrte seine Hand an der Hutkrempe. Er murmelte etwas, woraufhin der jüngere Mann ebenfalls die Augen auf den Fuß der Anhöhe richtete. Lange verharrte er so, sein flaches, honigfarbenes Gesicht war ausdruckslos, die schmalen schwarzen Augen verrieten nichts. Schließlich zog er den Hut nach unten, sagte etwas zu dem älteren Haunardier und marschierte voran den Hang hinunter.
Mit demonstrativer Gleichgültigkeit lief der Altere an ihnen vorbei. Doch der Junge verlangsamte seinen Schritt, als er näher kam, den Blick auf die eindrucksvollen Nordpferde und Razis wundervolle Stute geheftet. Wynter lächelte wissend; die Haunardier waren berüchtigt für ihre Habsucht, was Pferde betraf. Razi täte besser daran, heute Nacht mit den Zügeln in der Hand zu schlafen.
Im Vorbeigehen schielte der junge Haunardier flüchtig nach Wynters verhülltem Gesicht, ging aber weiter. Wynter drehte sich rasch im Sattel um und sah ihm nach. Das ist also ein Haunardier, dachte sie. Wie eigenartig sie von Nahem aussehen.
»Wynter ...? Wynter!« Christopher stupste sie sanft mit dem Fuß an, sie wirbelte erschrocken herum. »Ist er das?«, flüsterte er, den Blick nach oben gerichtet.
Ein Junge von etwa zehn Jahren stand im Eingang des königlichen Zelts — klein, dünn, feines braunes Haar, ganz offensichtlich ein Diener. »Ach, Christopher«, zischte sie mit heftig pochendem Herzen. »Red keinen Unsinn! Sieht der etwa aus wie ein Prinz?«
Auf ein Nicken des Jungen hin sprang der Leutnant vom Pferd, trabte den Hügel hinauf und verschwand im Zelt. Schweigend warteten die Merroner. Kurze Zeit später tauchte der Leutnant wieder auf, kam zu den Ankömmlingen zurück und blinzelte zu Ùlfnaor hinauf, mit der Hand die Augen abschirmend. »Seine königliche Hoheit dankt Euch für Eure Pflichterfüllung«, sagte er. »Ihr möget mir die Dokumente überreichen.«
Wynter erschrak. Einen Moment lang saß Ùlfnaor stocksteif da, blanke Bestürzung im Gesicht. Dann verhärtete sich sein Blick, und er richtete sich mit kalter Miene noch gerader auf. Er sagte kein Wort.
Ungerührt fuhr der Leutnant fort: »Ihr habt meine Erlaubnis, Eure Leute und Pferde ausruhen zu lassen, solange Ihr auf Eure Antwort wartet. Nahrungsmittel werden zur Verfügung stehen, sollten Eure Vorräte knapp sein.«
Ohne jede Spur Achtung in der Miene streckte er die Hand aus, um die Dokumente entgegenzunehmen. Wynter wusste ganz genau, dass er auf Alberons Befehl handelte und dass dies ein bewusster Affront gegen den Merronerführer war. Sie fragte sich nur, ob es ein Hinweis auf Albis Haltung Ùlfnaor selbst gegenüber war oder seine Empfindungen in Bezug auf Marguerite Shirken spiegeln sollte, die Ùlfnaor hier vertrat?
Immer noch blieb Ùlfnaor kalt und schweigsam. Sòlmundr jedoch trieb sein Pferd schnalzend voran und zwang den Leutnant damit rückwärts, bis er in geziemendem Abstand zum Merronerführer stand. Dann zügelte er seine Stute und betrachtete den Soldaten mit der Verachtung, die ein Adler wohl einer Ameise gegenüber zeigen würde.
»Dies ist mein Fürst und Hirte, Ùlfnaor, Aoire an Domhain« , begann er leise. »Er bringt Dokumente von königlicher Prinzessin Marguerite Shirken von Nordländern. Er besitzt Vollmacht zu verhandeln mit königlichem Prinz Alberon der Südländer, im Namen der Prinzessin und aller Merronervölker. Ihr könnt ihn Eurem Herrn ankündigen als Staatsoberhaupt und Angehörigen des Königsgeschlechts der Merronervölker. Dann habt Ihr meine Erlaubnis, uns zum königlichen Prinzen Alberon zu geleiten.«
Der Leutnant zögerte kurz, und Wynter sah ihm an, dass er seine Möglichkeiten abwog. Der Mann tat ihr leid, da er nun in der Klemme saß zwischen der unerschütterlichen Würde der Besucher und den Befehlen seines Herrn. Doch als er sich umdrehte, um die kalten Gesichter der Merroner zu mustern, hielt das Mitgefühl Wynter nicht davon ab, wie die anderen die Schultern zu straffen und ihn mit all der ihr zur Verfügung stehenden hochmütigen Herablassung anzusehen. Daraufhin machte der Leutnant auf dem Absatz kehrt und ging zurück zu Alberons Zelt.
Sobald der Soldat außer Sichtweite war, drehte sich Ùlfnaor zu Razi um. Deutlich stand die Frage in sein Gesicht geschrieben: Wenn das hier so verläuft wie von uns erwartet, soll ich handeln, wie wir es besprochen haben?
Razi nickte, und Ùlfnaor wandte sich dem Leutnant zu, der erneut auftauchte. Es war jemand bei ihm, und Wynters Herz machte einen Satz. Oliver! Du lieber Gott, es war Oliver.
Razis Hand umfasste den Sattelknopf fester, und Wynter bemerkte, dass er sich leicht nach vorn lehnte, als der Mann, den sie früher »Onkel« genannt hatten, langsam den Weg zu ihnen nach unten antrat.
Fünf Jahre war es her, dass Wynter Oliver zuletzt gesehen hatte, doch er kam ihr nicht sehr verändert vor. Er war kleiner als König Jonathon, das dunkle Haar fein und glatt, doch er hatte dieselben lebhaften blauen Augen wie sein königlicher Cousin, dieselbe athletische Statur. Allerdings war er jetzt dünn, sein Gesicht zu alt und die Augen müde. Als Oliver auf die wartenden Merroner zulief, erinnerte sich Wynter traurig an die große Güte dieses Mannes, an seinen Sinn für Schelmerei. Sie waren solch gute Freunde gewesen, Oliver, Jonathon und ihr Vater. Er war ein so treuer Untertan gewesen. Was war nur geschehen, dass er sich heimlich gegen den König verschwor und Jonathons Feinde an seinen Tisch lud?
Oliver blieb neben Sölmundrs Pferd stehen, und Wynter spürte kalte Entschlossenheit in ihrem Herzen aufwallen und die zärtlichen Erinnerungen zurückdrängen. »Onkel« oder nicht, dieser Mann war jetzt ein Verräter an Jonathons Thron. Er hatte wissentlich wider den König gehandelt, und er hatte den Erben des Königs dazu verleitet, es ihm gleichzutun. Oder zumindest hatte er doch einiges zu erklären.
»Ihr weigert Euch, die königlichen Dokumente auszuhändigen?« , fragte Oliver. Sein Hadrisch war tadellos, die vornehme Stimme kühl.
Sòlmundr setzte zu einer Entgegnung an, doch Ùlfnaor hinderte ihn mit erhobener Hand daran. Also neigte der Krieger den Kopf und lenkte sein Pferd zurück in die Formation.
»In meinem Herzen ich bin gewiss, dass es einen Irrtum gab bei der Übermittlung meiner Botschaft an den königlichen Prinzen«, begann Ùlfnaor ruhig. »Gewiss bin ich deshalb, weil der königliche Prinz, hätte er gewusst, dass ich Gesandter der königlichen Prinzessin und auch befugt bin, für mein Volk zu verhandeln, mich in Ehren begrüßt und mit Achtung behandelt hätte, von einem Staatsoberhaupt zum anderen, mit der Würde und edlen Gesinnung eines Mannes, der dazu bestimmt ist, König seines Volkes zu sein.« Bei diesen Worten schürzte Oliver die Lippen, doch Ùlfnaor blickte ihm unbeirrt in die Augen. »Und daher«, sprach er weiter, »werde ich meinem Stellvertreter noch einmal gestatten, mich vorzustellen, in dem Wissen, dass es dieses Mal keinen Irrtum mehr wird geben.«
Erneut trieb Sòlmundr sein Pferd voran, erneut stellte er den Merronerführer vor, und erneut wartete Ùlfnaor. Dieses Mal verbeugte sich Oliver, und der Leutnant tat es ihm manierlich nach.
»Fürst Ùlfnaor«, sagte Oliver, immer noch ab der Taille nach vorn gebeugt. »Vergebt mir. Uns war ein einfacher Bote angekündigt worden, kein diplomatischer Vertreter. Ich fürchte, wir waren schlecht vorbereitet. Hätte der königliche Prinz gewusst ...«
»Ist nicht von Bedeutung. Ich vergebe. Wir fahren fort.«
Oliver richtete sich auf »Leider ist seine königliche Hoheit sehr beschäftigt. Er bittet Euch, ihm zu verzeihen und die Dokumente auszuhändigen. Sobald es seine Zeit erlaubt, wird er mit Euch sprechen.«
Wynter schloss kurz die Augen und schüttelte den Kopf. So sollte es also sein. Nach allem, was er getan hatte, um hierherzugelangen, nach allem, was er zu opfern gezwungen gewesen war, stellte sich nun ziemlich klar heraus, dass Ùlfnaor wohl keine Gelegenheit bekäme, für sein Volk zu
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel The Rebel Prince bei O’Brien Press, Dublin
Copyright © 2010 by Celine Kiernan Copyright © 2012 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Catherine Beck
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München, unter Verwendung eines Fotos von Dragan Todorovic/Flickr/Gettylmages
Satz: Leingärtner, Nabburg
eISBN 978-3-641-08233-8
www. heyne-magische-bestseller.de
www.randomhouse.de
Leseprobe





























