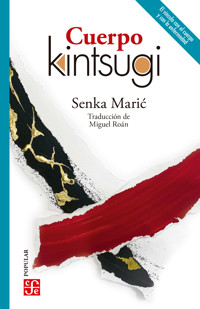Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: eta Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der japanischen Kunsttechnik Kintsugi wird zerbrochene Keramik mit flüssigem Gold repariert. Statt sie zu kaschieren, werden die beschädigten Stellen noch betont, seine Brüche machen den schöner. In "Körper-Kintsugi" setzt die Protagonistin den Krebszellen in ihren Brüsten einen starken Überlebenswillen entgegen. Persönlich und eindringlich erzählt Senka Marić vom Kampf um Würde und Schönheit, auch wenn der Körper in zahlreichen Operationen zerschnitten und durch Chemotherapien beinahe zerstört wird. In kurzen, eingestreuten Szenen zeichnet die Figur ihre schmerzvolle Erinnerungen an das Heranwachsen in einer patriarchalen Gesellschaft nach, von denen sie sich durch ihre Auseinandersetzung mit der als "weiblich" verstandenen und mit viel Scham und Tabu belegten Krankheit zu befreien vermag. Ein kämpferischer Text voller Stärke und Kraft, hart zu lesen, aber letztendlich Mut machend.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Senka Marić
KÖRPER-KINTSUGI
Aus dem Bosnischen von
Marie Alpermann
1. Auflage 2021 © eta VerlagAlle Rechte vorbehalten
eta Verlag | Petya LundSchönhauser Allee 26 10435 Berlin www.eta-verlag.de [email protected]
Aus dem Bosnischen übersetzt von Marie Alpermann Lektorat: Anne Grunwald Korrektorat: Anna-Maria Reichardt Gestaltung & Satz: Stefan Müssigbrodt Titelfoto: Marco Montalti /Shutterstock
© Senka Marić, 2018 This translation of Kintsugi tijela is published by arrangement with Ampi Margini Literary Agency and with the authorization of Senka Marić.
ISBN 978-3-949249-06-8
Senka Marić |
KÖRPER- KINTSUGI
Die Herausgabe dieses Werks wurde gefördert durch TRADUKI, ein literarisches Netzwerk, dem das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich, das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland, die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, die Interessengemeinschaft Übersetzerinnen Übersetzer (Literaturhaus Wien) im Auftrag des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport der Republik Österreich, das Goethe-Institut, die S. Fischer Stiftung, die Slowenische Buchagentur, das Ministerium für Kultur und Medien der Republik Kroatien, das Ministerium für Gesellschaft und Kultur des Fürstentums Liechtenstein, die Kulturstiftung Liechtenstein, das Ministerium für Kultur der Republik Albanien, das Ministerium für Kultur und Information der Republik Serbien, das Ministerium für Kultur Rumäniens, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Sport von Montenegro, die Leipziger Buchmesse, das Ministerium für Kultur der Republik Nordmazedonien und das Ministerium für Kultur der Republik Bulgarien angehören.
Die Übersetzung dieses Buches wurde mit einem Perewest-Stipendium gefördert.
Kintsugi ist eine japanische Kunsttechnik, bei der zerbrochene Keramik mit flüssigem Gold oder Platin repariert wird: Man betont die beschädigten Stellen, weil die Geschichte des Gegenstandes hervorgehoben werden soll, statt sie zu kaschieren, was dem Prinzip des Wabi-Sabi nahesteht, und entdeckt die Schönheit der beschädigten und alten Dinge. Durch das Hervorheben der Schäden und Brüche feiert Kintsugi die einzigartige Geschichte eines jeden Gegenstandes, schenkt ihm neues Leben und eine größere Schönheit, als er anfangs besaß. Kintsugi ist aus dem japanischen Gefühl Mottainai – dem Trauern um Verlorenes – wie auch aus Mushin – dem Akzeptieren von Veränderung – entstanden. Die moderne Kunst experimentiert mit dieser alten Technik und thematisiert damit Ideen des Verlusts, der Synthese und der Verbesserung durch fortlaufende Zerstörung und Erneuerung.
»Aber wer kann sich an Schmerzen erinnern, wenn sie vorbei sind? Alles, was davon bleibt, ist ein Schatten, und nicht einmal in der Erinnerung, sondern im Körper. Der Schmerz zeichnet dich, aber zu tief, als dass du es sehen könntest. Aus den Augen, aus dem Sinn.«
Margaret Atwood1
»Außer den Göttern nämlich, wer
Ist alle Zeit des Lebens frei von Ungemach?
Spräche ich von der Pein … – nichts war,
Worüber wir nicht stöhnten, aller Güter bar.«
Aischylos2
Wenn ich die müden Lider schließe, öffnet sich ein reiner weißer Raum
In der Mitte wie ein Baum ein Körper
Aus ihm, aus Rasierklingenschnitten,
quollen Geschichten
Der Körper im Krampf, die Geschichten entspannen, lassen Druck entweichen
Ganz einfach:
Unter dem Blick reißt die Haut und alles Verborgene entfließt …
Text wie Wasser, ergießt sich in Kreisen um meine verspielten Füße, formbar wie Teig, ich drücke mit den Fingern hinein, meine Brüste beben, ich knete, jeden Tag vervollkommne ich das Rezept, immer neue Zutaten,
es duftet nach Äpfeln und rosa Samtglasur. Glück.
Nicht einen Augenblick vergesse ich, dass mein Körper ewig ist.
Der Sommer 2014 wurde von drei Ereignissen bestimmt.
Am siebzehnten Juni, nur wenige Tage nach dem Nachmittag, den ihr sitzend auf dem Ehebett verbrachtet – in dem ihr seit über einem Jahr nicht mehr gemeinsam geschlafen hattet –, auf die Leere der weißen Wand vor euch starrend, in einer Stille, die nur selten von ein paar müden Worten unterbrochen wurde, verstaute dein Mann seine Kleider in zwei großen Sporttaschen. Die dritte holtest du selbst aus der Abstellkammer, legtest zwei Garnituren Bettwäsche für eine Person hinein, dazu ein Kissen, eine Frotteedecke, drei kleine und zwei große Handtücher. Beim Schließen der Tasche dachtest du an den kommenden Winter. Du gingst zurück in die Abstellkammer, wo du fünf Minuten nach einer großen Tüte suchtest, um die Steppdecke hineinzustopfen. Überall im Flur standen Sachen herum. Ein paar Mal setzte er an, etwas zu sagen. Ließ es jedoch sein, sobald er dich schnaufend mit den Händen in den Hüften dastehen sah. Es gelang ihm, die Tüte und alle drei Taschen auf einmal zu nehmen. Er blickte zu Boden, während er die Wohnung verließ und die Treppe hinunter zum Taxi eilte, das bereits vor der Haustür wartete. Danach saßt du lange, lange allein vor dieser nackten Wand und begriffst langsam, es war kein Gefühl von Leere, das er hinterlassen hatte, bloß das Gefühl von Niederlage.
Am fünfzehnten Juli fing deine linke Schulter an zu schmerzen. Vor allem nachts. Du kannst nicht schlafen, also sitzt du im Bett und weinst. Wie sich herausstellt, ist in der Schulter eine Kalzinose – eine spitze Kalkablagerung, die das umliegende Gewebe verletzt und eine Entzündung hervorgerufen hat. Der Arzt sagt, du könnest nur Schmerztabletten nehmen und warten, bis es vorbeigehe. Doch du hasst Warten. Und du hasst Medikamente. Sie stehen im Widerspruch zu deinem Bedürfnis, alles kontrollieren zu wollen, zu deiner Unfähigkeit, einem Menschen so zu vertrauen, dass du ihn um Hilfe bitten würdest. Du verringerst die Dosis immer weiter. Nimmst die Hälfte von dem, was dir verschrieben wurde. In diesem heißen Juli gibt es in deiner Welt nichts als Schmerz. Wie Staub bedeckt er deine Zeit, die sich weigert zu verstreichen. Du hast dir ein Tuch um den Hals gebunden. Hast deine linke Hand darin eingehängt. Damit sie sich nicht bewegt. Möglichst wenig wehtut. Das Einzige, woran du denkst, ist, dass du stärker bist als der Schmerz. Hartnäckiger als er. Er wird vorbeigehen – ich bleibe. Du denkst auch ein bisschen daran, wie unglücklich du doch bist, wie sich seit Jahren schlechte Dinge aneinanderreihen, eines nach dem anderen. Es hört einfach nicht auf. Liegt es vielleicht an meinem Glauben, ich könne das, ich sei stärker? Wenn ich schrie: »Es reicht!« Würde es aufhören? Würde diese Walze, die alles vor sich zermalmt, von deiner Lebensbahn weichen? Es ist Nacht. Es ist heiß. Die Kinder schlafen. Die perfekte Zeit für dich zu weinen. Zu schreien: Es reicht! Ich kann nicht mehr! Doch in deinem tiefsten Inneren glaubst du dir nicht. Du weißt, du kannst noch.
Sechsundzwanzigster August. Es tut ein bisschen weniger weh. Du schaffst es sogar zu schlafen. Du musst sehr vorsichtig sein im Bett. Eine falsche Bewegung genügt und du endest in Agonie. Beim Drehen von der rechten auf die linke Seite fasst du dir, um die Schulter zu fixieren, mit der linken Hand fest unter die rechte Achsel. Ein Teil der Hand liegt auf der rechten Brust. Während du dich nach links drehst, langsam über den Rücken zur linken Seite, gleitet deine Hand zurück. Die im Fleisch vergrabenen Finger rutschen über die rechte Brust. Und da spürst du ihn. Dort, seitlich, am Rand der Brust, fast neben ihr. Wie ein Kieselstein, der sich im Bikinioberteil versteckt hat.
Du lässt die Hand sinken. Liegst auf dem Rücken. Siehst zur Decke. Den Schmerz in der Schulter spürst du nicht, nur dein Herz im Hals. Du richtest dich im Bett auf und tastest noch einmal. Er ist noch immer da, bewegt sich leicht unter dem Druck deiner Finger. Du nimmst die Hand wieder weg und legst dich auf den Rücken. Du kannst deine Augen nicht schließen. Du blinzelst nicht. Sie sind weit aufgerissen und verschlingen die Decke. Das Haus ändert seine Form und Dimensionen. Es krümmt sich. Schwappt in deine Augen. Mit ihm auch die Stadt, die sie umschließenden Berge, der Fluss, der versucht von ihr wegzufließen, das Meer, Kilometer um Kilometer des Landes, der ganze Kontinent krümmt sich wie eine Tüte heißer, rußiger Maronen, bis nichts mehr übrig bleibt als der tote schwarze Himmel.
Aber ich muss mich geirrt haben!
Du stehst wieder auf und tastest nach der Stelle. Dein Atem erfüllt das Zimmer. Prallt von den Wänden ab. Erhellt die Sommernacht. Der rundliche Knoten weicht unter dem Druck deiner Finger zurück (diese Berührung ist in dein Fingergedächtnis für immer eingebrannt). Die Panik ist Schlamm. Schwappt in deinen Mund. Die Nacht verschlingt dich.
Du beschließt, dieses Bild zu zerschlagen. Wie einen Spiegel, in den ein Stein geworfen wird. Zurück bleibt nur das dumpfe Gefühl, dass dir noch nicht mal richtig bewusst ist, was dir alles genommen wurde.
Dein Atem beruhigt sich. Geht langsam, unhörbar. Du sagst: Du schläfst jetzt. Denkst an nichts. Es geht leicht. Deine Gedanken sind ohnehin viel zu zerstreut. Du befindest dich irgendwo jenseits der Worte, jenseits von Sinn und Bedeutung. Nur deine Haut spürst du deutlich, die Grenze, die ihr euch teilt, du und die Welt. Du schläfst bis zum nächsten Morgen einen Schlaf, der nie absoluter, nie bewusstloser war, um dann festzustellen, dass der kleine Knoten in deiner Brust den Schmerz in der Schulter verdrängt hat.
Wie erzählt man eine Geschichte, die auf der Zunge zerfällt und sich weigert, eine feste Form anzunehmen?
Wusstest du an jenem Tag vor sechzehn Jahren, als deiner Mutter die Diagnose gestellt wurde, dass du Krebs bekommen wirst?
Oder:
Warst du seit jenem Tag vor sechzehn Jahren, als deiner Mutter die Diagnose gestellt wurde, überzeugt, dass du niemals Krebs bekommen wirst?
Beides ist gleichermaßen wahr. Die Pünktchen, die sich nebeneinander anordnen, um den Moment vor so vielen Jahren zu fassen zu kriegen, sind zwei Ketten, die ein perfektes Oval bilden und so die geradlinige Logik der Zeit zerlegen. Zwei parallele Wirklichkeiten, von denen eine erst in dem Moment tatsächlich real wird, in dem sie an ihr Ziel gelangt. Du wusstest, du bekommst ihn, und warst doch überzeugt, ihn niemals zu bekommen. Die Gegenwart macht die Vergangenheit rückwirkend wahr. Du bist gefangen in einer Realität, die nicht zugibt, dass sie jemals anders hätte sein können.
Warst du ein trauriges Kind? Heute scheint es dir so. Es fehlte dir an nichts, und trotzdem konntest du das Gefühl nie loswerden, alles stünde ein wenig schief, in allem lauerte etwas Finsteres, Schweres. Zugleich glaubtest du all die Zeit über zu wissen, dass du einmal glücklich sein wirst. Weil du für das Glück vorherbestimmt bist. In einer Welt, in der es kein Glück gibt.
Lässt sich der Punkt ausmachen, welcher wie ein Messer in das Fleisch der Zeit schneidet und den Weg bestimmt, der dich bis zu diesem Augenblick geführt hat?
Du bist klein. Du sitzt in Opas Arbeitszimmer unter dem Tisch. Ob du dich versteckt hast, weißt du jetzt nicht mehr. Du erinnerst dich weder, was davor, noch, was danach passiert ist. Du hast ein rot-grün kariertes Kleid und dicke Strumpfhosen an. Du fühlst dich dreckig. Schlecht. Die Strumpfhosen sind weiß. An den Füßen sind verräterische graue Spuren zu sehen. Dein Haar ist braun. Ob es stimmt, weißt du jetzt nicht mehr, aber du glaubst dich zu erinnern, dass es fettig und verklebt ist. Über dieses Bild legt sich das Bild einer Katze, die aus dem Dunkel eines verlassenen Kellers kommt. Berühren wolltest du sie nicht. Doch das Kind unter dem Tisch (bist das wirklich du?) sehnt sich nach Berührung. Opas Zimmer befindet sich im Erdgeschoss. Küche und Wohnzimmer einen Stock höher. Alle sind immer oben. Warum bist du unten allein? Zumal du Angst hast vor dem Zi******, der kommen und dich klauen könnte. Er sieht aus wie Sandokan, nur nicht in Farbe. Eine merkwürdige Schwarz-Weiß-Figur, die sich in euer Haus stiehlt, hinter den Vorhängen unter der Treppe versteckt hält und auf dich wartet. Du bist imstande, aus Opas Zimmer direkt auf die Treppe zu springen. Sandokan kann dich nicht erwischen. Du rennst nach oben. Da ist Oma, in der Küche. Der Schnellkochtopf zischt. Schüsseln klappern. Schwerer Essensgeruch hängt in der Luft. Du willst keine Suppe essen. Du willst überhaupt nichts essen. Oma bewegt sich unglaublich schnell, jongliert mit Tellern und Pfannen. Sie dreht sich in ihrem blauen ärmellosen Kleid im Kreis. Sieht dich nicht. Doch dir ist leichter zumute, weil sie da ist.
In deiner Erinnerung steht von diesem ganzen Haus bloß die Küche unbeschädigt da. Wie der Turm eines verzauberten Schlosses. Eine Wand ist komplett verglast. Gleißendes Licht. Niemals vergisst du die Dunkelheit und die Stille, die unten wüten, darunter. Im Licht bist du noch dreckiger.
Du öffnetest die Augen nicht sofort. Du lagst da. Wartetest. Glaubtest, so würde sich alles in Luft auflösen. Vögel zwitscherten und du warst froh, dass Sommer war und die Fensterscheibe dich nicht von der Welt trennte. Du bist aufgestanden und ins Bad gegangen, hast dich lange abgeduscht. Deine Hand umschiffte zunächst die Stelle. Vielleicht ist er doch nicht da, dachtest du, vielleicht war alles ein Irrtum. Du würdest deine Freundinnen anrufen. Ihr würdet euch auf einen Guten-Morgen-Kaffee treffen. Stattdessen Wein trinken, oder Whiskey, oder Kirschlikör, vollkommen egal. Ihr würdet euch laut zuprosten. Über das Geschoss lachen, das an deinem Kopf vorbeigeschwirrt ist, dich völlig verfehlt hat.
Das Knötchen ist immer noch da. Unerbittlich anwesend. Elastischer als gestern Abend. Unter deiner nassen Haut zum Tanzen aufgelegt.
Du ziehst das lilafarbene Kleid aus dem Schrank, eines der schönsten in deinem Besitz, mit freiliegenden Schultern, trägerlos. Es fällt über deine schönen, prallen Brüste bis hinunter zu den Knien. Du bindest dein Haar zusammen. Schminkst dich. Findest dich schön. Du siehst, wie die Kinder schlafen, von der Augusthitze berauscht, durch die leichte Frische des frühen Morgen beruhigt, und gehst zu deinem Hausarzt.
Als du zu sprechen beginnst, merkst du, dass du zu schnell redest. Oder nicht schnell genug. Als wäre der Tag zu zähflüssig, um deine Worte aufzunehmen. Du streifst den oberen Teil des Kleids ab. Schweigst, während er deine Brüste abtastet. Zusammengekniffene Lippen, erhobene Augenbrauen. Er nickt langsam, senkt den Blick. Du bekommst ein flaues Gefühl im Magen. An diesem Punkt der Reise hätte man dich zurück nach Hause schicken sollen. Du hattest fest mit dieser Station gerechnet, von der aus dein Leben wieder in den bekannten Lauf münden sollte. In den Telefonanruf, die Einladung zum Kaffeetrinken ohne Kaffee. In die Feier, weil du dem Geschoss entkommen bist. In den Augenblick kristallklaren Bewusstseins, was du alles falsch gemacht hast und nie wieder so machen würdest. Du würdest jene lieben, die deine Liebe verdienen. Dich gesund ernähren. Yoga machen. Den Tag fühlen.
Der Arzt schrieb dir eine Überweisung und schickte dich ins Krankenhaus.
Dort waren zwei Ärzte. Einer, der nicht sicher war, was er von den vielen schwarz-weißen Pünktchen halten sollte, die im Ultraschallgerät das Innere deiner Brüste abbilden. Dann ein Zweiter, den der Erste gerufen hatte. Er gab eine neue Schicht kaltes Gel auf deine Brust und kreiste mit der Ultraschallsonde darüber. Sie waren sich einig, dass du nichts hast. Der Zweite sagte dir, du sollest den Befund der Routineuntersuchung von vor sechs Monaten, der vollkommen in Ordnung gewesen sei, mitbringen und einen Mammografie-Termin in einem Jahr vereinbaren.
Du trittst aus der Klinik nach draußen. Vielleicht weißt du es bereits und deine Hände zittern. Dir ist nach Weinen zumute, du willst aber nicht, dass deine Mascara verwischt. Du möchtest weiterhin schön sein. Befiehlst dir selbst zu schweigen, obwohl im Mund keine Worte sind. Du sagst zu dir: Mal nicht gleich den Teufel an die Wand! Schau nicht in den dunklen Abgrund! Kehr dem Abyssus den Rücken! Du setzt dich ins Auto und fährst los, ohne zu wissen wohin.
Da erblickst du ihn auf der Straße. Den Radiologen, dem du schon seit Jahren deine Brüste anvertraust, fest entschlossen, mit regelmäßigen Kontrollen die Krankheit zu überlisten, die den Körper deiner Mutter verwüstet hat. Vor einer Stunde hast du ihn in den Krankenhausfluren gesucht, sie sagten dir, er sei nicht da. Jetzt hältst du mitten auf der Straße an, zwischen all den schnell fahrenden Autos, und rennst ihm hinterher. Ich weiß, dass ich verrückt bin, sagst du ihm, entschuldigst dich, denn die anderen hätten schließlich gesagt, du habest nichts. Du aber weißt es schon, du fühlst den Stein unter deiner Haut, dieses Schluchzen des Gewebes, das den Schmerz nicht mehr aushält, den du schweigend hinunterwürgst wie ein fades Mittagessen in fremdem Hause. Er lächelt und sagt, du sollest dir keine Sorgen machen. Er erwarte dich um drei Uhr nachmittags in seinem Behandlungszimmer. Alles Weitere würdet ihr dann sehen. Ganz bestimmt werde alles in Ordnung sein. Du weißt, er kann überhaupt nicht wissen, was er da sagt. Doch du bist beruhigt, weil er dich nicht nach Hause schicken und dir sagen wird, dass du in einem Jahr wiederkommen sollst, ohne weiter an dich zu denken.
Als du das Zimmer betratst, am fünfzehnten September, sagte er: Bist du wirklich allein gekommen? Vier Tage zuvor hatte er bei dir ein MRT und eine Biopsie gemacht. Der Befund sollte circa fünfzehn Tage dauern. Als er per Ultraschall mit deinem Knötchen Bekanntschaft machte, an dem gleichen Tag, an dem du auf der Straße hinter ihm hergerannt warst, war er sich sicher, es sei nichts. Es sehe gutartig aus. Vor sechs Monaten sei hier nichts gewesen. Trotzdem machen wir wegen der Anamnese deiner Familie sicherheitshalber noch ein MRT und eine Biopsie. Aber keine Sorge. Es sieht gut aus! Ihr würdet den besten Zeitpunkt abwarten, zwischen dem siebten und zwölften Tag des Menstruationszyklus, um alle Untersuchungen zu machen.
Vor vier Tagen, beim Termin fürs MRT, hatte er nichts zu dir gesagt. Er vermied es, dir in die Augen zu sehen. Murmelte vor sich hin, er habe gerade viel zu tun. Wenig Zeit. Er werde sich melden, sobald der Biopsie-Befund da sei. Kurz davor hattest du beobachtet, wie er ins MRT-Zimmer gegangen war und sich deine Aufnahmen angesehen hatte. Ganze fünf Minuten lang. Später, als er die Biopsie machte und die Nadel in deinen Körper stieß, um winzige Stückchen des Knotens herauszuholen (oh, was für ein brutal stumpfes und endgültiges Geräusch), spracht ihr über eure Töchter, die im gleichen Alter sind, über Yoga und den vorbeigehenden Sommer. Über das andere schwiegt ihr, während du auf dem schmalen Bett lagst, mit einem grünen Tuch bedeckt, und tief ein- und ausatmetest. An den darauffolgenden vier Tagen dachtest du an gar nichts. Du hast dir Zeit gelassen mit der Angst.
Am Montagmorgen um zehn Uhr ruft dich die Krankenschwester an und bittet dich, um elf in sein Behandlungszimmer zu kommen. Die Minuten sind ein langsam durchgeseihter Überfluss der Ewigkeit. Gemächlich ziehst du dich an. Schminkst dich lang und sorgfältig. Machst deine Frisur zurecht. Steckst dir Ring und Ohrringe an. Du setzt dich ins Auto und fährst zum Krankenhaus.
»Ja, ich bin wirklich allein gekommen«, sagtest du und lächeltest sogar dabei.
»Ich habe eine schlechte, aber auch eine gute Nachricht«, sagte er und sah dir endlich in die Augen.
»Dann die schlechte zuerst«, sagtest du.
Mut war das nicht.
»Es ist ein Karzinom.«
»Okay«, sagtest du, »okay.«
Etwas in dir wollte aufschreien, in Tränen ausbrechen. Doch das alles zusammen: das Zimmer im Erdgeschoss des städtischen Krankenhauses, der große Tisch in seinem Rücken mit dem riesigen Monitor, der zwanzig Bilder deines Brustinneren zeigt, der große schwarze Stuhl, auf dem er sich hin und her bewegt, ein wenig nach links, ein wenig nach rechts, du auf der niedrigen Couch gegenüber, die Hände ineinander gelegt auf deinen Knien, ein stechend blauer Himmel, der durch die Spalte der Jalousien dringt, das Winseln von Gummisohlen auf dem Linoleum im Flur, all das schien nicht ausreichend wahr zu sein, wie ein Fehler in der Wirklichkeit, der jeden Moment korrigiert werden würde. Und alles käme zurück an seinen Platz.
»Aber rechtzeitig erkannt.« Das war die gute Nachricht.
»Gut«, sagtest du, »gut.«