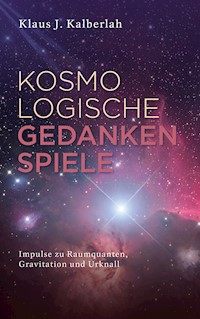
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Überlegungen zur Weiterentwicklung von Albert Einsteins Verständnis des Universums: Die heute weithin anerkannten Standardmodelle der Kosmologie sind weit entfernt von einem schlüssigen geschlossenen Gedankensystem, von dem bereits Albert Einstein träumte. In diesem Buch macht sich der Autor auf die Suche nach einem solchen geschlossenen System, das auch mit der Quantenphysik ausgesöhnt wäre. Die grundlegenden Strukturelemente seines integrierenden Gesamtansatzes sind die Stringtheorie, das Verständnis des Kosmos als vierdimensionaler Raum und das Emergenz-Prinzip. Mit seinen anregenden Überlegungen und seinem neuen Wissenschaftsverständnis fordert er zu Weiterführungen und Diskussionen in der kosmologischen Fachwelt heraus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort des Herausgebers
Prolog
Einführung
Teil I: Ein unbefriedigendes Ende
Die noch immer geheimnisvolle Schwerkraft
Schwerkraft, klassisch
Schwerkraft nach Newton
Der Michelson-Morley-Versuch begräbt den Lichtäther
Das gravitative Feld
Schwerkraft nach Einstein – eine erste Sicht
Schwerkraft nach Einstein – der neue Äther
Die Konsequenz?
Der Urknall und sein angeblicher Zeuge
Prinzipien der Standardtheorie
Urmaterie mit unendlicher Dichte
Woher kommt die Energie?
Interpretation der Mikrowellenhintergrundstrahlung (CMB
)
Alter des Weltalls
Inflation
Entstehung der Galaxien im Zeitablauf
Prinzipien der „steady-state“-Theorie
Ein Knall im dreidimensionalen Raum?
Dimensionalität der Expansion des Universums
Die Konsequenz?
Botenteilchen mit Tarnkappe
Die starke Kernkraft als eine der Elementarkräfte
Quantengravitation
Die Konsequenz?
Teil II: Umdenken erforderlich!
„Natur“ und „Beschreibung der Natur“ sind etwas anderes
Ob ich mich mit einer Theorie der „Wirklichkeit“ annähere, weiß ich nicht
Mathematik ist ein guter Helfer, der aber verschiedenen Herren dient
Noch fehlende Falsifizierbarkeit darf nicht von der Theoriebildung abschrecken
Begrenztes menschliches Vorstellungsvermögen
Manche Dinge sind im Rahmen der Naturwissenschaften nicht beantwortbar
Teil III: Schlüsselprinzipien eines integrierten Modells
Der mehrdimensionale Raum
Geometrie des Weltalls: Das Omniversum als Hyperkugel
Luftballonmodell mit Geldmünzen
Modifizierte Stringtheorie
Wie sieht ein String aus?
Vorteile der modifizierten String-Theorie
Emergenz und Reduktionismus
Teil IV: Ein integrierendes Modell
Der neue (String-)Äther
Schwingungscharakteristik von Materie, Strahlung und Vakuum
Raum und Äther, begrifflich
Die vierte Dimension (Schwingen in w-Richtung)
Gravitation ohne Quantengravitation im String-Äther
Entstehung von Sternen aus einer Gaswolke
Stichwort Gravitationswellen
Felder als Zustand des String-Äthers
Materie und Elementarkräfte als Zustand des String-Äthers
Exkurs: Stringtheorie und Ladung – eine Spekulation
Zusammenfassende Einordnung
Ein modifizierter Urknall
Geometrie des Kosmos im integrierenden Modell
Prinzipien eines Wachstumsmodells
Anfangsbedingungen in den „ersten drei Minuten“ im vierdimensionalen Raum
Das Rätsel der Energie
Kreisprozesse
Ein nicht-leeres Vakuum kann auch ein String-Äther-Vakuum sein
Äquivalenz von Energie und Masse im 4-D-Omniversum
Eine andere Erklärung für die kosmische Hintergrundstrahlung (CMB)
Die Folgen des neuen Ansatzes
Teil V: Der wiedergefundene Faden
Vorwort des Herausgebers
Im Januar 2020 erhielt ich von Klaus Joachim Kalberlah, dem Autor dieses Buches, einen Anruf mit der Bitte um einen mehrtägigen Besuch. Als ich in seiner Wohnung in Nuthe-Urstromtal eintraf, gab er mir einen USB-Stick mit über 100 Textdateien, zeigte mir mehrere Aktenordner mit handschriftlichen Notizen und verwies mich auf ein Bücherregal mit Fachliteratur mit der Bitte: „Ich wünsche mir von Dir, dass Du versuchst, mein Buchmanuskript zur Kosmologie nach meinem Tod zu veröffentlichen.“ Ich sagte zu. Am 2. Februar 2020 verstarb mein Bruder.
Zuvor blieb ich für eine Woche täglicher Seminare am Krankenbett im Brandenburgischen. Mit erstaunlicher Klarheit und Lebendigkeit, mit Offenheit für meine Fragen und vor allem mit einer großen Begeisterung für die Thematik erläuterte mir Klaus Kalberlah seine zentralen Ideen bis in die letzten Januartage.
Mir wurde klar, dass ich mir trotz aller Erläuterungen die Fachkompetenz für diese äußerst komplexe Thematik nicht in dem Maße aneignen konnte, um selbst die Argumentation zu führen, zu erweitern oder die Erkenntnisse des Autors mit kritischem Abstand zu interpretieren. Aber das schien mir schließlich auch nicht erforderlich; ich sollte das Buch herausgeben – das Material war da und das Material war gut! Die Herausgabe würde Lektoratsarbeit bedeuten, Umstellungen, Kürzungen, und im Zweifel dort Prioritäten in der Textauswahl zu setzen, wo ich nun lernen konnte, dass es dem Autor ein besonders wichtiges Thema war. Wenn ich als Wissenschaftler eines gelernt hatte, war es das, solche Texten systematisch und ohne meine subjektive Sicht der Dinge zur Publikationsreife zu bringen.
Die Herausgeberarbeit führte mich zu erstaunlichen Erkenntnissen: Obwohl ich mich zuvor kaum mit der Thematik der Kosmologie, des Urknalls oder der Elementarteilchen in der Physik beschäftigt hatte, wurde das Thema für mich äußerst spannend und reizvoll. Vielleicht auch deshalb, weil Klaus Kalberlah durch seine wissenschaftstheoretische Herangehensweise eine zusätzliche Ebene in diese Arbeit zur Kosmologie in seinen Texten lebendig werden ließ: „Verwechsle nicht Beschreibung einer physikalischen Theorie mit physikalischer Realität!“ und „Unterscheide Denkgewohnheit von Denknotwendigkeit!“. Diese kritische Kreativität hat es ihm ermöglicht, wirklich neue Ideen zu entwickeln und manche aus der Physiker- und Kosmologenzunft oft blind übernommene Regel überzeugend in Frage zu stellen. Das hat mich angesteckt!
Allerdings musste ich auch lernen, dass eine Woche intensiver Kosmologiekurs mir natürlich noch nicht zeigen konnten, wo im Text dann doch Fragen auftraten, die es mir unmöglich machen würden, aus dem Material einen vollends schlüssigen Text zu formen, der der Aussage des Autors entsprochen hätte. Es gab Lücken und Verkürzungen in den Manuskripten, die für mich nicht angemessen interpretierbar waren. Ich habe mich deshalb entschlossen, einige Teile in dieser Publikation auszulassen und an einzelnen Stellen eher eine fragmentarische Schrift zu liefern, als mit ähnlicher Tinte mich als Kunstfälscher zu betätigen. Doch dieser Fragmentcharakter ist bisweilen festzustellen.
So mussten zum Beispiel wesentliche Teile zur Quantenphysik (etwa zu den Elementarkräften außer der Gravitation, zu elektromagnetischer Strahlung und zur Photonenenergie) in der Publikation ausgeklammert bleiben. Aber auch bei klassischen kosmologischen Themen wie dem Myonen-Phänomen, Weißen Löchern, zyklischem Universum reichten die Textbausteine mir nicht aus, um ohne Rücksprache mit dem Autor einen publikationsreifen Text herauszufiltern.
In den mir vorliegenden Originalausarbeitungen hat Klaus Kalberlah bisweilen nur skizzenhaft argumentiert und die genaue Erläuterung offen gelassen. Dieser Ansatz entsprang seinem Wunsch, erstmal neue Ideen, auch Spekulationen, in den Raum werfen zu wollen, um Denkanregungen zu geben.
Ich habe mich als Herausgeber deshalb entschlossen, einen in frühen Manuskriptversionen vorgesehenen Titel für diese Publikation auszuwählen, der eine gewisse Leichtigkeit in ein komplexes Thema mitbringt: „Kosmologische Gedankenspiele“. Klaus Kalberlah entwickelte seine Ideen, indem er die festgezurrten Regeln der klassischen Kosmologie als nichtverbindliche Vorgaben betrachtete und so mit der Freiheit wissenschaftlicher Kreativität sich die Thematik eröffnete.
Das Buch ist weitgehend in „Ich-Form“ geschrieben, in der Regel, weil Klaus Kalberlah auch bereits diese subjektive Perspektive kenntlich machen wollte. An einigen Stellen war es unvermeidbar, dass Passagen, Einleitungen oder Überleitungen vom Herausgeber, dann aber die Ich-Form beibehaltend, eingebaut wurden. Sofern das über die redaktionelle Einzelformulierung deutlich hinausgeht, wurden diese Stellen mit Fußnoten als Herausgebereinfügung kenntlich gemacht.
Freiburg, im Februar 2021
Fritz Kalberlah
Prolog
In dem sonnengebräunten, altersverwitterten Gesicht des indianischen Medizinmannes zuckt nicht eine Muskel; es scheint vielmehr, als läge ein weises und zugleich etwas spöttisches Lächeln in seinen Zügen. „Sieh genau hin“, sagt er und deutet auf den Himmel der sternklaren Nacht, „die Lichtpunkte, die Du da siehst, das sind Löcher in einem Fell. Das Licht kommt von den Feuern, die dahinter brennen. Um diese Feuer sitzen unsere Ahnen, Männer und Frauen, die ihr Leben auf dieser Erde beendet haben und nun durch gute Gedanken mit uns verbunden sind. Das ist es, was uns die Lichtpunkte sagen“.
Eine Weile lang ist Schweigen. „Und das, worauf wir beide stehen“ fährt er fort und macht eine weite Bewegung mit dem Arm, die Handfläche nach unten gekehrt, als streichele er die Weite der Prärie, die sich bis zum Horizont dehnt, „die Erde … was sollte dies anderes sein als der braune, runde, unermesslich große Rücken einer Schildkröte? Ihr geduldiger Körper ist der Urgrund, aus dem alles Lebende seine Kraft zieht. Die Pflanzen, die Tiere, wir Menschen … wir alle sind nur Gäste, die für eine Weile von ihrem Rücken getragen werden, die für ein paar Jahre an ihrem gesegneten Dasein teilhaben dürfen … dies und nichts anderes ist die Erde, wir spüren es, wenn unser Gefühl klar und wach ist.“
Ich blicke in die Augen des alten Indianers; es gibt darin keine Naivität, kein bisschen Rechthaben-Wollen, nur klares, unpersönliches Wissen. Ich fühle mich getröstet, wie ein störrisches Kind, und doch sagen meine Gedanken „… aber die Sterne sind glühende Gasmassen und die Erde IST eine Kugel, keine Schildkröte … unsere Satelliten haben die Bilder vom blauen Planeten zurück zur Erde gefunkt.“
Als könne er meine Gedanken lesen, kommt seine Antwort: „Keiner kann wissen, was etwas wirklich ist. ‚Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose‘, so sagen es wohl Eure Dichter. Alles andere sind nur Beschreibungen. Eine Beschreibung ist niemals wahr oder unwahr, sie ist nur mehr oder weniger zweckmäßig. Und den Zweck – den Zweck gibst du selbst vor.
Meine Beschreibung der Sterne und der Erde tröstet die Lebenden … Eure Beschreibung ist gut für Raketen und Raumfahrt … ein anderer Zweck, keine größere Wahrheit.
Beschreibung statt Wahrheit – das ist immer so, wo Menschen reden. Egal, ob über Physik oder über Gott.“
Einführung
Der Prolog dieses Buchs könnte uns an eine spirituelle Beschäftigung mit dem Kosmos erinnern – doch da müsste ich Sie gleich enttäuschen: Ich werde mich in dieser Schrift streng an naturwissenschaftliche Überlegungen halten, um in diesem Rahmen nach stimmigen Antworten auf die alten Fragen zu suchen:
Wie bleiben die Planeten auf ihren Bahnen um die Sonne? Wie kommt es zur Expansion unseres Weltalls? Welche Physik gilt im Kleinen (also auf quantenphysikalischer Ebene) ebenso wie im Großen (also auf kosmologischer Ebene)?, um drei der zentralen Themen zu erwähnen.
Wenn ich mich auf die naturwissenschaftliche Sicht des Themes beschränke, so bedeutet das keinesfalls, dass ich Wissenschaftlichkeit für das einzig geeignete und ausreichende Instrumentarium halte, sich den genannten grundsätzlichen Fragen zu näheren. Insofern kann der Prolog vielleicht auch daran erinnern!
Da jedoch im zwangsläufig beschränkten Rahmen der Naturwissenschaften die Antworten auf die meisten dieser Fragen mit den gängigen Standardtheorien recht unbefriedigend ausfallen (siehe Teil I des folgenden Textes), erhält der Prolog seine weitergehende Bedeutung: Wir müssen zunächst einmal erkennen, dass auch im Rahmen der Naturwissenschaften viele unserer Modellierungen und Schlussfolgerungen auf Denkgewohnheiten beruhen, die keineswegs die Wahrheit zu den großen Fragen ergeben. Stattdessen handelt es sich immer um Beschreibungen und Erklärungsversuche, die möglicherweise durch neue Ansätze abgelöst werden können. Menschliche Bemühungen können grundsätzlich nur darauf abzielen, eine möglichst nützliche, in sich stimmige und konsistente Theorie zu entwickeln, die jedoch niemals im Sinne einer absoluten Wahrheit beweisbar wäre. Ich äußere mich nicht zur vermeintlichen Realität, sondern ich beschreibe nur. Denn: „… eine Rose ist eine Rose ist eine Rose“1.
Diese Gedanken des Prologs werden in Teil II des Buches aufgenommen. Es geht dann um einige erkenntnistheoretische Prinzipien und die Anforderungen an ein abgewandeltes (Wissenschafts-) Theoriengebäude zu unseren Fragen an Kosmologie und Quantenphysik, um das erforderliche Umdenken, um an neue Ufer zu kommen.
Und dieser neue Denkansatz mit seinen neuen Elementen eines Theoriengebäudes ist dann auf der übergreifenden Ebene inhaltlich zu charakterisieren. Dies erfolgt in Teil III des Buchs. Wobei ich vorsichtig sein möchte: Nicht immer ergibt sich das Neue durch gänzliches Verwerfen des Gewohnten. Oft reicht es aus, ganz knapp neben dem ausgetretenen Weg ins Abseits einen schmalen Trampelpfad zu erkennen, den auch schon einige Andere eingeschlagen haben, diesen auszubauen oder zu begradigen, um an das erstrebte Ziel zu kommen! Eben das wird zu den interessanten Erkenntnissen dieser Schrift zählen.
Auf dieser Basis dann kann ich in Teil IV das abgewandelte Gebäude als integrierendes Modell in ersten Ausschnitten zumindest skizzenhaft vorstellen. Ich nutze dazu vor allem drei Schlüsselprinzipien für einen integrierenden Gesamtansatz: Die Stringtheorie, das Verständnis unseres Kosmos als vierdimensionalen Raum und das Emergenzprinzip. Bei dem stringtheoretischen Ansatz musste ich jedoch zunächst relevante Änderungen und Präzisierungen vornehmen, denn die gängige Stringtheorie hat sich mit einigen Annahmen nach meiner Ansicht gründlich verrannt.
Da könnte es hingehen und es scheint mir stimmig, diese Gedankenspiele zu vertiefen. Ich jedenfalls finde die Überlegungen so spannend, dass ich sie mit Ihnen teilen möchte. Vielleicht bieten die Ideen Impuls und Startpunkt für weitere Differenzierungen und Ergänzungen; das würde mich freuen.
1 Dem Medizinmann in den Mund gelegt; nach einem Gedicht von Gertrude Stein (1922): https://schoengeistinnen.de/auf-den-spureneiner-amerikanerin-in-paris-rose-is-a-rose-is-a-rose
Teil I:
Ein unbefriedigendes Ende
Kosmologische Theorien empfinde ich dann als unbefriedigend, wenn diese Theorie allzu früh in der Abfolge der Erklärungsschritte keine physikalische Erläuterung mehr geben kann, wenn also auf die Frage nach dem WIE und WARUM keine Antwort mehr parat ist. Die Wissenschaft wählt den Begriff Axiom für solche innerhalb dieses Systems nicht begründbaren oder nicht deduktiv ableitbaren Aussagen. Frühe nebeneinander stehende Axiome ohne Weg zu deren Integration deuten entweder auf einen möglichen Fehler der Theorie oder aber darauf, dass die Folgeschritte nicht angemessen weiterverfolgt wurden.
Diese Aussage darf nicht zu einem Missverständnis führen: Keine Theorie kann alle Fragen bis ganz „ans Ende“ befriedigend physikalisch erklären. Keine Theorie kommt ohne Axiome aus. Aber manche Theorien kommen vorzeitig an einen axiomatischen Stop, wo andere uns noch weiter führen.
In diesem ersten Teil möchte ich einige zentrale Beispiele aus dem herrschenden kosmologischen Theoriengebäude vorstellen, wo die Erklärungen zu früh auf ein unbefriedigendes Ende stoßen, bei denen dieses Ende eine Sackgasse darstellt oder wo ein kleiner, erhellender Blick ins verbleibende Dunkel neben dem Mainstream-Ansatz es ermöglichen würde, ein weiterführendes und integratives Theoriengebäude zu errichten.
Wir nehmen uns stellvertretend für die vielen Themen vor:
die unzureichend erklärte Physik der Gravitation,
eine unstimmige Vorstellung vom Urknall, und
eine fragliche Theorie der Elementarkräfte der Quantenphysik.
Die noch immer geheimnisvolle Schwerkraft
Für kosmologische Theorien ist ein physikalisches Verständnis des Phänomens der Gravitation unabdingbar. Die Umkreisung der Sonne durch Planeten basiert auf Gravitation. Auch Licht wird gravitativ abgelenkt.
Ich möchte mir die gängigen Antworten betrachten: Was ist das heutige Verständnis einer gravitativen Fernwirkung (Anziehung zweier Massen), wie dies Isaak Newton bezeichnete und in Frage stellte? Liegt eine Raumkrümmung durch Gravitation vor, wie sie Albert Einstein in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie vertritt? Ist hierfür ein Medium erforderlich, das den Weltraum erfüllt, und wie ist dieses gegebenfalls in der gängigen Theorie physikalisch definiert?
Schwerkraft, klassisch
Als die Erde noch eine Scheibe war, machten die damaligen Physiker-Philosophen (z.B. Aristoteles ca. 350 v. Chr.) sich andere Gedanken über den Ursprung der Schwerkraft: Gegenstände fielen zu Boden, weil allen materiellen Körpern die Bestimmung zu eigen ist, nach unten zu fallen. So, wie ein Baum „bestimmungsgemäß“ im Herbst seine Blätter verliert oder – wenn der Baum eine Tanne ist – „bestimmungsgemäß“ die grünen Nadeln auch im Winter behält. Die Frage, woher ein fallender Körper weiß, wo „unten“ ist und wo die Energie herkommt, die seine Bewegung ermöglicht, wurde nicht gestellt. Oder aber: Es wurde darauf verwiesen, dass eine Antwort einfach im Vorborgenen liege (okkult sei). In der Antike und bis zum späten Mittelalter erklärte man die Gravitation im Abendland noch nicht als Anziehung zwischen materiellen Gegenständen. „Unten“ war in Richtung auf die Füße des Beobachters, und natürlich war die Erde eine Scheibe, sonst wäre, wer immer sich auf die andere Seite gewagt hätte, noch weiter nach unten gefallen.
Dass mit dieser einfachen Erklärung etwas nicht stimmen konnte, merkten die Menschen, als man begann, die Erde als Kugel zu sehen. Spätestens, als erste Weltumsegler zurückkehrten (1522) und nicht von der anderen Seite der Kugel ins Nichts gefallen waren. Die Erde hat also eine „Anziehungskraft“ – das wurde offensichtlich.
Schwerkraft nach Newton
Es benötigte trotz Galileo (Fallgesetze, ca. 1610) und Keppler (Planetenbahnen, ca. 1630) weitere 100 Jahre nach der Weltumseglung, bis man erkannte, dass die Kraft, die einen Apfel zur Erde fallen lässt und die Kraft, die den Mond an die Erde und die Erde an die Sonne bindet, dieselbe ist. Die Ehre für diese Entdeckung gebührt Newton (1667). Er erkannte, dass zwischen zwei Massen eine anziehende Kraft wirkt – Gravitation genannt. Die Stärke dieser Kraft, fand Newton, ist proportional dem Produkt der beiden Massen und umgekehrt proportional dem Quadrat des Abstands r der beiden Massen. Newton konnte also die Massenanziehung mit einer mathematischen Formel berechnen (im Prinzip; die Gravitationskonstante G wurde jedoch erst später genauer quantifiziert). Aber: Den Funktionsmechanismus kannte Newton nicht. Zur Frage: WIE und WARUM sich Massen anziehen, bekannte er vielmehr freimütig: „I have not as yet been able to deduce from phenomena the reason for these properties of gravity, and I do not feign hypotheses“2.
Das WIE der Gravitation steht in engem Zusammenhang mit dem Verständnis, wie zwei Körpern über die Entfernung (Fernwirkung) aufeinander einwirken: Kann über den luftleeren Raum eine Wirkung erfolgen, eine Kraft übertragen werden? Newton hielt das für absurd: „That gravity should be innate inherent and essential to matter so that one body may act upon another at a distance through a vacuum without the mediation of any thing else by and through which their action or force may be conveyed from one to another is to me so great an absurdity that I believe no man who has in philosophical matters any competent faculty of thinking can ever fall into it. Gravity must be caused by an agent acting constantly according to certain laws, but whether this agent be material or immaterial is a question I have left to the consideration of my readers.“3 Für die gravitative Fernwirkung benötigt Newton also einen „agent“, vielleicht als Medium zu übersetzen oder einen Äther, den er jedoch nicht weiter definieren konnte: „I do not know what this Aether is“4.
Newton ließ mit seiner Kommentierung ausdrücklich die Möglichkeit offen, dass ein solcher Äther materiell oder immateriell sein könne und lässt damit eine zentrale Frage anklingen, was „immaterielle Teilchen“ in der Physik zu suchen haben könnten.
Das Phänomen der Gravitation wurde 150 Jahre später im Laborversuch anschaulich durch die Gravitationswaage von Cavendish (1798) bestätigt. Man konnte also bereits im 17. Jahrhundert Gravitation mathematisch gut beschreiben und stimmig berechnen, aber WARUM es Gravitation gibt und WIE diese Kraft über wenige Millimeter (Drehwaage) ebenso wie über Millionen von Kilometern Entfernung hinweg (Kosmos) funktioniert, blieb ein Rätsel, blieb ein Geheimnis der Natur.
Der Michelson-Morley-Versuch begräbt den Lichtäther
Da ein Äther als Trägermedium für elektromagnetische Strahlung und die Ausübung der Gravitation gesucht wurde, wollten der deutsch-amerikanische Physiker Albert A. Michelson (1881) in Potsdam und der amerikanische Chemiker Edward W. Morley (1887) in Cleveland (Ohio) den Ätherwind im Labor nachweisen: Man nahm an, dass durch die Bewegung der Sonne und der Erde um die Sonne ein unterschiedlicher Ätherwind herrschen müsse, je nach Phase, wo sich die Erde gleichsinnig mit der Sonne bewegt oder wo sich die Erde gegenläufig zur Sonne bewegt. Diese Erwartung von einem Ätherwind basierte auf einer materiellen Vorstellung von einem ruhenden Lichtäther. Doch die Wissenschaftler konnten einen solchen Ätherwind in ihrem spannenden Experiment nicht feststellen (wie auch viele spätere Versuche dazu scheiterten). Michelson und Morley waren auch nach diesen Versuchen nie vollständig von der Nichtexistenz eines Äthers überzeugt, aber die experimentellen Daten erforderten ein Umdenken. Auch ein mitgeführter Äther, wie ihn der französische Physiker Augustin Jean Fresnel vorschlug5, konnte nicht bestätigt werden. Es gab danach zunächst keinen Äther mehr. Das bedeutete jedoch, dass die Fernwirkung der Gravitation nach diesen Experimenten nicht durch die Vermittlung der Kräfte über ein Medium, den Äther, erklärt werden konnten. Das WIE und WARUM der Gravitation blieb ungelöst.
Das gravitative Feld
Für die Kraftübertragung über den Raum führte Faraday 1838 den Begriff des Feldes ein. Seiner Meinung nach wird von der felderzeugenden Anordnung der Raum erregt [kursiv; KK], so dass ein anderer Körper eine Kraft erfährt6





























