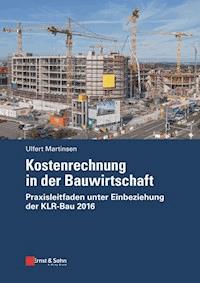
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der Bereich Kostenrechnung ist entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg eines Bauunternehmens. Dementsprechend wichtig ist die genaue und umfassende Kenntnis ihrer Prinzipien und Grundsätze sowie deren Anwendung in allen Projektphasen. Dieses Buch behandelt sowohl die Bauauftragsrechnung, die Betriebsabrechnung als auch das Controlling auf der Ebene des Einzelprojekts wie auch für das Gesamtunternehmen. Damit ist es das ideale Nachschlagewerk für die Praxis, insbesondere für kleine und mittlere Bauunternehmen sowie das Baugewerbe. Wie stelle ich einen Nachtrag auf? Wie mache ich eine korrekte Leistungsmeldung? Wie kontrolliere ich den Stundenverbrauch? Wie ermittele ich das momentane Ergebnis und rechne dieses auf den Abschluss der Baumaßnahme hoch? - Auf diese und viele weitere im Tagesgeschäft auftretende Fragen gibt das Buch praxisnahe Antworten. Dabei wird detailliert auf die KLR-Bau 2016 eingegangen. In dieser wird neben der Kostenstellenrechnung auch die in der stationären Industrie gebräuchliche Kostenträgerrechnung behandelt. Das vorliegende Buch zeigt anhand von Vergleichsrechnungen die Unterschiede beider Verfahren auf und hinterfragt die Eignung der Kostenträgerrechnung für die Bauwirtschaft. Das Buch ist ebenfalls hervorragend als Lehrbuch im Fach "Baubetrieb" geeignet und stellt somit die Verbindung zwischen Lehre und Praxis her.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
1 Die Buchhaltung
1.1 Begriffsbestimmung
1.2 Die Finanzbuchhaltung
1.3 Der Jahresabschluss
1.4 Die Betriebsbuchhaltung
2 Die Kalkulation
2.1 Die Grundlagen der Kalkulation
2.2 Die Gliederung der Kalkulation
2.3 Die Kalkulationsverfahren
2.4 Die Einzelkosten der Teilleistungen
2.5 Die Gemeinkosten der Baustelle
2.6 Die umsatzbezogenen Zuschläge
2.7 Die Durchführung der Kalkulation
2.8 Die EDV-Kalkulation
3 Die Angebotsstrategien
3.1 Die projektbezogenen Strategien
3.2 Die unternehmensbezogenen Strategien
4 Die Betriebsabrechnung
4.1 Die Kostenstellengliederung
4.2 Die Ist-Kosten der Kostenstellen
4.3 Die Leistungen der Kostenstellen
4.4 Die Kostenstellenrechnung
4.5 Die Kostenträgerrechnung
4.6 Die Betriebsabrechnung für den kleinen Bau- oder Handwerksbetrieb
5 Das Controlling in einer Bauunternehmung
5.1 Das Prinzip des Controllings
5.2 Die Wirtschaftlichkeitskontrollen für größere Baumaßnahmen
5.3 Die Hochrechnung
5.4 Die Wirtschaftlichkeitskontrollen für eine kleine Baumaßnahme
5.5 Das Controlling für den Gesamtbetrieb
5.6 Schlussbemerkung
Weiterführende Literatur
Stichwortverzeichnis
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
List of Tables
1 Die Buchhaltung
Tabelle 1.1 Kontenrahmen
Tabelle 1.2 a Baukontenrahmen (Aktivkonten)
Tabelle 1.2 b Baukontenrahmen (Passivkonten)
Tabelle 1.2 c Baukontenrahmen (Erträge und Aufwendungen)
Tabelle 1.2 d Baukontenrahmen (Abschlusskonten)
Tabelle 1.3 Vereinfachter Monatsabschluss
Tabelle 1.4 Buchhaltung in Staffelform
Tabelle 1.5 Buchhaltung in Reihenform
Tabelle 1.6 Einführung des Saldos
Tabelle 1.7 Konto in T-Form
Tabelle 1.8 Konto bei doppelter Buchführung
Tabelle 1.9 Monatsübersicht bei doppelter Buchführung
Tabelle 1.10 Erweiterte Monatsübersicht als Gewinn- und Verlustrechnung
Tabelle 1.11 „Alte“ Gewinn- und Verlustübersicht
Tabelle 1.12 „Neue“ Gewinn- und Verlustrechnung nach§ 275 HGB
Tabelle 1.13 Bilanzgliederung
Tabelle 1.14 Bilanz-Systematik
Tabelle 1.15 Gliederung der Betriebsbuchhaltung
2 Die Kalkulation
Tabelle 2.1 Gliederungsebene 1
Tabelle 2.2 Gliederungsebene 2
Tabelle 2.3 Gesamtgliederung der Kalkulation
Tabelle 2.4 Mittellohn ML 0
Tabelle 2.5 Lohnbedingte Zuschläge ML 1
Tabelle 2.6 Lohngebundene Zuschläge
Tabelle 2.7 Mittellohn ML 2
Tabelle 2.8 Gesamtmittellohn ML 3
Tabelle 2.9 Geräteliste für eine Brückenbaustelle
Tabelle 2.10 Gliederung der Gemeinkosten der Baustelle
Tabelle 2.11 Gemeinkosten der Baustelle
Tabelle 2.12 a Kalkulationsformular Seite 1
Tabelle 2.12 c Kalkulationsformular Seite 3
Tabelle 2.12 d Kalkulationsformular Seite 4
Tabelle 2.12 e Titelzusammenstellung
Tabelle 2.13 Schlussblatt der Kalkulation
Tabelle 2.14 Formelverbindungen
Tabelle 2.15 Formelberechnung der Einheitspreise mit Excel
Tabelle 2.16 Betriebsmittellohn
Tabelle 2.17 Kalkulation und Einheitspreise
Tabelle 2.18 Jahresabschluss und Kostenaufteilung
Tabelle 2.19 Kalkulation mit gleicher Zuschlagsverteilung
Tabelle 2.20 a Kalkulation 1. Rechengang (Sonderfall)
Tabelle 2.20 b Kalkulation 2. Rechengang (Sonderfall)
3 Die Angebotsstrategien
Tabelle 3.1 Fixe und variable Kosten
Tabelle 3.2 Fixe und variable Kosten Brückenkalkulation
4 Die Betriebsabrechnung
Tabelle 4.1 a Sammelkonto Lohn
Tabelle 4.1 b Sozialkosten Gewerbliche
Tabelle 4.1 c Sammelkonto Gehalt
Tabelle 4.1 d Sammelkonto Sozialkosten Angestellte
Tabelle 4.1 e Sammelkonto Baustoffe
Tabelle 4.1 f Sammelkonto Schalung und Rüstung
Tabelle 4.1 g Sammelkonto Hilfs- und Betriebsstoffe
Tabelle 4.1 h Sammelkonto Geräte
Tabelle 4.1 i Sammelkonto Ausstattung
Tabelle 4.1 j Sammelkonto Sonstige Kosten
Tabelle 4.1 k Sammelkonto Verrechnungskosten
Tabelle 4.1 l Sammelkonto Nachunternehmer
Tabelle 4.2 Leistungsmeldung der Werkstatt
Tabelle 4.3 Ergebnis der Baustelle
Tabelle 4.4 Soll-Kosten der Brücke (aus der überarbeiteten Angebotskalkulation)
Tabelle 4.5 Materialabgrenzung in der Leistungsmeldung
Tabelle 4.6 Nachunternehmerbewertung
Tabelle 4.7 Beispiel für ein Leistungsmeldungsformular
Tabelle 4.8 Ist-Kosten der Kostenstellen
Tabelle 4.9 Leistungsübersicht der Hilfskostenstellen
Tabelle 4.10 Leistungsübersicht Hauptkostenstellen
Tabelle 4.11 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
Tabelle 4.12 Betriebsabrechnungsbogen
Tabelle 4.13 Die Umlagesätze
Tabelle 4.14 Die Verrechnungssätze
Tabelle 4.15 Die Ist-Kostenzusammenstellung als Primärkosten
Tabelle 4.16 Die Primärkosten der Umlagekostenstellen
Tabelle 4.17 Die Primärkosten der Verrechnungskostenstellen
Tabelle 4.18 Die Primärkosten der Kostenträger
Tabelle 4.19 Die Leistungen der Hilfskostenstellen
Tabelle 4.20 Leistungsübersicht der Kostenträger
Tabelle 4.21 Innerbetriebliche Weiterverrechnung und Betriebsabrechnung
Tabelle 4.22 Ergebnisdifferenzen
Tabelle 4.23 Abschluss Finanzbuchhaltung
Tabelle 4.24 Leistungszusammenstellung
Tabelle 4.25 Betriebsabrechnung in einem kleinen Baubetrieb
5 Das Controlling in einer Bauunternehmung
Tabelle 5.1 Kostenzuordnung in der Ausführungskalkulation
Tabelle 5.2 Gerätekostengliederung in der Ausführungskalkulation
Tabelle 5.3 Einführung von Kostenartenschlüsseln
Tabelle 5.4 a Ausführungskalkulation Brücke Seite 1
Tabelle 5.4 b Ausführungskalkulation Brücke Seite 2
Tabelle 5.4 c Ausführungskalkulation Brücke Seite 3
Tabelle 5.4 d Ausführungskalkulation Brücke Seite 4
Tabelle 5.4 e Ausführungskalkulation Brücke Seite 5
Tabelle 5.5 a Leistungsmeldung zum 31.10.2016, Seite 1
Tabelle 5.5 b Leistungsmeldung zum 31.19.2016, Seite 2
Tabelle 5.5 c Leistungsmeldung zum 31.10.2016, Seite 3
Tabelle 5.5 d Leistungsmeldung zum 31.10.2016, Seite 4
Tabelle 5.6 Ergebnisdarstellung: Brückenbaustelle
Tabelle 5.7 Kostenarten-Soll-Ist-Vergleich
Tabelle 5.8 a Mittellohnkontrolle
Tabelle 5.8 b Korrigierter Mittellohn
Tabelle 5.9 Kostenarten Soll-Ist-Vergleich in der Kostenträgerrechnung
Tabelle 5.10 Beispiel Kostenartenschlüssel
Tabelle 5.11 a Der Bauarbeitsschlüssel BAS – Hauptgruppen
Tabelle 5.11 b Der Bauarbeitsschlüssel BAS – Tätigkeiten
Tabelle 5.12 Soll-Stunden gemäß BAS
Tabelle 5.13 Tagesbericht für die Stunden
Tabelle 5.14 Soll-Ist-Vergleich für den Stundenverbrauch
Tabelle 5.15 Abgeglichener Soll-Ist-Vergleich
Tabelle 5.16 Hochrechnung 1 (Zusammenstellungsblatt)
Tabelle 5.17 Hochrechnung 2
Tabelle 5.18 Gesamtentwicklung in der Vorschau
Tabelle 5.19 Aufwand Werkstatthalle zum 31. August
Tabelle 5.20 Soll-Kosten
Tabelle 5.21 Gewinn- und Verlustrechnung
Tabelle 5.22 Einzelzeiten Ausführung
Tabelle 5.23 Gesamte Zielvorgabe
Tabelle 5.24 Kostenplan
Tabelle 5.25 Umsatz- und Ergebnisübersicht
Tabelle 5.26 Budgetplanung Bauhof und Soll-Ist-Vergleich
Tabelle 5.27 Verwaltungskostenbudgets und Soll-Ist-Vergleich
Tabelle 5.28 Ergebnisse der übrigen Hilfskostenstellen
Tabelle 5.29 Kontrolle der Zielerreichung
Tabelle 5.30 Die Kontrolle der „Unproduktiven Kosten“
Tabelle 5.31 Personaleinsatzplan
Tabelle 5.32 Kolonneneinsatzplan
Tabelle 5.33 Der Umsatzplan
Tabelle 5.34 Gewinn-/Verlustplanung
List of Illustrations
1 Die Buchhaltung
Bild 1.1 Begriffe der Kostenrechnung
Bild 1.2 Buchungsabgrenzung
Bild 1.3 Zusammenhang zwischen Finanz- und Betriebsbuchhaltung
Bild 1.4 Buchungsvorgänge
2 Die Kalkulation
Bild 2.1 Vertikale Gliederung der Kalkulation
Bild 2.2 Schema Zuschlagskalkulation über die Endsumme
Bild 2.3a Schema Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen; Variante: Zuschlag nur auf den Lohn
Bild 2.3 b Schema Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen; Variante: alle Kostenarten gleichmäßig beaufschlagen
Bild 2.4 Abschreibung von Geräten
Bild 2.5 Verzinsung
Bild 2.6 Beispiel Geräteliste BGL
Bild 2.7 a Draufsicht
Bild 2.7 b Ansicht
Bild 2.7 c Querschnitt
Bild 2.8 a Leistungsverzeichnis Seite 1
Bild 2.8 b Leistungsverzeichnis Seite 2
Bild 2.9 Kalkulationsunterlagen
Bild 2.10 Werkstatthalle
Bild 2.11 Leistungsverzeichnis Maurerarbeiten
Bild 2.12 Fixe und variable Kosten
Bild 2.13 Die Startseite
Bild 2.14 Die Stammdaten
Bild 2.15 Die Kostenarten
Bild 2.16 Die Adressenverwaltung
Bild 2.17 Die Projektverwaltung
Bild 2.18 Vorberechnungsblätter
Bild 2.19 Der Mittellohn
Bild 2.20 EDV-Kalkulationsblatt
Bild 2.21 a Kalkulation der LV-Positionen
Bild 2.21 b Kalkulation Gemeinkosten-Positionen
Bild 2.21 c Schlussblatt
Bild 2.22 Steuerung der Angebotserstellung
Bild 2.23 Das Angebot
Bild 2.24 Lohngebundene Kosten
Bild 2.25 Die allgemeinen Geschäftskosten
Bild 2.26 a Kalkulationsfaktor für die Werkstatthalle
Bild 2.26 b Kalkulationsfaktor für die Werkstatthalle (Anpassung)
Bild 2.27 Mittellohn und Zuschläge
Bild 2.28 Die positionsweise Kalkulation
Bild 2.29 Das Angebot
Bild 2.30 Mittelohn und Zuschlagsverteilung
Bild 2.31 Angebot mit gleichmäßiger Beaufschlagung
Bild 2.32 Datenbank Stundenansätze
Bild 2.33 Die Geräte-Datenbank
Bild 2.34 Die Materialdatei
3 Die Angebotsstrategien
Bild 3.1 Zusammenhang fixe und variable Kosten
Bild 3.2 Marktpreis
Bild 3.3 Personalauslastung
Bild 3.4 Kapazitätsauslastung – Marktchancen
4 Die Betriebsabrechnung
Bild 4.1 Rechnungsverwaltung
Bild 4.2 Bearbeiten der Rechnung
Bild 4.3 Abschlagsrechnung
Bild 4.4 Periodische Leistungserfassung
Bild 4.5 Abschlagsrechnung
Bild 4.6 Schema der Kostenverteilung
Bild 4.7 Prinzip der Leistungsverrechnung
Bild 4.8 Schema Kostenverteilung bei der Kostenträgerrechnung
5 Das Controlling in einer Bauunternehmung
Bild 5.1 Regelkreissystematik für das Controlling
Bild 5.2 Zeitliche Grenzen der Steuerung
Bild 5.3 Indirekte Stundenkontrolle
Bild 5.4 Terminplan
Bild 5.5 Gesamtregelkreis Bauunternehmung
Bild 5.6 Umsatzentwicklung
Bild 5.7 Kostenverteilung nach Standardablauf
Bild 5.8 Kostenverteilung nach linearem Ablauf
Bild 5.9 Umsatzentwicklung
Bild 5.10 Umsatzentwicklung
Bild 5.11 Gewinn-Verlust-Entwicklung
Guide
Cover
Inhaltsverzeichnis
Begin Reading
Pages
C1
III
IV
V
VI
VII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
311
312
e1
Kostenrechnung in der Bauwirtschaft
Praxisleitfaden unter Einbeziehung der KLR-Bau 2016
Ulfert Martinsen
Dr.-Ing. Ulfert Martinsen
Rellingen
Deutschland
Titelbild: Baustelle Flughafen Stuttgart, Foto: PERI GmbH, Weißenhorn
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2017 Wilhelm Ernst & Sohn, Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Rotherstraße 21, 10245 Berlin, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikrofilm oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprinting, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publisher.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, daß diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie als solche nicht eigens markiert sind.
Umschlaggestaltung: Sophie Bleifuß, BerlinHerstellung: pp030 – Produktionsbüro Heike Praetor, BerlinSatz: Reemers Publishing Services GmbH, KrefeldDruck und Bindung:
Print ISBN: 978-3-433-03030-1ePDF ISBN: 978-3-433-60646-9ePub ISBN: 978-3-433-60647-6eMobi ISBN: 978-3-433-60645-2oBook ISBN: 978-3-433-60644-5
Vorwort
Die Kostenrechnung ist ein Teilgebiet des betrieblichen Rechnungswesens und wird in diesem Buch mit einem speziellen Zuschnitt auf die Bauwirtschaft vorgestellt. Die Bauwirtschaft unterscheidet sich in elementaren Produktionsmerkmalen von der Unternehmenswirtschaft der stationären Industrie, was auch einen Niederschlag in der Kostenrechnung findet. Es wird immer wieder der Versuch unternommen, die Verfahren der Kostenrechnung von Seiten der Bauwirtschaft mit denen der übrigen Industrie abzugleichen, obwohl dafür, bis vielleicht auf den Wunsch zur Vereinheitlichung, keine zwingende Notwendigkeit zu erkennen ist.
Nun ist im November 2016 die „Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung der Bauunternehmen“, kurz: die KLR-Bau, in der 8. Auflage erschienen. Die KLR-Bau wird gemeinsam herausgegeben vom Hauptverband der deutschen Bauindustrie und dem Zentralverband des deutschen Baugewerbes und ist eine Leitlinie und Empfehlung für die Unternehmen der Bauwirtschaft, wie in der Kostenrechnung zu verfahren ist. In weiten Teilen herrscht große Übereinstimmung mit den üblichen Verfahren und Vorgehensweisen, wie sie in der Bauwirtschaft angewendet werden und durch die Praxis erprobt sind. Allerdings in einem zentralen Teil, der Betriebsabrechnung, wird auf eine betriebswirtschaftliche Methode eingegangen, die nicht mit den Randbedingungen der Bauwirtschaft verträglich ist. Die hier ins Spiel gebrachte Kostenträgerrechnung kommt aus der stationären Industrie und wurde dort auf Grundlage anderer Produktionsbedingungen entwickelt.
Wie die Auftragsrechnung, die Kalkulation, sich in der Bauwirtschaft an den speziellen Bedingungen der standortgebundenen Einzelfertigung orientiert, müssen in logischer Fortführung in der gleichen Systematik die Betriebsabrechnung und die sich anschließenden Wirtschaftlichkeitskontrollen strukturiert sein. Die Kostenträgerrechnung als ein Element der Betriebswirtschaft der stationären Industrie in die in sich abgestimmte Kostenrechnung der Bauwirtschaft einzuschieben, bedeutet einen Bruch in der Systematik mit entsprechend negativen Folgen.
Im hier vorliegenden Buch werden deswegen die klassische Kostenrechnung für die Bauwirtschaft erläutert und etliche Hinweise für die praktische Handhabung gegeben. Parallel dazu werden die Überlegungen der KLR-Bau einbezogen und anhand von Beispielen gezeigt, wo es zu Brüchen kommt bzw. wo Kontrollen von zentraler Bedeutung nicht durchführbar sind.
In diesem Buch geht es dabei nicht nur um die strenge Lehre, sondern die reine Theorie wird verknüpft mit den praktischen Erfahrungen des Autors. Zur Erläuterung werden Beispiele behandelt, mit denen die Machbarkeit der dargestellten Verfahren nachgewiesen wird. Dabei steht nicht die zahlenmäßige Genauigkeit im Vordergrund – auf die Mitnahme der Cent-Beträge wird in vielen Fällen verzichtet –, sondern die prinzipielle Vorgehensweise.
Die Praktikabilität der erläuterten Methoden wird mit der Bearbeitung von Beispielen demonstriert. Die Beispiele werden sowohl halb-manuell mit Excel-Tabellen als auch mit einem EDV-Programm gerechnet, denn ein aktuelles Buch über die Kostenrechnung muss heute auf den EDV-Einsatz eingehen, um den Anspruch auf Realitätsnähe erheben zu können. Gerade im Bereich der Kalkulation ist die EDV-Anwendung heute in den Baubetrieben eine Selbstverständlichkeit.
Zur Realitätsnähe gehört auch die differenzierte Betrachtung von großen und kleinen Bauunternehmen oder Handwerksbetrieben, die sich in den Methoden des betrieblichen Rechnungswesens stark unterscheiden. Hier werden generelle Unterschiede aufgezeigt; auf den Versuch, die Vielfalt der möglichen und in der Praxis vorkommenden Variationen vollständig darzustellen, wird allerdings verzichtet.
Damit bei den zahlreichen angesprochenen Themenbereichen nicht der Überblick verlorengeht, ist die Gliederung des Buches in der folgenden Abbildung veranschaulicht.
Rellingen, im Januar 2017
Dr.-Ing. Ulfert Martinsen
1Die Buchhaltung
Die Basis für das System der Kostenrechnung ist in jedem Betrieb die Buchhaltung, in der alle anfallenden Kosten und Erlöse, Aufwendungen und Erträge, Einnahmen und Ausgaben dokumentiert werden. Hier fließen alle Informationen zusammen, die etwas mit Geld und anderen Werten zu tun haben. Die Buchhaltung wird im Weiteren aber nur soweit erläutert und in die Betrachtungen einbezogen, wie sie als Instrument für die Schaffung von Basisdaten notwendig ist. Bilanzielle Probleme, Steuerprobleme usw. bleiben unbehandelt.
1.1 Begriffsbestimmung
Im Zusammenhang mit dem Betriebsgeschehen in einem Unternehmen fallen Kosten an, werden Ausgaben getätigt, Ergebnisse erwirtschaftet, soll ein Gewinn erzielt werden – und trotzdem entstehen manchmal Verluste, der Ertrag ist ausreichend oder auch nicht, und es wird mit vielen Begriffen gearbeitet, die zunächst einmal sortiert und definiert werden müssen. Eine klare Terminologie ist notwendig, um die zum Teil komplizierten Verhältnisse in der Kostenrechnung eindeutig beschreiben zu können.
Und es fängt mit der Frage an: Was ist überhaupt die Kostenrechnung?
Die Kostenrechnung ist ein Teilgebiet des gesamten betrieblichen Rechnungswesens, das alle Vorgänge in einem Betrieb umfasst, die für die wirtschaftliche Führung des Unternehmens erforderlich sind. Mit dem Rechnungswesen werden die Wertströme in einem Unternehmen, nämlich Güter, Geld und Vermögen, dokumentiert und transparent gemacht, mit zwei Zielrichtungen:
– nach außen als externes Rechnungswesen,
– nach innen als internes Rechnungswesen.
Mit dem externen Rechnungswesen wird die Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens dargestellt als Information für Kapitalgeber, das Finanzamt, kreditgebende Banken usw.; das interne Rechnungswesen dient der Optimierung des Unternehmenserfolgs. Das interne Rechnungswesen ist die Kosten- und Leistungsrechnung oder kurz: die Kostenrechnung.
Mit der Kostenrechnung werden die internen Kosten erfasst, Bezugsgrößen zugeordnet und ausgewertet zur Gewinnung von Steuerungsgrößen für die Betriebsführung. Zur Kostenrechnung gehören die Teilgebiete:
– Auftragsrechnung (Kalkulation)
– Betriebsabrechnung
– Controlling
Und als Grundlage für alle Teilgebiete die
– Betriebsbuchhaltung (größere Betriebe) auf Basis der
– Finanzbuchhaltung
Kleinere Betriebe führen nur die Finanzbuchhaltung.
Das externe Rechnungswesen ist durch das Handelsgesetz mit vielen Vorschriften zur Finanzbuchhaltung, der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung geregelt, weil es zugleich die Basis für die Besteuerung der Unternehmen ist. Für das interne Rechnungswesen gibt es keine gesetzlichen Vorschriften. Es kann individuell nach den Bedürfnissen des Betriebs und nach Zweckmäßigkeitsüberlegungen organisiert werden.
Allerdings gibt es eine Reihe von Vorschlägen zur Vereinheitlichung der Kostenrechnung in der Bauwirtschaft, die in verschiedenen Arbeitskreisen entwickelt worden sind. So wird von den beiden großen Bauverbänden, dem Hauptverband der Bauindustrie und dem Zentralverband des deutschen Baugewerbes, z. B. eine sogenannte KLR-Bau (Kosten- und Leistungsrechnung Bau) herausgegeben, auf deren neueste Fassung von 2016 in diesem Buch eingegangen wird. Es handelt sich dabei um eine Richtlinie mit Empfehlungscharakter, die nicht bindend ist, aber eine Reihe von Vorschlägen zur Vereinheitlichung des betrieblichen Rechnungswesens, auch in Hinblick auf die stationäre Industrie, enthält. Die KLR-Bau – und natürlich auch diese Abhandlung – hält sich strikt an die Begriffe, wie sie allgemein in der Betriebswirtschaftslehre verwendet werden und wie sie zur Übersicht im Zusammenhang in Bild 1.1 dargestellt sind.
Bild 1.1 Begriffe der Kostenrechnung
Im Mittelpunkt der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise steht das Gesamtvermögen eines Betriebs. Es ist das Allumfassende, enthält alle Vermögensanteile, materielle und immaterielle, und ist ständigen Veränderungen unterworfen.
Betriebsvermögen
ist die Summe aller materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände eines Unternehmens.
Das Betriebsvermögen wird vermindert durch den Aufwand:
Aufwand
umfasst den Güterverbrauch im Unternehmen, wie Löhne, Materialien usw., aber auch Aufwendungen für Reparaturen an Gebäuden, die zum Betriebsvermögen gehören. Steuern gehören ebenfalls zu den Aufwendungen.
Den Aufwendungen steht der Ertrag gegenüber, der das Betriebsvermögen erhöht:
Ertrag
ist der Wertzuwachs des Vermögens in jedweder Form. Dazu gehören die Einnahmen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit genauso wie Dividenden auf Aktien, die zum Betriebsvermögen gehören.
Aufwand und Ertrag umfassen also auch Wertveränderungen, die mit dem eigentlichen Kerngeschäft, dem Bauen selber, nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen. Betrachtet man nun das eigentliche Kerngeschäft in einer Bauunternehmung, so ist hierfür ein „notwendiges Betriebsvermögen“ erforderlich, nämlich Gebäude für die Verwaltung, Geräte und Sachanlagen, Baustoffe, Kassenbestände oder Kredite usw., also alles, was für die Ausübung der Tätigkeit „Bauen“ erforderlich ist. Dieses notwendige Betriebsvermögen unterliegt ebenfalls ständigen Veränderungen. Auf der einen Seite fallen Kosten an:
Kosten
sind der bewertete, betriebsnotwendige Gutsverbrauch zur Erstellung einer Bauleistung.
Die Kosten, die unmittelbar mit der Bautätigkeit entstehen, werden umgesetzt in:
Erlöse
oder Leistungen, bewertet mit Geld als Vergütung der erbrachten Bauleistung.
Es gibt Kosten, die gleichzeitig Ausgaben sind:
Ausgaben
Löhne sind unmittelbar durch Ausgaben zu bezahlen oder auch Materiallieferungen, extern eingekaufte Leistung usw. Bei solchen Positionen handelt es sich um ausgabenwirksame Kosten. Nicht ausgabenwirksame Kosten wären z. B. Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen etc.
Den Kosten stehen, wie dem Aufwand der Ertrag, Einnahmen gegenüber:
Einnahmen
sind die Vergütungen für Bauleistungen und müssen nicht zwangsläufig in Geld erfolgen. Die Überschreibung eines Grundstücks als Gegenleistung für eine Baumaßnahme ist auch eine Einnahme.
Der Geldverkehr wird durch Einzahlungen und Auszahlungen geregelt, deren Bedeutung keiner besonderen Erläuterung bedarf.
Alle anderen Begriffe werden an den entsprechenden Textstellen erläutert.
1.2 Die Finanzbuchhaltung
Obwohl die Finanzbuchhaltung streng genommen zum externen Rechnungswesen gehört, muss sie als Ausgangspunkt für die Kostenrechnung und speziell für die Betriebsbuchhaltung in den Grundzügen erläutert werden.
Die täglich in einem Betrieb anfallenden Wertveränderungen müssen laufend systematisch und vollständig erfasst werden. Das ist eine gesetzliche Vorschrift, da mit der Dokumentation die Grundlagen für die Besteuerung geschaffen werden. Aber auch aus rein betrieblicher Sicht ist die Aufzeichnung der Kosten und Erlösbewegungen unbedingt erforderlich. So liefert z. B. die periodische Gegenüberstellung von Kosten und Erlösen das Betriebsergebnis zum betrachteten Zeitpunkt als eine zentrale Steuerungsgröße. Eine kostendeckende Preisgestaltung ist ohne Kenntnis der Kostenstruktur überhaupt nicht möglich. Nur bei permanenter Verfolgung der Kosten-/Erlössituation ist ein steuerndes Eingreifen in die Prozessabläufe möglich.
Es werden also regelmäßig alle Kostenbewegungen, Rechnungseingänge, der gesamte Zahlungsverkehr aufgeschrieben und dokumentiert. Dabei würde allerdings ein großer „Topf“ nicht ausreichen für die Kosten und ein zweiter für die Einnahmen oder Erlöse. Sowohl die Kosten als auch die Erlöse müssen nach ihrer Art sortiert und auf viele kleine „Töpfe“ verteilt werden.
Das ist aus zwei Gründen notwendig:
Es werden für die Steuerung des Betriebs bestimmte Basiszahlen benötigt, die nur aus einer differenzierten Betrachtung von Kosten und Erlösen gewonnen werden können.
Zweitens sind für den Jahresabschluss als Grundlage für die Besteuerung die Kosten und Erlöse in einer bestimmten, gesetzlich vorgegebenen Aufteilung zu dokumentieren.
Diese kleinen „Töpfe“ sind die verschiedenen Konten der Buchhaltung, die ausgehend von einer übergeordneten Gliederung immer weiter unterteilt und verfeinert werden können. Die Bildung von Konten in der Buchhaltung ist im Prinzip frei wählbar unter Beachtung der steuerlichen Gesichtspunkte, es hat sich aber als zweckmäßig herausgestellt, bestimmte Regeln dabei einzuhalten, die branchenspezifisch festgelegt wurden.
Die Differenzierung beginnt mit der übergeordneten Gliederung, dem sogenannten Kontenrahmen. Es gibt inzwischen die unterschiedlichsten Kontenrahmen wie z. B.
– den Industriekontenrahmen IKR 3 oder IKR 4,
– den Kontenrahmen speziell für Ärzte oder Anwälte,
– den Baukontenrahmen für die Bauwirtschaft und viele mehr.
Der Industriekontenrahmen z. B. ist ziemlich allgemein und universell gehalten und damit für die Zwecke einer kleinen Bauunternehmung oder eines Handwerksbetriebs ungeeignet. Der Baukontenrahmen (BKR) ist von einem Arbeitskreis speziell für die Bauwirtschaft entwickelt worden und bei einer entsprechend weiteren Untergliederung durchaus geeignet, die Einzeldaten der Wertströme zu dokumentieren.
Dieser Kontenrahmen enthält zehn Kontenklassen, die in Tabelle 1.1 dargestellt sind.
Tabelle 1.1 Kontenrahmen
Rechnungskreis I (externer)
Kontenklasse
Bezeichnung
Gruppierungsbereich
0
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Aktivkonten
Bestandskonten (Bilanz)
1
Finanzvermögen
2
Vorräte, Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzung
3
Eigenkapital, Wertberichtigungen und Rückstellungen
Passivkonten
4
Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen
5
Erträge
Ertragskonten
6
Betriebliche Aufwendungen und Kostenarten
Aufwandskonten
Erfolgskonten (Gewinn- und Verlustrechnung)
7
Sonstige Aufwendungen
8
Abgrenzung und Abschluss
Rechnungskreis II (interner)
9
Baubetriebsrechnung einschließlich Abgrenzungsrechnung
Die Finanzbuchhaltung wird im Rechnungskreis I durchgeführt. Da diese Aufzeichnungen den gesetzlichen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Führung von Geschäftsbüchern genügen, wird in vielen kleineren Bauunternehmungen und Handwerksbetrieben nur dieser externe Rechnungskreis verwendet. Über diesen Rechnungskreis I wird am Jahresende die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für den Gesamtbetrieb aufgestellt als Basis für die Steuererklärung oder als Information für Kapitalgeber.
Jede Kontenklasse ist unterteilt in Hauptkonten, die weiter bis zum gewünschten Detaillierungsgrad aufgefächert werden können.
1.2.1 Die Einzelkonten
Im ersten Schritt wird jede Kontenklasse in ca. zehn Hauptkonten untergliedert, in denen Kosten oder Erlöse gleicher Art zusammengefasst sind. Der in den Tabellen 1.2 a-d dargestellte Baukontenrahmen wurde von einer Arbeitsgruppe aufgestellt, ist auf die Belange der Bauwirtschaft zugeschnitten und kann in Betrieben beliebiger Größenordnung zur Anwendung kommen. Dabei ist es gleichgültig, ob sich an die Finanzbuchhaltung noch eine Betriebsbuchhaltung anschließt.
Tabelle 1.2 a Baukontenrahmen (Aktivkonten)
Kontenklasse 0
Kontenklasse 1
Kontenklasse 2
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Finanzvermögen
Vorräte, Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzung
00 Ausstehende Einlagen, Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und immaterielle Vermögensgegenstände
01 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Fabrik- und anderen Bauten
02 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten
03 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne (eigene) Bauten
04 Bauten auf fremden Grundstücken
05 Baugeräte
06 Technische Anlagen und stationäre Maschinen
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung
08 Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen
09 Frei
10 Anteile an verbundenen Unternehmen
11 Ausleihungen an verbundene Unternehmen
12 Beteiligungen
13 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
14 Wertpapiere des Anlagevermögens
15 Sonstige Ausleihungen
16 Anteile an verbundenen Unternehmen
17 Eigene Anteile
18 Sonstige Wertpapiere und Schuldscheindarlehen
19 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
20 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Ersatzteile
21 Nicht abgerechnete (unfertige) Bauleistungen, unfertige Erzeugnisse
22 Fertige Erzeugnisse und Waren
23 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte
24 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen einschließlich Wechselforderungen
25 Forderungen gegen Arbeitsgemeinschaften
26 Frei für interne Verrechnungskonten
27 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften
28 Sonstige Vermögensgegenstände
29 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten, Steuerabgrenzung
Tabelle 1.2 b Baukontenrahmen (Passivkonten)
Kontenklasse 3
Kontenklasse 4
Eigenkapital, Wertberichtigungen und Rückstellungen
Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen
30 Kapitalkosten/gezeichnetes Kapital
31 Kapitalrücklagen
32 Gewinnrücklagen
33 Ergebnisverwendung
34 Ausgleichskosten
35 Sonderposten mit Rücklagenanteil
36 Wertberichtigungen
37 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
38 Steuerrückstellungen
39 Sonstige Rückstellungen
40 Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
41 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
42 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
43 Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitsgemeinschaften
44 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel
45 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften
46 Verbindlichkeiten aus Steuern
47 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit
48 Andere sonstige Verbindlichkeiten
49 Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Tabelle 1.2 c Baukontenrahmen (Erträge und Aufwendungen)
Kontenklasse 5
Kontenklasse 6
Kontenklasse 7
Erträge
Betriebliche Aufwendungen – Kostenarten
Sonstige Aufwendungen
50 Umsatzerlöse aus Bauleistungen
51 Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen und Ergebnisanteile von Arbeits- und Beteiligungsgemeinschaften
52 Sonstige Umsatzerlöse
53 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Bauleistungen
54 Andere aktivierte Eigenleistungen
55 Erträge aus Beteiligungen und sonstigen Finanzanlagen
56 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
57 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens
58 Erträge aus Auflösungen von Wertberechtigungen, Rückstellungen und Sonderposten mit Rücklageanteil
59 Sonstige Erträge, Erträge aus Verlustübernahme und außerordentliche Erträge
60 Personalaufwendungen für gewerbliche Arbeitnehmer, Poliere und Meister sowie Auszubildende
61 Personalaufwendungen für technische und kaufmännische Angestellte sowie Auszubildende
62 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Ersatzteile sowie für bezogene Waren
63 Aufwendungen für Rüst- und Schalmaterial
64 Aufwendungen für Baugeräte
65 Aufwendungen für Baustellen-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
66 Aufwendungen für bezogene Leistungen
67 Verschiedene Aufwendungen
68 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen
69 Frei (für innerbetriebliche Leistungsverrechnung)
70 Abschreibungen auf aktivierte Aufwendungen für die Instandsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs, auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
71 Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens
72 Verluste aus Wertminderungen oder Abgang von Vorräten
73 Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten und Wertpapieren sowie aus der Erhöhung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen
74 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten
75 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
76 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
77 Steuern von Einkommen, vom Ertrag und sonstige Steuern
78 Einschreibungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil
79 Andere Aufwendungen, Aufwendungen aus Verlustübernahme und außerordentliche Aufwendungen
Tabelle 1.2 d Baukontenrahmen (Abschlusskonten)
Kontenklasse 8
Kontenklasse 9
Abgrenzungen und Abschluss
Frei für Kosten- und Leistungsrechnung
80 Betriebsergebnisrechnung
81 Periodische Ergebnisabgrenzung
82 Kalkulatorische Ergebnisabgrenzung
83 Umwertungsabgrenzung
84 Sonstige Ergebnisrechnung
85 Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER)
86 GuV-Rechnung
87 Bilanzrechnung
88 Frei
89 Frei
Die für die Betriebssteuerung wichtigsten Klassen sind Klasse 5 mit den Erlösen und Klasse 6 für die betrieblichen Aufwendungen. Die dort aufgeführten Hauptkonten sind nach Bedarf und nach den individuellen, betriebsbedingten Gegebenheiten weiter aufzuschlüsseln.
Im Lohnbereich wäre z. B. folgende Aufgliederung zu wählen:
Hauptkonto:
Personalaufwendungen gewerblicher Arbeitnehmer, Poliere usw.
Unterkonten:
Tariflöhne
Überstunden und Feiertagszuschläge
Sozialleistungen (freiwillig)
Sozialleistungen (gesetzlich)
Auslösung
Fahrtkosten
Verpflegungsgeldzuschüsse
Ausfalltage
Fortzahlung im Krankheitsfall usw.
Im Materialbereich könnte z. B. für einen Maurerbetrieb gewählt werden:
Hauptkonto:
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Unterkonten:
Mauerwerkssteine
Mörtel
Beton
Betonwaren
Betonfertigteile
Einbauteile
Dämmmaterial
Bewehrung usw.
Diese Unterkonten können bei Bedarf noch weiter untergliedert werden:
Unterkonto:
Mauerwerkssteine
Unter-Unterkonto:
Kalksandsteine
Planblocksteine
Verblendmauerwerkssteine usw.
Und auch die Kalksandsteine können noch verfeinert in die verschiedenen Formate aufgeteilt werden. Allerdings steigt mit dem Detaillierungsgrad auch der Bearbeitungsaufwand in der Buchhaltung.
Beispiel: Auf der Rechnung eines Baustofflieferanten an einen Maurerbetrieb sind verschiedene Steinsorten aufgeführt. Außerdem wird noch ein pauschaler Nachlass eingeräumt.
Wenn für jede Steinsorte ein gesondertes Konto geführt wird, ist die Rechnung zu zerlegen. Auch der pauschale Nachlass muss aufgeteilt werden. Es sind entsprechend den Positionen auf der Rechnung mehrere Buchungen vorzunehmen. Es erhebt sich die Frage, ob diese Aufteilung wirklich wesentliche Aufschlüsse liefert, die den erhöhten Buchungsaufwand rechtfertigen. Grundsätzlich gilt: Je einfacher und übersichtlicher der Kontenplan, umso geringer der Buchungsaufwand. Allerdings muss die Buchhaltung dabei alle benötigten Daten liefern. Bei der Einrichtung einer Buchhaltung und der Festlegung des Detaillierungsgrades ist immer die Frage nach dem Verhältnis Nutzen – Aufwand zu stellen. Es hat sich gezeigt, dass bei einer zu detaillierten Erfassung zwar der Aufwand steigt, die Aussagefähigkeit der Buchhaltung und die Verwertbarkeit der gewonnenen Informationen jedoch fragwürdig bleiben.
Der heute übliche Einsatz von EDV-Programmen in der Buchhaltung reduziert den Buchungsaufwand nicht in einem entscheidenden Maß. Zusammenstellungen und Listen können automatisch erstellt werden. Das eigentliche Erfassen der Belege, die Kontierung, die Zuteilung eventuell auf verschiedene Konten müssen manuell erfolgen und stellen den Hauptaufwand dar.
1.2.2 Die periodische Kostenerfassung
Im laufenden Geschäftsbetrieb, der auf die Erzielung eines Gewinns ausgerichtet ist, muss in regelmäßigen – meist monatlichen – Abständen kontrolliert werden, ob sich das geplante Ergebnis einstellt. Es werden sogenannte kurzfristige Erfolgsrechnungen durchgeführt, für die die Kosten exakt zu einem Stichtag bekannt sein müssen. Dazu wird in der Regel zum Monatsende ein Zwischenabschluss in der Buchhaltung gefahren, um einmal den Stand der Konten zu ermitteln und Kontrollrechnungen durchzuführen. Dazu muss sichergestellt sein, dass die erfassten Werte sich wirklich nur auf den betrachteten Zeitpunkt beziehen und auch tatsächlich vollständig sind. Dies ist nicht automatisch gegeben, denn Rechnungen, Lieferscheine, Wareneingang usw. gehen laufend ein und richten sich nicht exakt an einem Monatsende aus.
Dazu sind Abgrenzungen erforderlich, wie in der Übersicht in Bild 1.2 gezeigt wird.
Bild 1.2 Buchungsabgrenzung
Fall 1:
Material wird vor dem Monatsende angeliefert und verbraucht, die Rechnung lag vor Buchungsschluss vor.
Die Rechnung wird mit dem geprüften Betrag eingebucht.
Fall 2:
Wie Fall 1, aber es lag keine geprüfte Rechnung vor, dafür ein Lieferschein.
Die Lieferung wird anhand des Lieferscheins kostenmäßig bewertet, der Betrag als Buchergänzung eingebucht.
Fall 3:
Material wurde geliefert, aber bis zum Monatsende nur zum Teil verbraucht. Die Rechnung lag geprüft vor.
Die Rechnung wird gebucht, der Betrag aber um den nicht verbrauchten Anteil des Materials abgemindert.
Fall 4:
Material wurde vor dem Monatsende geliefert, aber nicht ganz verbraucht, eine Rechnung lag nicht vor.
Die Lieferung wird mit dem Lieferschein bewertet, das nicht verbrauchte Material wird gebucht und der lagernde Bestand als Ergänzung eingebucht.
Fall 5:
Ein Nachunternehmer reicht zum Monatsende eine Abschlagsrechnung ein, der Bauleiter hat aber bereits einen anderen Betrag in der Leistungsmeldung berichtet.
Die Rechnung wird eingebucht, der Differenzbetrag als Korrektur abgegrenzt.
Fall 6:
Zum Monatsende liegt noch keine Rechnung eines Nachunternehmers vor, der Bauleiter hat aber eine entsprechende Leistung gemeldet.
Der Wert der gemeldeten Leistung wird als Buchergänzung erfasst.
Solche und andere Überlegungen müssen, bezogen auf das Monatsende, zum Buchungsschluss angestellt werden, damit bei der Feststellung des Ergebnisses volle, periodenechte Übereinstimmung von Kosten und Leistung herrscht. Dabei spielt der Zeitfaktor eine entscheidende Rolle. Je später der Buchungsschluss und das Abschlussdatum selbst gelegt werden, umso sicherer ist die Vollständigkeit der Kosten für den Abrechnungszeitraum. Allerdings leidet die Aktualität dann in erheblichem Maße und mit der verminderten Aktualität die Möglichkeit, rechtzeitig steuernd eingreifen zu können.
Früher wurde der Termin des Buchhaltungsabschlusses von der Beendigung der Lohnabrechnung bestimmt. Bis alle Lohnberichte in einer Bauunternehmung von den einzelnen Baustellen z. T. auf dem Postweg in der Verwaltung vorlagen und meistens manuell ausgewertet waren, vergingen sieben bis zehn Arbeitstage nach Monatsende. Im Zuge der EDV-Einführung und der Datenübermittlung über das Internet auch in diesem Bereich hat sich diese Zeitspanne auf wenig Tage reduziert. Sind alle Abgrenzungen und Ergänzungen vorgenommen worden, dann könnte ein Monatsabschluss in Kontenklasse 6 der Finanzbuchhaltung einer Bauunternehmung wie folgt aussehen (Tab. 1.3):
Tabelle 1.3 Vereinfachter Monatsabschluss
Übersicht Finanzbuchhaltung zum 31. August 2016
Kontengruppe
Bezeichnung
bis Ende Vormonat
im Monat
Gesamt
60
Personalaufwendungen für gewerbliche Arbeitnehmer
746.902,56
109.038,69
855.941,25
61
Personalaufwendungen für Angestellte
72.251,73
9.780,00
82.031,73
62
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
770.736,36
85.617,05
856.353,41
63
Aufwendungen für Rüst- und Schalmaterial
37.600,10
6.907,15
44.507,25
64
Aufwendungen für Baugeräte
15.716,33
5.231,56
20.947,89
65
Aufwendungen für Baustellen- und Geschäftsausstattung
67.315,30
9.512,99
76.828,29
66
Aufwendungen für bezogene Leistungen
23.216,89
3.456,00
26.672,89
67
Verschiedene Aufwendungen
39.347,40
8.500,33
47.847,73
68
Aufwendung aus der Zuführung zu Rückstellungen
14.000,00
2.000,00
16.000,00
69
Frei für innerbetriebliche Verrechnung (entfällt)
Gesamt
1.787.086,67
240.043,77
2.027.130,44
Damit sind alle zum 31.08. angefallenen Betriebsausgaben erfasst, bekannt und dokumentiert und es wurde eine Basis für die weiteren Betrachtungen geschaffen. Diese Übersicht der Kosten zum Monatsende ist rein schematisch und damit sehr übersichtlich. Grundlage dafür könnte z. B. eine Buchhaltung in Reihenform mit tabellarischer Zusammenstellung der Abschlussbeträge sein. Diese Form ist zwar sehr übersichtlich, ist aber heute ersetzt durch die „Doppelte Buchführung“.
1.2.3 Die Buchhaltungsverfahren
1.2.3.1 Die Staffelbuchhaltung
Die einfachste Form der Kostenerfassung ist die Staffelbuchhaltung (Tab. 1.4). Die Einnahmen und Ausgaben, Kosten und Erlöse werden fortlaufend, wie sie anfallen, erfasst und in das Konto eingetragen. Am Ende eines Tages oder einer Woche wird die Zwischensumme ermittelt, sodass immer ein Überblick z. B. über den Kontostand besteht. Alle Geschäftsvorfälle werden mit Plus- oder Minuszeichen in der Reihenfolge ihres Auftretens eingetragen. Diese Buchhaltung mag für ganz einfache und übersichtliche Verhältnisse genügen, aber erlaubt überhaupt keine Aufschlüsse über differenzierte Kostenarten. Kompliziertere Geschäftsvorfälle wie offene Forderungen, Vorsteuerproblematik usw. sind nicht oder nur schwierig darstellbar.
Tabelle 1.4 Buchhaltung in Staffelform
Vorgang
Datum
Betrag
Anfangsbestand
01.01.2016
1.500,00
Zahlung durch Kunden A
03.01.2016
1.000,00
Bezahlung Miete
03.01.2016
–500,00
Summe
2.000,00
Zahlung Stromrechnung
05.01.2016
–150,00
Zahlung Benzin
05.01.2016
–60,00
Gehaltszahlung Teilzeit
05.01.2016
–440,00
Summe
1.350,00
Verkauf 10 · Produkt B
06.01.2016
2.030,00
Barentnahme
06.01.2016
–500,00
usw.
1.2.3.2 Die Reihenbuchhaltung
Der nächste Schritt ist die Buchhaltung in Reihenform (Tab. 1.5). Hierbei wird unterschieden zwischen Einnahmen und Ausgaben, die in gesonderten Spalten nebeneinander aufgezeichnet werden. Diese Schreibweise ist aber noch keine wesentliche Verbesserung der Darstellung gegenüber der Staffelbuchhaltung. Sonstige Wertveränderungen wie z. B. Abschreibungen von Sachanlagen, ausstehende Rechnungen usw. müssen gesondert behandelt werden, wenn der wirtschaftliche Stand eines Unternehmens zu einem Stichtag ermittelt werden soll.
Man könnte dies eine „Goldgräber-Buchhaltung“ nennen. Der Goldgräber kauft sich eine Ausrüstung und hat damit Ausgaben. Er fängt an zu schürfen und findet Gold, das mit Bareinnahmen gleichzusetzen ist. Am Ende der Schürfperiode werden die Einnahmen gezählt und die Ausgaben davon abgesetzt. Eine Verfeinerung dieser Betrachtungsweise wäre die Berücksichtigung des Restwerts der Ausrüstung, wenn der Verkauf gelingt.
Tabelle 1.5 Buchhaltung in Reihenform
Vorgang
Datum
Betrag
Einzahlung
Auszahlung
Anfangsbestand
01.01.2007
1.500,00
Zahlung durch Kunde A
03.01.2007
1.000,00
Bezahlung Miete
–500,00
Zahlung Stromrechnung
05.01.2007
–150,00
Zahlung Benzin
05.01.2007
–60,00
Gehaltszahlung Teilzeit
–440,00
Verkauf 10 · Produkt B
06.01.2007
2.030,00
Barentnahmen
06.01.2007
–500,00
Summe
4.530,00
–1.650,00
1.2.3.3 Der Saldo
Mit der Buchhaltung in Reihenform wurde der Saldo eingeführt (Tab. 1.6). Es gilt eine Grundregel in der Buchhaltung, nach der jedes Konto und jede Bilanz in der Endsumme ausgeglichen sein müssen, was natürlich nicht der Fall ist. Mit dem Saldo wird der Ausgleich aber erreicht.
Tabelle 1.6 Einführung des Saldos
Vorgang
Datum
Betrag
Einzahlung
Auszahlung
Anfangsbestand
01.01.2007
1.500,00
Zahlung durch Kunde A
03.01.2007
1.000,00
Bezahlung Miete
–500,00
Zahlung Stromrechnung
05.01.2007
–150,00
Zahlung Benzin
05.01.2007
–60,00
Gehaltszahlung Teilzeit
–440,00
Verkauf 10 · Produkt B
06.01.2007
2.030,00
Barentnahmen
06.01.2007
–500,00
Summe
4.530,00
–1.650,00
Saldo
–2.880,00
Ausgeglichener Kontostand
4.530,00
–4.530,00
Der Saldo ist also nichts anderes als die Differenz der Einzahlungen und Auszahlungen, die je nach Vorzeichen einmal links oder rechts eingetragen wird.
1.2.3.4 Die doppelte Buchhaltung
Der nächste Schritt sind Konten in T-Form (Tab. 1.7), die für jede Kostenart eingeführt wurden. Jedes Konto besteht aus zwei Teilen, einem Soll- und einem Haben-Teil. Diese Bezeichnungen sind vollkommen willkürlich und habe nichts mit Einnahmen und Ausgaben zu tun, obwohl bei den Aktivkonten unter „Soll“ Zugänge und unter „Haben“ Abgänge vermerkt werden. Dies ist aber bei Passivkonten genau umgekehrt. Die Bedeutung von Aktivkonten und Passivkonten wird im Weiteren erläutert. Im Zusammenhang mit den hier diskutierten Themen interessieren aber in erster Linie die Aktivkonten.
Tabelle 1.7 Konto in T-Form
Kassenkonto
Soll
Haben
Anfangsbestand
1.500,00
Bezahlung Miete
500,00
Zahlung Kunde A
1.000,00
Stromrechnung
150,00
Verkauf Produkte
2.030,00
Benzin
60,00
Gehalt Teilzeit
440,00
Entnahme
500,00
Saldo
2.880,00
Zum Stichtag
4.530,00
4.530,00
Die Erkenntnis, dass alle Buchungen untereinander in Beziehung stehen, hat zur doppelten Buchführung geführt, mit der sich alle Geschäftsvorfälle eindeutig darstellen lassen (Tab. 1.8). Grundlage der doppelten Buchführung ist ein Denken in Beständen. Einer Verminderung des Bestands an einer bestimmten Sache geht mit einer Erhöhung des Bestands an einer anderen Sache einher. Global betrachtet erfolgt beim Produktionsprozess eine Verminderung der Ressourcen, aber eine Erhöhung des Bestands an fertigen Produkten. Der Verkauf der Produkte reduziert den Bestand an diesen, erhöht aber den Kassenbestand usw. Die doppelte Buchführung mag zunächst etwas umständlich wirken, ist aber in sich völlig logisch und erfasst jedes Detail im Rechnungswesen.
Tabelle 1.8 Konto bei doppelter Buchführung
Beispiel 1:
Eine Ware ist an einen Kunden 1 verkauft, der Rechnungsbetrag wird in dem Konto „Forderungen“ auf der Soll-Seite vermerkt, da es sich um einen Zugang zu den Forderungen handelt. Mit Sicherheit stehen dieser Forderung auf anderen Konten, die in diesem Beispiel nicht betrachtet werden, Kosten für Material, Löhne usw. gegenüber.
Der Kunde bezahlt die Rechnung. Dies ist ein Abgang auf der Haben-Seite der Forderungen, aber ein Zugang auf der Soll-Seite der Erträge. Gleichzeitig ist es aber auch ein Zugang auf dem Konto der Bank.
Beispiel 2:
Einer Teilzeitkraft wird ihr Gehalt vom Konto der Bank gezahlt. Dies ist auf dem Konto ein Abgang. Auf dem Konto „Gehälter“ ist es aber ein Zugang im Sinne von: Die Summe der gezahlten Gehälter ist gestiegen.
Mit diesen beiden Beispielen wird deutlich, wie verflochten die Zahlungsvorgänge sind. Dies wird mit der doppelten Buchführung exakt abgebildet (Tab. 1.9). Deswegen ist heute bis auf wenige Ausnahmen die doppelte Buchführung die Standard-Buchführung.
Tabelle 1.9 Monatsübersicht bei doppelter Buchführung
Sachkonten
Summe per 30.07.2016
Summe im August 2016
Saldo per 31.08.2016
Konto
Kontobezeichnung
Soll
Haben
Soll
Haben
Soll
Haben
0100
Bank
1.786.186,67 €
240.943,77 €
2.027.130,44 €
6000
Löhne Gewerbliche
746.902,56 €
109.038,69 €
855.941,25 €
6100
Gehälter Angestellte
72.251,73 €
9.780,00 €
82.031,73 €
6200
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
770.736,36 €
85.617,05 €
856.353,41 €
6300
Schalung und Rüstung
37.600,10 €
6.907,15 €
44.507,25 €
6400
Baugeräte
15.716,33 €
5.231,56 €
20.947,89 €
6500
Baustellen- und Geschäftsausstattung
67.315,30 €
9.512,99 €
76.828,29 €
6600
Bezogene Leistung
23.216,89 €
3.456,00 €
26.672,89 €
6700
Verschiedene Aufwendungen
39.347,40 €
8.500,33 €
47.847,73 €
6800
Rückstellungen
14.000,00 €
2.000,00 €
16.000,00 €
Summe
1.787.086,67 €
1.786.186,67 €
240.043,77 €
240.943,77 €
2.027.130,44 €
2.027.130,44 €
Die Kostenzusammenstellung nach Tabelle 1.3 ist mit einer Buchführung in Reihenform entstanden. Mit der doppelten Buchführung unter Einbeziehung des Saldos kommt man natürlich zu dem gleichen Ergebnis. Nur die Darstellungsweise ist eine andere.
1.3 Der Jahresabschluss
Zum Jahresende wird in jedem Unternehmen ein Jahresabschluss der Buchhaltung vorgenommen mit der Zielsetzung
– die Vermögensverhältnisse zu bestimmen,
– den Gewinn/Verlust festzustellen.
Die dabei ermittelten Werte sind nicht nur die Basis für die Steuerfestsetzung, sie dienen ebenfalls dazu, die Entwicklung eines Unternehmens deutlich zu machen und sind gegebenenfalls die Grundlage für Kreditaufnahme, Nachweis der wirtschaftlichen Entwicklung gegenüber Teilhabern und Ähnliches.
Hier gilt nun die gesetzliche Unterscheidung nach kleinem und großem Betrieb. Ein Betrieb ist nach dem Gesetz groß, wenn ein Umsatz von 500.000 € überschritten wird oder der Gewinn oberhalb von 50.000 € liegt. Dann ist der Betrieb verpflichtet, eine Bilanz zu erstellen. Die Frage, ob eine Betriebsbuchhaltung gefahren wird, ist dabei ohne Bedeutung. Liegen die Werte darunter, zählt das Unternehmen zu den kleineren Betrieben und muss lediglich eine Gewinn- und Verlustrechnung aufstellen.
Die Führung der Finanzbuchhaltung ist gesetzlich Pflicht, mit ihr lassen sich in jedem Fall die Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen.
1.3.1 Die Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist im Wesentlichen die Gegenüberstellung von Erlösen und Kosten, ergänzt durch Abschreibungen, Abgrenzungen und vieles mehr. Die Differenz ist entweder der Gewinn oder der Verlust. Für diese Art des Jahresabschlusses gibt es gesonderte Buchungsprogramme, die im Prinzip eine Erweiterung der in Tabelle 1.9 dargestellten Kostenübersicht ist. Ergänzt man nämlich die Erlösseite, erhält man das Ergebnis als Gewinn oder Verlust (Tab. 1.10).
Tabelle 1.10 Erweiterte Monatsübersicht als Gewinn- und Verlustrechnung
SACHKONTEN
Summe per 30.07.2016
Summe im August 2016
Saldo per 31.08.2016
Konto
Kontobezeichnung
Soll
Haben
Soll
Haben
Soll
Haben
5000
Umsatzerlöse
1.852.690,21 €
250.551,50 €
2.103.241,71 €
6000
Löhne Gewerbliche
746.902,56 €
109.038,69 €
855.941,25 €
6100
Gehälter Angestellte
72.251,73 €
9.780,00 €
82.031,73 €
6200
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
770.736,36 €
85.617,05 €
856.353,41 €
6300
Schalung und Rüstung
37.600,10 €
6.907,15 €
44.507,25 €
6400
Baugeräte
15.716,33 €
5.231,56 €
20.947,89 €
6500
Baustellen- und Geschäftsausstattung
67.315,30 €
9.512,99 €
76.828,29 €
6600
Bezogene Leistung
23.216,89 €
3.456,00 €
26.672,89 €
6700
Verschiedene Aufwendungen
39.347,40 €
8.500,33 €
47.847,73 €
6800
Rückstellungen
14.000,00 €
2.000,00 €
16.000,00 €
6900
Abgrenzungen und Ergänzungen
25.710,00 €
3.667,45 €
29.377,45 €
Summe
1.812.796,67 €
1.852.690,21 €
243.711,22 €
250.551,50 €
2.056.507,89 €
2.103.241,71 €
1000
Bank
46.733,82 €
Diese Zusammenstellung ist gegenüber dem vereinfachten Monatsabschluss im Hauptkonto 6900 durch Abgrenzungen und Ergänzungen erweitert. Diese werden immer erforderlich sein, um datumsgenau Aufwand und Ertrag in Übereinstimmung zu bringen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nicht nur zum Jahresende möglich, sondern auch bei einer entsprechenden periodenechten Kostenerfassung und periodenechten Einnahmendarstellung jeweils zum Monatsende. Deswegen wird auch dieses Rechenwerk die „Kurzfristige Erfolgsrechnung“ genannt. Diese monatliche Gewinn-/Verlustermittlung ist für die Steuerung des Unternehmens von entscheidender Bedeutung, wie später noch gezeigt wird. Auch die kurzfristige Erfolgsrechnung wird in Kapitel 1.4 „Die Betriebsabrechnung“ ausführlich behandelt und deswegen hier nur erwähnt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung nach klassischer Art (Tab. 1.11) ergab sich direkt aus der Zusammenfassung der Kontenklassen 5 und 6, wie sie in Tabelle 1.2 dargestellt ist, und genügte in einer etwas anderen Form den gesetzlichen Forderungen nach § 275 HGB.
Tabelle 1.11 „Alte“ Gewinn- und Verlustübersicht
Umsatzerlöse
+
Bestandserhöhungen und Eigenleistung
Gesamtleistung
–
Material und Fremdleistung
Rohergebnis
–
Zinserträge und sonstige Erträge
Gesamt-Rohergebnis
–
Personalaufwand
–
Abschreibungen
–
Sonstige betriebliche Aufwendungen
–
Abgrenzungen
–
Steuern
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Da diese Zusammenstellung sehr übersichtlich ist, wird sie weiterhin zum internen Gebrauch empfohlen, auch von der KLR-Bau 2016. Die neuen gesetzlichen Vorschriften des HGB sehen eine andere Gliederung vor und in dieser Form (Tab. 1.12) ist die Gewinn- und Verlustrechnung als Ergänzung zur Bilanz aufzustellen.
Tabelle 1.12 „Neue“ Gewinn- und Verlustrechnung nach§ 275 HGB
1.
Umsatzerlöse
2.
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3.
Andere aktivierte Eigenleistungen
4.
Sonstige betriebliche Erträge
5.
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
6.
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
7.
Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese übliche Abschreibungen überschreiten
8.
Sonstiger betrieblicher Aufwand
9.
Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen
10.
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens
11.
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
14.
Steuern vom Einkommen und Ertrag
15.
Ergebnis nach Steuern
16.
Sonstige Steuern
17.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
1.3.2 Die Bilanz
Größere Unternehmen wie GmbHs und Aktiengesellschaften sind verpflichtet, jeweils zum Jahresende eine Bilanz zu erstellen. Die Bilanz ist nichts anderes als die Gegenüberstellung der Vermögensverhältnisse zu Beginn eines Jahres und zum Ende, sodass die Veränderungen deutlich werden. Die Bilanz entspringt dem Bestandsdenken, wobei alle Vermögenswerte eines Unternehmens einbezogen werden, auch solche, die nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebsgeschehen stehen. Dies können z. B. Beteiligungen an anderen Unternehmen, Immobilienbestände, Wertpapiere usw. sein.
Eine Bilanz ist wie ein T-Konto angelegt, anstelle von Soll und Haben werden aber die Begriffe Aktiva und Passiva gewählt. Auf der Aktivseite steht, wofür das Kapital angelegt oder ausgegeben wurde, auf der Passivseite ist vermerkt, woher das Kapital gekommen ist (Tab. 1.13). Die Werte auf der Aktivseite ergeben sich aus den Aktivkonten, die der Passivseite aus den Passivkonten. Beide Kontenarten sind T-Konten mit Soll und Haben. Zugänge werden bei den Aktivkonten auf der Soll-Seite verbucht, bei den Passivkonten auf der Haben-Seite. Mit den Abgängen verhält es sich umgekehrt.
Tabelle 1.13 Bilanzgliederung
Diese Darstellung steht in Übereinstimmung mit Tabelle 1.1, den Rechnungskreisen. Die Klassen 0, 1 und 2 sind die Vermögenskonten, in den Klassen 3 und 4 wird eine Aussage über die Kapitalherkunft getroffen. Von den weiteren Kontenklassen werden nur die zusammengefassten Werte, z. B. in Form des Betriebsergebnisses in der Bilanz, z. B. im Finanzvermögen, erfasst. Für jede Position in der Bilanz steht in der Buchhaltung ein Konto bzw. eine Vielzahl von Konten mit Soll und Haben. Die Bilanzposten sind nun nichts weiter als die Salden der Aktiv- bzw. Passivkonten, die entweder links oder rechts eingetragen werden.
Tabelle 1.14 Bilanz-Systematik
Aus der Bilanz sind also abzulesen: die Situation am Jahresbeginn, die Veränderungen im laufenden Jahr und die neue Situation am Jahresende. Um die Übersichtlichkeit zu erhalten, werden dabei in der Bilanz nicht alle Konten der Buchhaltung abgebildet, sondern nur deren Zusammenfassungen (Tab. 1.14).
Die Bilanz oder die gesamtbetriebliche Gewinn- und Verlustrechnung sagt nur begrenzt etwas über das sogenannte Kerngeschäft der Unternehmung aus. Viele Unternehmer, gerade im mittelständischen Bereich, bauen in konjunkturell schlechten Wirtschaftslagen, in denen es an Aufträgen mangelt, auf eigene Rechnung und vermehren damit das Betriebsvermögen. Dies geschieht aus zwei Gründen:
– Die eigenen Kapazitäten werden ausgelastet und damit über „schlechte“ Zeiten gehalten.
– Das Eigenkapital des Unternehmens wird vergrößert und die Absicherung des Unternehmensbestands verbessert.
Auf diese Weise entstehen „Immobilienunternehmen mit angegliedertem Baubetrieb“. Eine Bilanz oder eine Gewinn- und Verlustrechnung des Gesamtunternehmens sagt wenig über den Erfolg des Baubetriebs aus. Auf diesen sind aber die hier dargestellten Überlegungen fokussiert. Hier bieten Betriebsabrechnungen wesentlich bessere Aufschlüsse, sind die eigentlichen Instrumente zur Unternehmenssteuerung und stehen deswegen im Vordergrund der weiteren Betrachtungen. Auf die Bilanz wird nicht weiter eingegangen.
1.4 Die Betriebsbuchhaltung
Mit der Finanzbuchhaltung werden laufend Kosten, Erlöse und sonstige Wertveränderungen für den Gesamtbetrieb erfasst und dokumentiert. Dabei wird in keiner Weise vermerkt, welches der verursachende Betriebsteil ist. Bei komplexeren Betrieben mit mehreren Abteilungen und größeren Baustellen liefert eine Aufgliederung und Zuordnung des Zahlenwerkes aus der Buchhaltung auf diese Organisationseinheiten konkrete Hinweise auf die wirtschaftliche Situation in den einzelnen Betriebsteilen. Entwickelt sich z. B. das betriebliche Gesamtergebnis nicht nach Plan, dann liefert die Kontrolle der Ergebnisse der einzelnen Bereiche konkrete Hinweise auf die Quelle der Abweichungen. Damit sind gezielte Ansatzpunkte für weitere Analysen gegeben. Zu diesem Zweck wird neben der Finanzbuchhaltung eine sogenannte Betriebsbuchhaltung gefahren. Alle Kosten und jeder Aufwand werden zunächst in der Finanzbuchhaltung erfasst und dann in einem zweiten Schritt auf den Verursacher weiterverbucht. Voraussetzung für die Einführung einer Betriebsbuchhaltung ist die Unterteilung in diese Verursacher oder auch in der allgemein üblichen Bezeichnung: in Kostenstellen.
1.4.1 Die Kostenstellengliederung
Ein mittlerer oder größerer Betrieb besteht in der Regel aus mehr oder weniger selbstständigen organisatorischen Einheiten. Dies sind die Abteilungen oder sonstige abgeschlossene Bereiche und die Baustellen. Die Kostenstellengliederung lehnt sich deswegen stark an die organisatorische Gliederung an. Danach empfiehlt sich für einen Baubetrieb z. B. folgende Kostenstellengliederung:
– Allgemeine Verwaltung
– Fuhrpark
– Bauhof und Lagerplatz
– Technisches Büro
– Arbeitsvorbereitung
– Baustelle A
– Baustelle B usw.





























