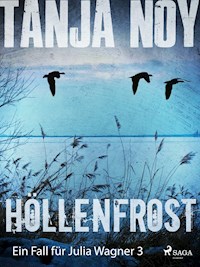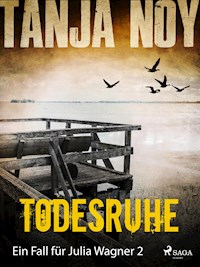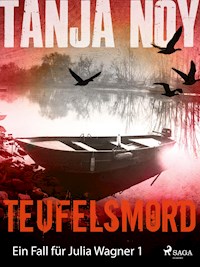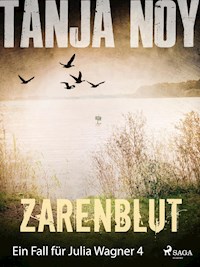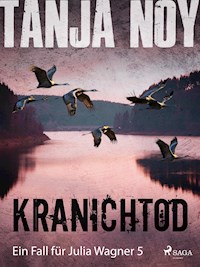
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Julia Wagner
- Sprache: Deutsch
Das große Finale für Julia Wagner – der fünfte und letzte Teil der fesselnden Krimireihe: Julia verfolgt den sogenannten Zaren, den gerissenen Kopf des Kranich-Geheimbunds, und ihre Lage wird immer gefährlicher. Ganz deutlich zeichnet sich ab, dass die Stränge weit zurück in ihre Vergangenheit laufen. Gleichzeitig stößt Susanne, die zurück in Norwegen ist, auch auf die Spur der Kraniche. Noch einmal müssen die beiden Frauen ihre Kräfte bündeln, um den Kampf zu gewinnen...Eine bis zur letzten Seite spannende Krimireihe, in deren Zentrum die ehemalige Polizistin Julia Wagner steht, die mit ihrem früheren Kollegen Zander so manch rätselhaften und gefährlichen Fall löst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tanja Noy
Kranichtod - Ein Fall für Julia Wagner: Band 5
Für Katja. Immer.
Saga
Kranichtod - Ein Fall für Julia Wagner: Band 5Coverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 2017, 2020 Tanja Noy und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726643107
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
TEIL 1
1. KAPITEL
Der Turm der Seelen
23. Dezember 2010
Hannover
16:46 Uhr
Der Wind pfiff auf eine Art und Weise, wie sie es noch nie zuvor gehört hatten, während nadelspitze Kristalle durch die Luft und ihnen in die Gesichter jagten. Frierend zog Eva sich die Strickmütze etwas weiter über die Ohren und sagte: „Es kommt mir vor, als würden wir uns auf dem Mond bewegen.“
Und da hatte sie nicht unrecht. Einmal ganz davon abgesehen, dass sie in ihren dicken Jacken und den unförmigen, kniehohen Stiefeln tatsächlich aussahen wie Mitglieder einer Mondlandungsexpedition, hätte ein Abend auf dem kalten Mond vor allem nicht einsamer sein können. Erst sehr weit hinter ihnen war das Glitzern der fernen Lichterkette zu sehen, die Stadt und Leben bedeutete. Vor ihnen schlängelte sich lediglich ein schmaler Weg, kaum breiter als ein Nadelöhr. Das einzige Geräusch - abgesehen vom launischen Wind, der abwechselnd mal drohend und mal melancholisch pfiff - waren ihre Schritte im hohen Schnee. Am dunklen Himmel war nicht ein einziger Stern zu sehen, übrigens auch kein Mond, und allmählich ging ihnen die Puste aus.
Julia blieb stehen, kniff die Augen zusammen und sah einen Moment lang in den dunklen Himmel. Dann blickte sie wieder geradeaus. Vor ihnen tauchten bereits die unregelmäßigen Konturen des Turms auf, der sich eindrucksvoll über der weißen Schneelandschaft erhob.
„Ich finde diesen Turm unheimlich“, bemerkte Eva, ohne stehen zu bleiben.
„Es ist ein ganz normaler Turm.“ Julia setzte sich wieder in Bewegung und folgte ihr. „Im Sommer eine Touristenattraktion und jetzt im Winter eben einsam und verlassen.“
Eva machte ein Geräusch, das nicht zu deuten war. „Es ranken sich jede Menge Gerüchte darum, das weißt du. Es heißt, er sei seit seiner Erbauung das Tor zu einer anderen Welt. Es wird behauptet, er wäre die Heimat aller bösen Geister und …“
„Hör auf damit, okay? Wir dürfen nicht darauf hereinfallen.“
„Worauf?“
„Auf solche Legenden. Das ist genau die Art Angst, die die Kraniche schüren. Und gerade du als Wissenschaftlerin glaubst ja wohl an die Macht der Tatsachen und des wissenschaftlichen Beweises. Nicht an solchen Aberglauben.“
Eva schob ihren Schal etwas weiter übers Gesicht, sofort blieben die Schneeflocken in der weichen Wolle hängen und durchnässten sie noch weiter. „Gerade in der Wissenschaft ist nichts unmöglich, Julia. Nur im wissenschaftlichen Sinne unwahrscheinlich. Und nach allem, was wir bereits hinter uns haben …“
„Es ist nur ein alter Turm. Daran ist absolut nichts Übernatürliches. Können wir es bitte dabei belassen?“
„Wenn du meinst.“ Eine unerwartet heftige Windbö erwischte Eva und brachte sie ins Wanken. Mühsam kämpfte sie um ihr Gleichgewicht.
„Häng dich bei mir ein“, sagte Julia, die ebenfalls Schwierigkeiten hatte, das Gleichgewicht zu halten.
Eva griff nach ihrem Arm und hielt sich daran fest. „Und übrigens sage ich als Wissenschaftlerin auch“, setzte sie nach ein paar weiteren Metern hinzu, „dass der Schlüssel zu jedem Geheimnis in der Dekonstruktion liegt. Das Ganze muss zerlegt werden, um die Einzelteile zum Vorschein zu bringen. Die einzelnen Teile sind bedeutungsvoller als das Ganze.“
„Die Einzelteile haben vor einer Stunde noch vor uns auf dem Tisch gelegen“, gab Julia zurück. „Drei Schlüssel, ein Medaillon, ein Schwert und ein paar Kinderzeichnungen. Und bis auf das Medaillon gab mir nichts davon eine Antwort.“
„Hast du es bei dir?“
„Was?“
„Das Medaillon.“
„Ja.“
„Zeig es noch mal.“
„Jetzt?“
„Ja.“
Julia blieb stehen und zog das Medaillon mit einem Seufzer aus ihrer Jackentasche. Es war rund, golden und mit allerlei Motiven und Schriftzügen verziert. Stunden hatten sie mit dem Versuch verbracht, es zu öffnen, doch es gab keine erkennbare Möglichkeit. Sie hatten es in alle Richtungen gedreht und nach Ritzen Ausschau gehalten, in die man einen Fingernagel hätte schieben können. Nichts. Das Medaillon war und blieb verschlossen. Was ihnen am Ende weitergeholfen hatte, waren die Gravuren auf dem Deckel. Kreise, Striche, Kreuze und Punkte. Eine Schrift, krakelig und völlig fremd, eine Sprache, die man nicht in der Schule lernte. Nicht Griechisch, nicht Hebräisch, nicht Arabisch. Trotzdem konnte Julia ihre Bedeutung verstehen. Jedenfalls teilweise: Die Engel leiten dich. Und: Seelenturm.
Sie steckte das Medaillon zurück in die Jackentasche. Den Seelenturm, den Turm der Seelen, hatten sie gefunden. Was jetzt kam, was sie dort erwartete, stand in den Sternen.
Sie setzten sich wieder in Bewegung und marschierten schweigend ein paar Meter.
„Und was ist mit dem fürchterlichen Schwert?“, fragte Eva dann.
Julia spürte, wie ihr linkes Auge unwillkürlich anfing unkontrolliert zu zucken. Sie trug es bei sich, in dem großen Seesack, der über ihrer Schulter hing. Das fürchterliche Schwert.
„Es wirkt ziemlich alt, oder?“, fügte Eva hinzu. „Fast so, als käme es aus dem Mittelalter.“
„Vielleicht ist das Absicht.“ Julia schwieg einen Moment und fügte dann hinzu: „Auf jeden Fall wollte Sten Kjaer mich damit umbringen.“ Für einen kurzen Augenblick sah sie die Bilder wieder vor sich, sah sich selbst, sah Kjaer, sah den Kampf mit ihm, bei dem sie ganz auf sich alleine gestellt gewesen war. Er hatte das Schwert. Sie hatte nichts. Und trotzdem hatte sie den Kampf gewonnen.
„Ich habe einmal irgendwo gelesen, dass ein Schwert die Seele seines Kriegers in sich trägt“, bemerkte Eva. „Und manchmal auch die Seelen derjenigen, die durch das Schwert starben.“
„Wirklich? Das würde bedeuten, dass Kjaer jetzt auf meiner Schulter sitzt.“ Julia verzog das Gesicht. „Das würde mir gar nicht gefallen.“
„Wie auch immer. Du warst besser als er.“
„Ich weiß nicht, ob ich wirklich besser war. Wahrscheinlich hatte ich einfach nur mehr Glück.“
Kurze Zeit später hatten sie den Turm erreicht.
„Wir sind da. Gott sei Dank.“ Die Erleichterung in Evas Stimme war nicht zu überhören.
Julia blickte nach oben und spürte, wie ihr Herz zu pochen begann. Sie senkte den Blick wieder und leuchtete mit der Taschenlampe den Eingang des Turms an. Dort verdichtete sich ihr Schein zu einer unruhigen Lache aus Licht. „Lass uns reingehen und es hinter uns bringen.“
Während sie die steilen Steintreppen hinaufstiegen, schien sich das Stöhnen des Windes auf einmal zu verändern. Jetzt hörte er sich plötzlich an wie ein altes Ungeheuer, das aus einem jahrhundertelangen Schlaf erwacht war.
„Mann, das ist wirklich unheimlich“, murmelte Eva.
„Es ist nur der Wind“, sagte Julia. „Nur der Wind.“
Oben abgekommen befanden sie sich in zwanzig Metern Höhe und unter ihnen breitete sich ein lang gestrecktes weißes Tal aus. Die Häuser am Horizont waren kaum noch auszumachen, lediglich ein paar schwache Lichter waren durch die dichten Schneeflocken zu erkennen. Unheimlich und gleichzeitig wunderschön wirkte der Ausblick, wie aus der Wirklichkeit herausgelöst.
Eva zog ein Papiertaschentuch aus ihrer Jackentasche und schnäuzte sich. „Unter anderen Umständen würde ich Fotos machen und sie mir zu Hause an die Wand hängen.“ Sie steckte das Taschentuch zurück in die Jackentasche und sah sich um. „Also, wonach könnten wir hier suchen? Nach einer Notiz? Einer Botschaft?“
„Ich weiß es nicht. Ich …“ Julia stockte. „Hörst du das?“
„Was?“
„Diese Melodie.“
„Was für eine Melodie?“
Julia starrte Eva an. „Hörst du es denn nicht?“
„Nein. Ich höre nichts, nur den Wind.“
Julia stand völlig starr. „Jetzt ist es wieder weg. Ist das dein Ernst? Du hast es wirklich nicht gehört?“
„Nein, wirklich nicht.“
Langsam schüttelte Julia den Kopf. „Dann habe ich es mir wohl nur eingebildet. Ich bin ja im Moment auch nicht gerade berühmt für meinen klaren Verstand.“
„Was war es für eine Melodie?“, wollte Eva wissen. „Hast du sie erkannt?“
„Nein, es war keine … bestimmte Melodie. Es klang so, als ob …“ Noch einmal schüttelte Julia den Kopf. „Ich weiß es nicht. Ich habe es mir wohl wirklich nur eingebildet.“
Einen Moment lang sah Eva sie prüfend an. Dann sagte sie: „Okay. Und was jetzt?“
„Hm.“ Julia senkte die Taschenlampe und leuchtete den Boden ab. „Ich weiß nicht.“ Sie leuchtete die Wände ab. „Ich sehe hier beim besten Willen keine Stelle, an der man etwas verstecken könnte. Ich sehe nur festen Stein auf Stein.“
„Aber warum steht dann ‚Seelenturm‘ auf dem Medaillon?“
„Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich mich ja auch geirrt.“
„Zeig es noch mal.“
„Was?“
„Das Medaillon.“
Julia zog es erneut aus ihrer Jackentasche. Um es besser greifen zu können, zog sie dieses Mal die Handschuhe aus. Sofort traf die eisige Luft ihre nackten Finger und gleich darauf fühlten sie sich schon steif an.
Und dann geschah etwas Merkwürdiges. Etwas Unglaubliches. Etwas, was sie niemals geglaubt hätten, wenn sie es nicht selbst gesehen und erlebt hätten: Ein leises ‚Klick‘ war zu hören.
„Hast du das auch gehört?“, fragte Julia tonlos.
Eva nickte. „Dieses Mal hab ich es auch gehört. Was war das?“
„Das Medaillon. Ich glaube, der Mechanismus hat sich gerade bewegt.“
In der nächsten Sekunde sprang das Medaillon auf. Julia erschrak so sehr, dass sie es um ein Haar fallen gelassen hätte. „Ach, du …!“ Sie starrte auf das geöffnete Schmuckstück. „Das ist … Es ist ein Kompass! Die Nadel zeigt nach Norden.“ Sie hob den linken Zeigefinger und deutete in die Richtung, in die die Nadel zeigte. „Da. Da vorne muss es sein.“
„Was?“, fragte Eva.
„Das Ziel. Offenbar war der Turm nur eine Zwischenstation.“ Julia setzte den Seesack ab, öffnete ihn, holte ein Fernglas heraus und hielt es an die Augen.
„Siehst du etwas?“, fragte Eva nach ein paar Sekunden.
„Nichts. Nur Bäume. Nein, warte … da ist ein Haus! Das könnte es sein.“
„Was meinst du, wie weit es bis dahin ist?“
„Schwer zu sagen. Ungefähr einen Kilometer.“
„Na dann …“ Eva war schon an der Treppe. „Los!“
Es wurde ein beschwerlicher Marsch.
Ein wirklich beschwerlicher Marsch.
Sie kamen nur mühsam voran, bewegten sich wie zwei Zombies, fielen mehr als einmal fast über ihre eigenen Füße, und die Stöße des eisigen Windes, die weiter unablässig in ihre Gesichter peitschten, waren am Ende kaum noch zu ertragen.
Doch schließlich erreichten sie das Haus. Ein nicht sehr großes, schmuckloses Gebäude, das alt und schief war, und offenbar nie einen Tupfer Farbe gesehen hatte.
„Hier möchte ich nicht wohnen“, schnaufte Eva. „Hier ist ja weit und breit nichts.“ Sie wollte weitergehen, doch Julia griff nach ihrem Arm, um sie daran zu hindern.
„Was ist?“
„Die Tür ist offen.“
Eva runzelte die Stirn. „Was kann das bedeuten?“
„Es bedeutet, dass du erst einmal hier stehen bleibst.“ Julia griff nach ihrer Pistole. „Ich meine es ernst, Eva. Du bleibst genau hier stehen und bewegst dich nicht von der Stelle.“
Als Eva nickte, setzte sie sich in Bewegung. Pistole und Taschenlampe im Anschlag, drückte sie mit der Schulter die Tür auf und betrat das Haus.
Es schien niemand da zu sein. Im Lichtkegel ihrer Taschenlampe sah Julia jedoch, dass der Raum, der offenbar als Wohn- und Esszimmer diente, völlig verwüstet war. Die Möbel waren zerbrochen, Regale umgekippt, die Holzböden teilweise herausgerissen, die Schränke auseinandergenommen.
Wer immer hier gewütet hatte, hatte wirklich alles zerstört.
Vorsichtig machte Julia einen weiteren Schritt in das Haus hinein. Es war so kalt, dass sie ihren eigenen Atem sehen konnte. Vor ihr auf dem abgenutzten Teppichboden befand sich etwas, das aussah wie Erbrochenes, das festgefroren war. Sie machte zwei weitere Schritte, und während sie über eine zerbrochene Lampe stieg, nahm sie aus den Augenwinkeln für den Bruchteil einer Sekunde ein hässliches Gemälde mit Engeln wahr, das an der Wand hing. Es bestand aus fürchterlich bunten Farben und die Engel wirkten wenig Vertrauen einflößend. Das Einzige hier drinnen, was nicht zerstört worden war.
Es war wirklich nur der Bruchteil einer Sekunde, und vielleicht hätte Julia mehr darauf geachtet, wenn sie nicht im nächsten Moment mit dem Lichtstrahl der Taschenlampe die gegenüberliegende Wand angeleuchtet – und Eva, die in der Tür stand, nicht aufgeschrien hätte.
Aus Evas Gesicht war alle Farbe gewichen. Zitternd lehnte sie sich an den Türrahmen.
Julia hätte das auch gerne getan, aber da wo sie stand, gab es nichts zum Anlehnen. Was sie sah, drehte ihr den Magen um: Ein toter Körper, der offensichtlich an die Wand genagelt worden war. Der Körper eines Mannes. Er hing dort, mit ausgebreiteten Armen, wie Jesus am Kreuz, und seine offenen Augen starrten ins Leere.
Eva begann zu husten und hektisch in der Jackentasche nach ihrem Asthmaspray zu suchen.
Julia sah sie an. „Kriegst du einen Anfall?“
Husten und Röcheln war alles, was sie zur Antwort bekam. Evas Kopf war jetzt nicht mehr blass, sondern hochrot. Als sie das Spray gefunden hatte, umklammerte sie es mit beiden Händen und inhalierte tief. Dann überfiel sie ein weiterer Hustenanfall, und einen Moment lang dachte Julia, Eva würde ersticken, aber dann bekam sie sich wieder in den Griff. Das Röcheln blieb, aber der Atem wurde wieder gleichmäßiger. Noch einmal inhalierte sie. Dann setzte sie an: „Waren das …? Das waren die … Kraniche, oder? Nur die Kraniche können … so etwas tun!“
Julia antwortete nicht darauf. Sie machte einen Schritt auf die Leiche zu und blieb dann wieder stehen. Sie wusste, dass sie sie nicht berühren durfte, ebenso wie sie aus ihrer Erfahrung als Polizistin wusste, dass dieser Mann schon lange tot war, dass er schon seit vielen Stunden so an der Wand hing und dass hier nichts mehr zu machen war. Ebenso wie sie wusste, dass sie so schnell wie möglich wieder von hier verschwinden mussten. Trotzdem machte sie noch einen weiteren Schritt und stellte fest, dass sich der erste Eindruck bestätigte: Der Mann war tatsächlich an die Wand genagelt worden. In seinen Händen steckten große Zimmermannsnägel. Zuvor allerdings hatte er noch eine Kugel in die Stirn bekommen. Aus dieser rann ein dünner Blutfaden, der zu glitzernden Eiskristallen gefroren war.
„Wir müssen die Polizei rufen“, sagte Eva.
„Nein“, gab Julia zurück. „Wir müssen von hier verschwinden.“
„Julia, wir können doch nicht …!“
„Wir können nichts mehr für ihn tun.“
„Mag sein. Trotzdem kommt es mir nicht richtig vor, einen Mann zurückzulassen, der an die Wand genagelt wurde wie Jesus Christus.“
Julia ging zu Eva, fasste sie bei den Schultern und sah ihr in die Augen. „Wir können nichts mehr für ihn tun. Und wenn das tatsächlich die Kraniche waren, dann sollten wir uns auf gar keinen Fall länger als nötig hier aufhalten.“
Damit griff sie nach Evas Hand und zog sie mit sich aus dem Haus.
2. KAPITEL
„Kennen Sie die Geschichte vom Hörnermann?“
Norwegen
Noch lange danach würde Edda Holmen sich an diesen frühen Abend erinnern. Ebenso, wie sie die vergangenen Tage nicht vergessen würde. Mitte Dezember hatte eine bittere Kälte eingesetzt und die Temperaturen waren immer weiter gefallen. Dann, vor drei Tagen, stiegen die Temperaturen wieder bis auf null Grad an und brachten starke Schneefälle über das Land. Eine Schicht Schnee fiel auf die nächste, sodass die Räumdienste in Dauerbetrieb inzwischen für einen zwei Meter hohen Haufen gefrorenen Schnees an den Straßenrändern gesorgt hatten.
So hatte der Winter auch an diesem frühen Abend alles fest im Griff. Auch Eddas Peugeot, der wirklich nicht zu den neuesten Errungenschaften der Welt gehörte. Während der Wind die dichten Schneeflocken gegen die Windschutzscheibe trieb, war die Heizung mal wieder ausgefallen. Die Scheiben beschlugen ständig und sie musste mehrmals mit einem Taschentuch eine freie Sichtfläche wischen, während sie dem schmalen Band folgte, das einer der Schneepflüge auf der Straße hinterlassen hatte. Da sie keine Handschuhe trug, waren ihre Hände schon ganz taub und ihre Füße prickelten schmerzhaft. Zu all dem kam noch, dass die Helligkeit der Scheinwerfer nicht so total war wie sonst, es war eher eine Art Dämmerlicht, hell an den Rändern und in der Mitte nichts als weiße Flocken.
Edda stieß einen tiefen Seufzer aus. Sie war müde. Sie wollte ins Warme. Sie wollte sich in die Badewanne legen, auftauen und irgendwie zur Ruhe kommen. Den Plan, sich an den Computer zu setzen und zu arbeiten, den sie am Morgen noch geschmiedet hatte, verwarf sie wieder. Darauf verspürte sie nicht mehr die geringste Lust.
Als sie zehn Minuten später endlich vor dem bescheidenen Haus ihres Onkels anhielt, dessen Zufahrt ebenfalls hinter einem meterhohen Schneehaufen verborgen lag, atmete sie erleichtert durch.
Kaum hatte sie den Wagen verlassen, peitschte ihr ein eiskalter Wind ins Gesicht. Ein weiterer Windstoß riss ihr die Jacke auf und ließ sie bis ins Mark frösteln. Frierend und bibbernd zog Edda den Reißverschluss der Jacke zu und eilte zum Haus. So schnell es ihr mit ihren tauben Fingern möglich war, schloss sie auf, und als sie eintreten wollte, erfasste der Wind die Tür und knallte sie gegen die Innenwand. Eilig griff sie nach der Tür und schloss sie hinter sich.
Der Geruch von gebratenem Fleisch hing in der Luft, es herrschte vollkommene Stille.
Während sie sich auf den direkten Weg ins Badezimmer machte, zog Edda die Jacke aus. Vor dem Waschbecken blieb sie stehen, um ein paar Mal tief durchzuatmen. Dann drehte sie den Hahn auf und hielt die eiskalten Hände unter heißes Wasser. Schließlich setzte sie sich auf den Toilettendeckel und rieb sich über die brennenden Augen. Die Müdigkeit ergriff immer weiter von ihr Besitz. Vielleicht, überlegte sie, sollte sie das Baden verschieben, sich stattdessen einen Tee kochen und ins Bett legen.
Sie erhob sich wieder, verließ das Badezimmer und ging in die Küche. Licht machte sie keins an, das Licht der Laterne vor dem Fenster genügte. Sie ließ gerade Wasser in einen Topf laufen, als plötzlich das Licht anging.
Mit einem Ruck drehte sie sich um und machte erschrocken einen Satz zurück. „Jesus Christus! Was in aller Welt machst du hier?“
„Entschuldige. Ich wollte dich nicht erschrecken.“
„Betrachte mich als zu Tode erschreckt.“ Eddas zitternde Hand lag auf ihrem klopfenden Herzen. „Du kannst doch nicht einfach hier herumschleichen wie ein Gespenst! Warum hast du nicht gleich auch noch Huh! geschrien?“
„Entschuldige“, sagte Susanne noch einmal.
„Wie bist du überhaupt ins Haus gekommen?“
„Ich habe einen Schlüssel, schon vergessen? Jo hat ihn mir gegeben, bevor ich nach Deutschland geflogen bin.“
„Oh, ja. Daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Mensch, Süße … Komm, lass dich umarmen.“ Edda legte die Arme um Susannes Hals und drückte sie herzlich. „Ich bin wirklich froh, dich zu sehen, auch wenn ich das nächste Mal eine andere Begrüßung vorziehen würde. Seit wann bist du schon hier?“
„Seit etwa einer Stunde.“ Susanne erwiderte die Umarmung. „Ich hab geklopft, aber es hat niemand aufgemacht. Also bin ich rein und hab gewartet. Noch einmal: Entschuldigung.“
Edda ließ sie wieder los und betrachtete sie einen Moment lang. „Wieso hast du nicht vom Flughafen aus angerufen und Bescheid gegeben, dass du wieder in Norwegen bist?“
„Ich hab‘s versucht, aber die Leitung war tot.“
„Wirklich?“ Edda ging in den Flur und hielt sich den Telefonhörer ans Ohr. „Tja. Hm. Muss am Wetter liegen.“
„Ich war schon froh, dass ich überhaupt noch einen Flug bekam“, sagte Susanne. „Hübscher Baum übrigens.“
„Was für ein Baum? Was meinst du?“
„Den Christbaum im Wohnzimmer.“
„Oh. Ja, der. Er ist riesig. Ich frage mich, wie Jo es schaffte, den Baumschmuck an den oberen Zweigen anzubringen.“ Edda betrachtete Susanne noch einmal ausgiebig. „Deine Verwandlung irritiert mich immer noch. Als Susanne, die Punkerin, hab ich dich kennengelernt, und an Claudia Müller, die elegante Geschäftsfrau, hab ich mich noch nicht gewöhnt.“
„Ich hab mich selbst noch nicht daran gewöhnt.“ Susanne ließ sich in der Küche auf einen Stuhl sinken. „Vermutlich werde ich das auch nie. Aber jetzt sag mir bitte, wie geht es Jo?“
Edda griff wieder nach dem Topf, in den sie vorhin Wasser hatte laufen lassen. „Er liegt im Krankenhaus.“
„Ja, das sagtest du bereits am Telefon. Auch, dass er einen Herzinfarkt hatte. Ich wollte aber wissen, wie es ihm inzwischen geht?“
Edda stellte den Topf auf eine Herdplatte, schaltete sie ein und drehte sich wieder zu Susanne um. „Die Ärzte hoffen, dass er bald wieder aufwacht. Wir müssen einfach abwarten.“ Sie griff nach zwei Tassen. „Aber natürlich wird er wieder aufwachen. So boshaft ist Gott nicht. Er wird mir Jo nicht wegnehmen. Jo wird ewig leben.“
„Natürlich wird er das.“
Das Licht begann zu flackern. Beide sahen hinauf zur Deckenlampe.
„Das hört gleich wieder auf“, sagte Edda. „Liegt auch am Wetter.“
„Du hast am Telefon gesagt, er hätte es heraufbeschworen. Wie hast du das gemeint?“
Edda hob die Hände in die Höhe. „Ich glaube, er hat auf eigene Faust Nachforschungen angestellt.“ „Nachforschungen? Was für Nachforschungen?“
„Über Sofie Dale.“
„Wer ist das?“
Es dauerte zwei oder drei Sekunden, dann begann Edda zu erzählen…
48 Stunden zuvor.
Hätte Jo Holmen die Kneipe nur ein klein wenig früher wieder verlassen, dann wäre er Claas Mok gar nicht mehr begegnet. Hätte er sich nicht noch ein Bier bestellt und wäre nicht noch etwas sitzen geblieben, dann wäre vermutlich alles ganz anders gekommen. Hätte er die Kneipe an diesem Abend erst gar nicht betreten, sondern wäre zu Hause in seinem Bett geblieben, ja, dann wäre ihm einiges erspart geblieben.
Aber es war Jos chronischer Schlaflosigkeit zu verdanken gewesen, dass er an jenem Abend noch einmal aus dem Bett gestiegen und in die Kneipe gegangen war. Dort hatte er zwei Bier getrunken. Und das hätte es sein sollen. Er hätte wieder gehen sollen. Aber da das Schicksal dem Menschen immer einen Schritt voraus ist, hielt es just an diesem Abend etwas für Jo bereit.
Er war also sitzen geblieben und hatte sich noch ein drittes Bier bestellt. Als die Tür geöffnet wurde, hatte er den Kopf gehoben und beobachtet, wie ein Mann hereinkam, der Prototyp eines lieben, älteren Onkels: Anfang sechzig, mit vollkommen weißen Haaren, rotgesichtig und mit einem nicht zu übersehenden Bäuchlein unter dem viel zu dünnen Mantel. Der Mann war so unscheinbar, dass niemand sonst in der Kneipe Notiz von ihm zu nehmen schien. Er schüttelte sich wie ein nasser Hund und sah sich dann um. Es war kein Tisch mehr frei, aber gleich neben Jo stand noch ein leerer Stuhl.
Der Mann kam auf ihn zu. „Ist der hier noch frei?“ Er hatte eine sonore Stimme und sprach leise.
Jo nickte und forderte ihn mit einer Geste auf, neben ihm Platz zu nehmen.
Nachdem der Mann den Stuhl herangezogen und sich gesetzt hatte, fuhr er sich mit beiden Händen durch die Haare. Dann bestellte er Wodka beim Wirt, ehe er in Jos Richtung sagte: „Furchtbares Wetter.“
„Ja.“
„Das wird ein weißes Weihnachten.“
„Ja.“
Schweigen.
Dann: „Mein Name ist Claas Mok.“
„Jo Holmen.“
Der Wirt brachte den Wodka.
Dann folgte wieder Schweigen.
Sie saßen einfach nur da und starrten in ihre Gläser.
Schließlich sagte Mok: „Ich schätze, ich geh langsam meinem Ende entgegen.“
Jo sah auf.
„Ich rede vom Tod, mein Freund.“ Mok drehte das Wodkaglas zwischen seinen Fingern. „Davon, dass ich meinem Ende entgegengehe.“
„Na ja“, meinte Jo, „das tun wir alle.“
„Ja, das ist wohl richtig. Mich bestürzt nur, dass ich jetzt ein alter Mann bin und es nicht geschafft habe.“
„Was?“
„Das ist eine lange Geschichte.“
„Ich hab Zeit.“
Mok betrachtete Jo einen Moment lang. „Wollen Sie es wirklich wissen?“
„Ja.“
„Also, wenn Sie es wirklich wollen …“ Mok hielt den Zeigefinger seiner rechten Hand in die Höhe, „dann brauchen wir mehr Wodka.“ Er winkte dem Wirt und bestellte eine ganze Flasche.
Der Wodka brannte in Jos Kehle, lief langsam seinen Körper hinab, bis er sich irgendwo in seinem Magen wie eine glühende Kugel entfaltete.
„Sind Sie verheiratet?“, fragte Mok.
„Nein.“
„Also haben Sie auch keine Kinder.“
„Nein. Aber ich hab eine Nichte. Edda.“
„Sie hängen an ihr?“
„Ja.“
„Ja. Natürlich.“ Mok beugte sich nach vorne. „Vielleicht ist das die größte Herausforderung unseres Lebens. Die zu beschützen, die wir lieben.“
„Vielleicht.“ Jo wartete ab, worauf das hier hinauslief.
Mok lehnte sich wieder zurück. „Ich bin verheiratet. Seit einunddreißig Jahren. Ich habe eine Tochter, auf die ich sehr stolz bin und die ich sehr liebe. Und natürlich liebe ich auch meine Frau.“
„Natürlich. Was wollten Sie erzählen?“
„Genau. Der Fall, den ich nie lösen konnte.“ Mok nickte langsam. „Es war 1995. Das Mädchen hieß Sofie Dale. Es war siebzehn Jahre alt, als es spurlos verschwand.“
Jo zog die Augenbrauen hoch, schwieg aber.
„Sofie lebte in Ålesund“, redete Mok weiter. „Bei ihren Pflegeeltern. Ich war damals einer der ermittelnden Beamten. Wir haben nach dem Mädchen gesucht, es aber nicht gefunden. Irgendwann wurde die Suche eingestellt und alle Versuche, sie später noch einmal aufzunehmen, wurden abgewiesen.“ Mok hob den Blick und sah Jo in die Augen. „Noch heute bin ich verbittert darüber, wie es damals gelaufen ist, aber andererseits macht mich genau das noch sicherer.“
„Sicherer worin?“
„Dass ich Sofies Entführer kenne. Nein, ich kenne sie nicht persönlich, aber ich weiß, wer sie sind.“
„Wer?“
Mok verengte die Augen etwas. „Kennen Sie die Geschichte vom ‚Hörnermann‘?“
Jo, der immer noch nicht wusste, wohin das hier führte, sagte: „Jeder Norweger kennt die Geschichte. Der Hörnermann war ein finsterer Geselle, ein Teufel, der irgendwo auf einem Berg wohnte und fand, dass es zu viele gute Menschen auf der Welt gäbe und dass man etwas dagegen tun müsse. Also zog er sich eine gut organisierte Armee heran, die damit begann, alles auszulöschen, was dem Hörnermann nicht in den Kram passte. Damit war vor allem das Gute gemeint. Er wollte das Gute ausrotten.“
Mok seufzte. „Ja, das ist die Geschichte.“
„Und was hat das mit Sofie Dale zu tun?“
„Eine kluge und berechtigte Frage.“ Mok sah Jo wieder in die Augen. „Was, wenn es den Hörnermann tatsächlich gäbe?“
„Nehmen Sie mich gerade auf den Arm? Das ist eine uralte Legende, weiter nichts.“
„Das denken Sie. Sagt Ihnen der Name ‚Zaren‘ etwas?“
„Nein. Wer soll das sein? Ein Russe?“
„Kein Russe. So nennen sie ihn.“
„Wer? Wer nennt ihn so?“
Mok griff wieder nach seinem Glas und trank einen Schluck Wodka. „Wann sind Sie geboren, Jo?“, wollte er wissen, nachdem er das Glas wieder abgestellt hatte.
„1946.“
„Da war der Krieg schon vorbei.“
„Ja.“
„Dann haben Sie die Nazis nicht mehr kennengelernt.“
„Nein.“ Allmählich stellte Jo sich ernsthaft die Frage, ob der Mann nicht ein bisschen durcheinander war. Vielleicht hatte er zu Hause schon Wodka getankt. Reichlich Wodka.
„Ich hab 1972 bei der Polizei angefangen“, sprach Mok indessen weiter, „und in den Jahren habe ich unzählige Schicksale gesehen. Ich habe Jahre damit verbracht, im Dreck und Elend anderer Leute rumzuwühlen. Aber nichts und niemand hat mich so sehr mitgenommen wie der Zaren.“
„Aber warum?“, fragte Jo. „Wer ist das?“
„Der Zaren ist der vermutlich gefährlichste Mensch auf dieser Erde. Ich hab es leider nicht geschafft, ihn aufzuspüren und auszuschalten. Weil es verdammt noch eins nie auch nur einen einzigen Beweis gab. Ich weiß, dass es ihn gibt, aber der Mann ist total … verschwommen. Ein Schatten, ein Gespenst. Man kommt nicht an ihn heran, so sehr man es auch versucht.“
Jo richtete sich etwas auf. „Wie kommen Sie darauf, dass er der gefährlichste Mensch auf dieser Erde ist, wenn man doch nichts über ihn weiß?“
Mok lächelte dünn. „Vielleicht beflügelt er gerade deshalb so sehr meine Fantasie. Wenn ich ihn mir vorstelle, dann sehe ich eine Fantasiefigur vor mir, ungefähr so, wie wir ihn als Kinder in den vielen Comics gesehen haben: Hut bis über die Augen, schwarzer Mantel bis zum Boden und ein Gesicht mit dämonischen Zügen. Trotzdem ist er keinem Comic entsprungen. Er ist ganz real und niemand, niemand, hat so viele Menschen auf dem Gewissen wie er.“
Sie sahen sich an.
„Ich bin davon überzeugt, dass die Männer des Zaren Sofie entführt haben“, redete Mok weiter.
„Die Männer …?“
„Sein Heer, seine Streitmacht. Genau wie beim Hörnermann. Sie nennen sich ‚Kraniche‘.“
Jo begann, in seinen Taschen nach einer Zigarette zu suchen.
Mok beugte sich wieder nach vorne. „Während meiner Jahre bei der Polizei sind unzählige Menschen verschwunden, die nie wieder auftauchten. Auch nicht ihre Leichen. Und interessanterweise immer nur Menschen, die niemand vermisste oder über deren Verschwinden sich niemand Gedanken machte. Obdachlose, zum Beispiel. Von heute auf morgen, einfach weg. Und nie wieder aufgetaucht.“
„Und Sie meinen, diese Menschen wurden alle von den Kranichen entführt?“
„Ja.“
„Sofie Dale auch?“
Mok nickte.
„Aber warum? Warum sollten diese Vögel Menschen entführen? Wozu?“
„Hmmm“, brummte Mok. „Das weiß ich eben nicht. Aber ich weiß, dass ich recht habe.“
Jo blickte skeptisch.
„Ich verstehe, dass Sie Vorbehalte haben“, setzte Mok hinzu, „aber glauben Sie mir, ich bin kein Spinner. Ich bin alt und erschöpft, aber kein Spinner. Leider kann ich es nicht mehr beenden, denn ich werde bald tot sein.“ Er drehte den Kopf und seine Augen streiften in der Kneipe umher, so als suche er diesen Mann, den er „Zaren“ nannte, zwischen den anderen Gästen. Dann sah er Jo wieder an. „Der Zaren muss ausgeschaltet werden. Er ist ihr Gehirn. Wenn es ihn nicht mehr gibt, dann gibt es auch die Kraniche nicht mehr.“
Irgendwo in Susanne kreischte etwas. Sie versuchte, ihre Zunge dazu zu bringen, Worte zu bilden, aber sie war zu spröde, bewegte sich nur klickend in ihrem Mund. Es brauchte ein paar Anläufe, ehe sie sagen konnte: „Mein Gott, Edda … Wenn dieser Mok tatsächlich auf den Spuren der Kraniche war …“ Sie brach ab. „Was ist dann passiert?“
„Es gab noch am selben Abend, nach diesem Gespräch, einen Unfall. Mok wurde von einem Auto überfahren. Fahrerflucht. Er ist tot.“
Susanne schluckte, hob eine Hand in die Höhe, die sie jedoch sofort wieder sinken ließ. „Das war kein Unfall. Niemals im Leben war das ein Unfall. Das waren die Kraniche. Die haben den Mann umgebracht.“
„Das wissen wir nicht sicher.“
„Das wissen wir nicht sicher?“ Susanne richtete sich auf. „Jetzt pass mal auf, Edda. Ich habe bereits Bekanntschaft mit diesen Kranichen gemacht und ich weiß, dass sie eines ganz besonders gut beherrschen: das Töten.“ Dann sprudelte sie mit allem heraus: „Du erinnerst dich doch noch an den Auszug einer Mail, den wir gelesen haben, als ich noch hier in Norwegen war? Die Mail von Roman Vukovic, dem irren Psychopathen, der mich wochenlang beobachtete und auskundschaftete. Er schrieb in dieser Mail, er wüsste, dass die Kraniche dafür verantwortlich wären, dass ich im letzten Sommer in der geschlossenen Psychiatrie landete.“
„Ich erinnere mich“, sagte Edda. „Ich war dabei.“
„Eben. Daraufhin flog ich zurück nach Deutschland, wie du weißt, um herauszufinden, wer zum Teufel diese Kraniche sind. Tja – was soll ich sagen? – ich habe es herausgefunden. Und das, was ich herausgefunden habe, ließ mich bis ins Mark erzittern.“ Der Stuhl quietschte, als Susanne ganz nach vorne rutschte. „Die Kraniche, Edda, sind tatsächlich ein Heer, eine Streitmacht. Es sind Nazis, die die Weltherrschaft übernehmen wollen. Oder jedenfalls so etwas Ähnliches. Mok hat recht, sie wollen das Gute von innen heraus ausrotten. Es sind Satanisten, die nach der ultimativen Macht streben. So ist das.“
Edda hatte gerade ihre Teetasse angehoben, jetzt ließ sie sie wieder sinken. „Was denn nun? Nazis oder Satanisten? Du musst dich schon entscheiden.“
„Sie sind beides“, sagte Susanne. „Sie sind ein gottverdammter Albtraum. Vielleicht hast du schon einmal von den Behauptungen gehört, dass Hitler sich auf seinem Weg zur Macht mit schwarzer Magie, satanischen Riten und Ähnlichem beschäftigte. Seine Pläne für die Herrenrasse basierten auf völkischem Okkultismus. Er versuchte seine Rasse von den Schwachen und Nichtsnutzigen zu befreien, indem er sie tötete. Und nichts anderes tun die Kraniche auch.“
Edda öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch Susanne hob eilig eine Hand in die Höhe. „Glaub es. Es ist wahr.“
„Und woher weißt du das alles?“
„Ich habe dir doch bei einem unserem letzten Telefonat erzählt, dass ich in Deutschland einen Mann kennengelernt habe. Sein Name ist Karl Dickfeld, ich nannte ihn aber nur den Professor, weil er mich an meinen Professor an der Uni erinnerte.“ Susanne machte eine Handbewegung. „Ist auch egal. Er erzählte mir auf jeden Fall, dass die Kraniche sich bereits in den frühen Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts formiert haben. Angeführt von einem Mann namens Elmer Nilson, einem Norweger. Und dass sie bereits damals ein Ziel verfolgten. Sie bereiteten sich auf die neue Zeit vor, auch bekannt unter dem Namen: Tausendjähriges Reich.“
„Wie bitte?“
„Ich hab dem Professor zuerst auch nicht geglaubt. Ich stand ihm vermutlich genauso skeptisch gegenüber wie Jo diesem Mok. Aber er hatte recht mit jedem Wort.“ Susanne rieb sich über die Stirn. „Elmer Nilson und seine Bande fanden damals wohl, es sei ihre Aufgabe, dieses tausendjährige Reich vorzubereiten. Und so formierten sie sich, während sich gleichzeitig in Deutschland die ersten Nazis formierten. Irgendwann taten sich beide Seiten zusammen, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg zerfielen die Kraniche nicht, sondern, im Gegenteil, sie breiteten sich immer weiter aus und ihr Einfluss wurde immer größer.“ Susanne machte eine Pause und als Edda nichts darauf sagte, redete sie weiter: „Es ist wahr, Edda. Es gibt diese Kraniche und sie verfügen über eine Menge Macht. Sie haben eine Menge Leute auf ihrer Gehaltsliste – Polizisten, Politiker, Journalisten, Akademiker … und Mörder. Und die verstehen was von ihrem Handwerk, darauf kannst du dich verlassen. Ich sage dir, diese Vögel führen einen Krieg und sie wollen ihn um jeden Preis gewinnen. Sie wollen den Untergang des Rechtsstaates und sie setzen alles daran, um das auch zu erreichen.“
Ein paar Sekunden vergingen, dann sagte Edda: „Ist das alles?“
„Reicht das nicht? Edda, wenn Mok recht hat, dann wissen wir jetzt, wer der Kopf dieser Vögel ist. Ein Mann, der sich ‚Zaren‘ nennt.“
Edda erhob sich, ging zum Kühlschrank und öffnete ihn.
„Ich glaube nicht, dass Mok einfach nur eine Geschichte erzählt hat, weil ihm langweilig war“, sagte Susanne. „Er wusste von den Kranichen. Er wusste sehr genau, wovon er sprach. Und genau deshalb ist er jetzt vermutlich tot.“
Edda machte den Kühlschrank wieder zu, ohne hineingesehen zu haben. „Es könnte sich aber auch um einen tragischen Unfall mit Fahrerflucht gehandelt haben.“
„Ja. Könnte. Aber ich glaube es nicht.“
„Und was hat das Ganze mit Sofie Dale zu tun? Warum sollten die Kraniche Menschen entführen und verschwinden lassen? Warum ein Mädchen wie Sofie Dale?“
„Tja, das müssten wir herausfinden.“
Edda hatte den Griff des Kühlschranks noch nicht losgelassen. Sie sah Susanne einfach nur an.
Als zu lange nichts von ihr kam, sagte diese: „Offenbar hat Jo ja auch noch einmal darüber nachgedacht. Wenn es stimmt, was du sagst, dann hat er angefangen zu recherchieren.“
„Ich glaube es. Sicher bin ich mir nicht.“ Endlich ließ Edda den Griff des Kühlschranks los und kam zurück zum Tisch. „Aber er war in den letzten beiden Tagen irgendwie … anders. Er hat getan, als wäre alles in Ordnung, aber mich kann er nicht täuschen. Er wirkte nervös. Schreckhaft. Von einer inneren Anspannung, die ich bei ihm so nicht kannte.“
„Habt ihr darüber geredet?“
„Nein. Ich hab ihn zwar gefragt, wie es ihm geht und so, aber er hat geantwortet, es wäre alles in Ordnung.“
Der Wind blies so heftig gegen das Fenster, dass sie zusammenzuckten.
„Du meinst, er hat etwas herausgefunden? Etwas, das ihn vielleicht so sehr aufregte, dass er …?“
„Ich weiß es nicht.“ Edda ging zum Ofen, um Holzscheite nachzulegen. „Aber möglich wäre es.“ Das sagte sie so leise, dass Susanne es kaum hören konnte.
„Hast du mal darüber nachgedacht, warum Mok ausgerechnet ihm von Sofie Dale, den Kranichen und dem Zaren erzählte?“
„Natürlich hab ich darüber nachgedacht. Und eine Antwort darauf hab ich nicht.“
„Mok sagte, er ginge seinem Ende entgegen, richtig? Das könnte doch bedeuten, dass er ahnte, dass er nicht mehr lange am Leben sein würde. Dass er ahnte, dass die Kraniche ihn schon bald erwischen würden.“
„Und da ging er noch schnell in die Kneipe und schnappte sich den Nächstbesten, um ihm die Geschichte vom Zaren zu erzählen? Also, ich weiß nicht …“ Edda schüttelte den Kopf. „Klingt ziemlich weit hergeholt, wenn du mich fragst.“
„Aber nicht unmöglich.“
„Nein. Nicht unmöglich.“
Zwei Sekunden, drei, herrschte vollkommene Stille im Raum.
Dann sagte Susanne: „Und was machen wir jetzt?“
Edda drehte sich zu ihr um. „Ich weiß nicht. Was schlägst du vor? Sollen wir uns bis an die Zähne bewaffnen und gegen die Kraniche in den Krieg ziehen?“
„Ein paar einfache Fragen stellen würde für den Anfang schon reichen. Ein paar Nachforschungen über Sofie Dales Verschwinden anstellen.“
Wieder vergingen ein paar Sekunden.
Dann nickte Edda und ging zur Tür.
„Wo willst du hin?“, fragte Susanne.
„Ich setze mich an den Computer und beschaffe mir alle nötigen Informationen über Sofie Dale.“
Sofort war Susanne auf den Beinen. „Ich komme mit.“
3. KAPITEL
Keine gewöhnliche Leiche
Hannover
19:25 Uhr
Es dauerte ein paar Sekunden, bis sich Frieda Behnkes Augen an die Düsternis gewöhnt hatten. Sie hatte nur eine leichte Strickjacke übergezogen, was sie jetzt bereute. Frierend und bibbernd eilte sie auf das Nachbarhaus zu. Den selbst gebackenen Christstollen hielt sie fest in den Händen.
Beim Nachbarhaus angekommen, drückte sie auf den Klingelknopf und wartete.
Niemand öffnete.
Frieda klingelte erneut, und wieder tat sich nichts im Inneren des Hauses. Da aber das Licht im Wohnzimmer brannte, musste jemand da sein.
„Hallo?“, rief Frieda, laut genug, um im Inneren gehört zu werden.
Als sie daraufhin wieder keine Antwort bekam, überlegte sie kurz, dann ließ sie von der Haustür ab und ging zum Wohnzimmerfester. Auf einer vereisten Stelle rutschte sie aus und knickte sich den Knöchel um. Der Schmerz fuhr ihr bis in die Hüfte. Sie drohte zu fallen, konnte sich aber mit einer Hand am Fensterbrett festhalten.
Noch einmal sagte sie laut: „Hallo? Frau Strickner? Ich bin es, Frieda Behnke. Ihre Nachbarin.“
Wieder keine Antwort.
Frieda hob den Kopf und blickte durch die Scheibe ins Wohnzimmer. Zuerst sah sie nur eine Hand. Bleich und krallenartig. Dann sah sie den Rest und stieß einen Schrei aus. Sie wich zurück und drohte erneut zu fallen. Sie suchte nach ihrem Gleichgewicht, fand es, rannte zurück zu ihrem eigenen Haus und rief dort so schnell sie konnte die Polizei.
Eine halbe Stunde später stand Hauptkommissar Michael Tech ganz still da, die Hände tief in den Taschen seiner Jacke vergraben, während um ihn herum das Klicken von Kameras zu hören war, das Klingeln eines Handys und gedämpfte Gespräche. Dazu Männer in weißen Overalls, die sich systematisch durchs ganze Haus arbeiteten. Irgendwo fluchte jemand leise.
Tech hatte Halsschmerzen und seine Augen tränten unablässig. Er sollte eigentlich zu Hause im Bett liegen. Schon seit Tagen quälte er sich mit einer Grippe herum, die er nicht auskurieren konnte, weil immer irgendetwas dazwischenkam. Weil die Arbeit nicht abreißen wollte, nicht einmal an Weihnachten.
Und jetzt das.
Er betrachtete die Leiche, die noch nicht von der Stelle bewegt worden war. Sie würde noch eine ganze Weile so liegen bleiben, bis sie von allen Seiten fotografiert worden war und bis der Arzt sie untersucht hatte.
Tech wandte den Blick ab und betrachtete das Bücherregal, das gesprenkelt war mit einer dunklen Substanz. Es sah aus wie Kaffee. Dafür sprachen auch die Überreste von etwas, das aussah wie eine zerschmetterte Kaffeetasse. Die Scherben lagen überall auf dem Boden herum.
„Guten Abend“, sagte Doktor Eduard Gläser, der gerade das Wohnzimmer betreten hatte. „Tut mir leid, aber es war mir bei dem schlechten Wetter leider nicht möglich, schneller hier zu sein, Herr Kommissar. Entschuldigen Sie. Herr Hauptkommissar muss ich ja nun sagen.“
Tech zog es vor, nicht darauf zu antworten. Er ahnte, dass dies ein schicksalhafter Moment war. Dass hiermit seine Stunde gekommen war, doch er wollte nicht darüber nachdenken, noch nicht, denn er wusste, wenn er es tat, dann würde die Last auf seinen Schultern unerträglich werden.
Gläser ging auf die Leiche zu und blieb neben ihr stehen. „Ich kann es immer noch nicht glauben.“
„Ich auch nicht“, sagte Tech.
„Wer sollte denn so etwas tun? Wer sollte ausgerechnet sie umbringen?“
„Wir werden es herausfinden.“
Der Arzt kniete neben der Leiche nieder und kratzte sich am Kopf. Er war aufgewühlter, als er zugeben wollte. Seine Wangen zeigten eine intensive Röte. „Verdammt schade.“
Das war es wirklich. Denn die Tote auf dem Boden war nicht irgendeine Frau. Hier war keine gewöhnliche Bürgerin umgebracht worden. Hierbei handelte es sich um Frau Doktor Hannelore Strickner. Sie lag auf dem Rücken, ihre Augen starrten an die Decke, ihr blondiertes Haar lag um ihren Kopf herum gefächert und der Boden um diesen Kopf herum war voller Blut.
Gläser riss sich zusammen und begann mit seiner Arbeit. „Erschossen“, sagte er. „Eine Kugel in den Hinterkopf. Blitzsauberer Schuss. Hat keine zwei Sekunden in Anspruch genommen. Das lässt mich nicht an einen Kontrollverlust aus unerwiderter Liebe denken. Sieht eher nach einer kaltblütigen Exekution aus.“
„Also ein Profi“, sagte Tech.
„Würde ich denken, ja. Ein Jäger könnte das hier aber durchaus auch bewerkstelligen.“ Gläser widmete sich wieder der Leiche. „Die Kugel sitzt noch im Schädel. Ich kann kein Austrittsloch entdecken.“
„Aus welcher Entfernung wurde geschossen, was meinen Sie?
„Nach den Rückständen an der Einschussstelle zu schließen: einen Meter, höchstens.“
„Und wann?“
„Das dürfte noch nicht so lange her sein. Etwa drei bis vier Stunden.“
„Also zwischen 17: 00 Uhr und 18:00Uhr.“
„Ja.“
Tech nickte, sah sich noch einmal im Raum um und hegte nicht den leisesten Zweifel daran, dass ihn das hier für die nächste Zeit rund um die Uhr auf Trab halten würde. Er durfte nicht vergessen, morgen früh seine Mutter anzurufen, um ihr mitzuteilen, dass er zum Weihnachtsfest vermutlich nicht kommen würde. Das würde wieder Diskussionen geben …
„Der Blutmenge um den Kopf herum nach zu urteilen, scheint sie genau an dieser Stelle hier umgebracht worden zu sein“, durchbrach Gläsers Stimme seine Gedanken.
Tech konzentrierte sich wieder auf ihn. „Vermutlich stand sie hier und hielt eine Tasse Kaffee in den Händen, als sie erschossen wurde.“ Ein Foto, das auf einem Regal stand, stach ihm ins Auge. Es zeigte Frau Doktor Strickner mit einem Mann, der ein etwas vorstehendes Auge und dünnes dunkelblondes Haar hatte. Die beiden hatten die Arme umeinander gelegt. „Wer ist das?“, fragte er.
Gläser hob den Kopf und folgte seinem Blick mit den Augen. „Das dürfte ihr verstorbener Mann sein.“
„Ich wusste gar nicht, dass sie Witwe war.“
„Das wussten nur wenige. Sie hat nicht viel über sich selbst gesprochen.“
Das hatte sie wirklich nicht.
„Was wissen Sie sonst noch über sie?“, fragte Tech.
„Das, was die meisten wissen.“ Gläser war schon wieder mit der Leiche beschäftigt. „So gut wie nichts. Sie war eine gute Rechtsmedizinerin, eine verdammt gute sogar. Eine Ärztin, wie sie im Buche steht. Damit hört mein Wissen über sie aber auch schon auf. Wir waren Kollegen, keine guten Freunde. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob Frau Doktor Strickner überhaupt Freunde hatte.“
„Ich mir auch nicht“, murmelte Tech.
Wiederholt blitzte das Blitzlicht des Polizeifotografen auf.
Ein paar Minuten später richtete Gläser sich auf. „Ich bin hier fertig. Was ich jetzt schon sagen konnte, habe ich Ihnen gesagt. Für alles Weitere müssen wir die Obduktion abwarten.“
„Wir brauchen das Ergebnis schnell, Herr Doktor“, sagte Tech. „Wirklich schnell.“
„Ich verspreche Ihnen, ich mache so schnell ich kann.“
„Und wie schnell ist das genau?“
Gläser holte tief Luft. „Bis morgen früh um 11:00 Uhr dürfte ich es geschafft haben.“
Tech nickte zufrieden. „In Ordnung. Ich komme zu Ihnen.“
„Das ist nicht nötig. Sie müssen sich den Weg nicht machen. Sie können anrufen oder ich rufe bei Ihnen an.“
„Danke, aber ich möchte kommen.“
„Wie Sie wollen.“ Gläser packte seine Tasche zusammen und ging zur Tür. Dort blieb er noch einmal stehen und drehte sich um. „Sie war eine großartige Ärztin. Wirklich großartig. Diesen Tod hat sie nicht verdient.“
„Nein“, sagte Tech. „Das hat sie nicht. Niemand hat das.“
Kaum war der Arzt gegangen, eilten zwei Männer herbei, die eine Bahre mit sich trugen. Auf ein Zeichen von Tech hin, hoben sie den toten Körper hoch, legten ihn darauf, deckten ihn mit einem Tuch zu und gingen mit ihm davon.
Die Polizisten an der Tür beobachteten mit Erleichterung, wie die grausige Last davongetragen wurde.
Tech holte sein Handy aus der Jackentasche, schaltete das Diktiergerät ein und begann nach einem Blick auf die Uhr ins Mikrofon: „Es ist 20:48 Uhr. Der 23. Dezember. Ich stehe im Haus von Frau Doktor Hannelore Strickner. Sie wurde erschossen, lag auf dem Boden auf dem Rücken.“ Er ließ das Mikrofon sinken und drehte sich zu einem Mann von der Spurensicherung um, der gerade an ihm vorbeiging und angespannt auf einem Kaugummi kaute. „Gibt es Einbruchsspuren?“, wollte er wissen.
„Nein, überhaupt keine“, antwortete der Kollege. „Die Tür ist heil, die Gläser aller Fenster ebenfalls. Auch an den Rahmen sind keine Spuren zu finden. So wie es aussieht, hat sie ihren Mörder freiwillig ins Haus gelassen.“
„Raubüberfall?“
Der Kaugummi wanderte von der linken auf die rechte Seite. „Hm, nein, sieht nicht so aus, als wurde etwas gestohlen.“
„Wurde das Tatwerkzeug, die Pistole, schon gefunden?“
„Nein. Noch nicht. Vermutlich hat der Mörder sie mitgebracht und wieder mitgenommen.“
Ein blonder Kollege von der Streife kam von draußen herein, ging auf Tech zu und sagte: „Wir haben den Vorgarten durchsucht, aber wie soll man bei dem vielen Schnee etwas finden? Die anderen sind gerade an der Auffahrt beschäftigt.“
„Danke“, sagte Tech. „Suchen Sie bitte weiter.“
Der Streifenbeamte nickte und verschwand wieder.
Tech sprach erneut in sein Diktiergerät: „Das Opfer wurde mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet, das Tatwerkzeug befindet sich offenbar nicht am Tatort.“ Er drehte sich einmal um die eigene Achse. „Der Raum ist sauber, keine Spuren eines Kampfes. Lediglich am Bücherregal sind dunkle Spritzer zu sehen, die wahrscheinlich von Kaffee stammen. Scherben einer kaputten Kaffeetasse liegen auf dem Boden. Vermutlich wurde das Opfer von hinten überrascht. Nirgendwo am Haus sind Spuren eines Einbruchs zu finden. Die Fenster sind unversehrt, ebenso die Eingangstür. Der Mörder scheint freiwillig hereingelassen worden zu sein.“ Er ließ das Diktiergerät wieder sinken und fragte laut in den Raum: „Wer hat sie gefunden?“
„Eine Nachbarin“, antwortete jemand. „Sie wollte einen Christstollen vorbeibringen. Als ihr niemand öffnete, obwohl Licht brannte, hatte sie ein komisches Gefühl und einen Blick durchs Wohnzimmerfenster geworfen. Sie hat gleich die Polizei gerufen.“
„Hat sie jemanden gesehen?“
„Nein.“
Tech seufzte leise. Das wäre auch zu einfach gewesen. „Wo ist die Frau jetzt?“, fragte er weiter.
„Wieder in ihrem Haus. Es wäre zu kalt gewesen, sie die ganze Zeit in einem der Polizeiwagen warten zu lassen.“
„In Ordnung.“ Tech bekam einen Hustenanfall und schob sich ein Mentholbonbon in den Mund. Dann machte er sich auf den Weg zur Nachbarin.
Mit dem sicheren Gefühl, in einen Albtraum geraten zu sein, stand Frieda Behnke an ihrem Küchenfenster und betrachtete das rot-weiße Absperrband, das die Polizei rund um das Nachbarhaus gespannt hatte. Sie konnte immer noch nicht glauben, was sie gesehen hatte, und ganz bestimmt würde sie es auch nie wieder vergessen. Ganz bestimmt würde sie … Frieda verharrte, richtete sich etwas auf, griff nach ihrer Brille und hielt die Gläser vor die Augen. Auf der anderen Straßenseite, hinter einem der Bäume, stand jemand. Vom Gesicht war nichts zu erkennen, aber die Gestalt trug eine auffällig hellgelbe Jacke.
Frieda spürte, wie ihr das Blut aus dem Kopf in die Füße schoss.
War das etwa der Mörder?
Im nächsten Moment drehte die Gestalt sich um und verschwand in der Dunkelheit. In derselben Sekunde, in der es an der Tür klingelte.
Die Polizei! Das war bestimmt die Polizei!
Frieda eilte durch den Flur, öffnete die Tür jedoch nur einen Spalt. „Michael Tech“, sagte der Mann, der davorstand. „Kriminalpolizei.“
„Ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen“, sagte Frieda atemlos.
„Wen?“
„Den Mörder. Er stand auf der anderen Straßenseite und ich glaube, er hat Frau Strickners Haus beobachtet. Dann hat er sich umgedreht und ist weggelaufen.“
Tech zögerte keinen Moment. „Wohin ist er gelaufen?“
Frieda streckte den Arm in die Richtung, in die er verschwunden war, aus. „Er trägt eine helle gelbe Jacke.“
Sofort setzte Tech sich in Bewegung und rannte los. Um ein Haar wäre er ausgerutscht, fand aber noch rechtzeitig das Gleichgewicht wieder.
Na warte, dachte er, dich krieg ich.
Und er gab sich wirklich Mühe. Er rannte so schnell er konnte, aber er war leider kein Läufer. Er war noch nie in seinem ganzen Leben joggen gewesen. Das rächte sich jetzt. Dazu kam seine Erkältung. Er spürte förmlich, wie seine Lungen bereits nach wenigen Metern bebten und brannten. Er wollte nicht aufgeben, aber nach etwa dreihundert Metern tat er es doch. Er brach den Lauf ab und stützte keuchend die Hände auf die Knie.
Wer immer es gewesen war, die Person war verschwunden. Keine Chance mehr, sie einzuholen.
„Es war ein Mann“, sagte Frieda Behnke zehn Minuten später überzeugt.
„Sind Sie sicher?“ Völlig erschöpft saß Tech in ihrem Wohnzimmer. In seiner Jackentasche suchte er nach einem Taschentuch und putzte sich die Nase. Dann schob er sich ein weiteres Mentholbonbon in den Mund.
„Nein. Nicht hundertprozentig. Aber seine Bewegungen und seine Größe … Es muss ein Mann gewesen sein.“
Aber war eine helle gelbe Jacke nicht viel zu auffällig für einen Mörder? Tech steckte das Taschentuch wieder weg. „Bitte beschreiben Sie mir, was sich heute Abend abgespielt hat.“
Wie auf Kommando begannen Tränen über Friedas Wangen zu rollen. „Es war fürchterlich. Ich kann es immer noch nicht glauben.“
Tech reichte ihr ein frisches Taschentuch.
Sie griff danach und tupfte die Tränen weg. „Ich bin jetzt über sechzig Jahre alt und das ist das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Furchtbar. Einfach nur furchtbar. Einen Menschen so … aufzufinden.“
Ein paar Sekunden vergingen.
Zwar wollte Tech so schnell wie möglich alle Informationen, aber er wollte sie nicht um jeden Preis. Schließlich sagte er: „Sagen Sie bitte, was geschehen ist.“
„Also, das war so“, setzte Frieda an, „ich bin zu Frau Strickners Haus gegangen, weil ich ihr einen selbst gebackenen Christstollen bringen wollte. Das mache ich jedes Jahr. Das Licht im Haus brannte, ich habe geklingelt, aber sie hat nicht aufgemacht, und da dachte ich: Da stimmt was nicht. Deshalb habe ich durchs Wohnzimmerfenster geschaut und habe gesehen … Ich bin sofort wieder hierher gelaufen und habe die Polizei gerufen. Da war es genau 19:56 Uhr.“
„Wie kommt es, dass Sie sich bei der Uhrzeit so sicher sind?“, wollte Tech wissen.
„Das bin ich immer, auf die Minute genau. Ich schaue ständig auf die Uhr.“ Frieda machte eine Bewegung mit der Hand. „Man kann das wohl einen Tick nennen. Ich wusste, wie spät es war, als ich mein Haus verließ – 19:45 Uhr - und ich sah wieder auf die Uhr, als ich nach dem Telefonhörer griff. 19:56 Uhr.“
„Und Sie haben sofort gesehen, dass Frau Strickner tot war?“
„Nun, da konnte es wohl keinen Zweifel geben.“ Frieda schluckte schwer. „Sie lag auf dem Rücken. Um ihren Kopf herum war Blut. Es war einfach nur schrecklich.“ Wieder tupfte sie ihre Augen ab.
„Haben Sie sonst noch etwas bemerkt, als Sie ins Wohnzimmer schauten?“
„Nein.“ Frieda schüttelte den Kopf. „Eine Kaffeetasse lag zerdeppert auf dem Boden, so als ob sie gerade daraus getrunken hätte, als sie … Mehr ist mir nicht aufgefallen. Nein.“
Tech überlegte einen Moment, dann fragte er weiter: „Waren Sie mit Frau Strickner befreundet?“
„Nein, das kann man so nicht sagen.“
„Aber Sie haben sie gut genug gekannt, um ihr einen Kuchen zu bringen.“
„Das mache ich, wie gesagt, jedes Jahr zu Weihnachten. Weil man das eben so macht. Aber mehr …“ Noch einmal schüttelte Frieda den Kopf. „Ich kannte sie nicht besser als jeder andere hier in der Nachbarschaft auch. Sie lebte sehr zurückgezogen, blieb gern für sich.“ Schnell hob sie die Hände in die Höhe. „Verstehen Sie mich nicht falsch, Frau Strickner war eine sehr nette und freundliche Frau, sie grüßte immer und wir wechselten auch stets ein paar Worte miteinander, wenn wir uns auf der Straße trafen. Mehr war aber nicht. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie überhaupt noch irgendeinen gesellschaftlichen Umgang pflegte, seit ihr Mann gestorben ist.“
„Wann ist er denn gestorben?“, wollte Tech wissen.
„Vor elf Jahren. Er hat sich erhängt.“
„Wirklich?“
„Ja, das war eine tragische Geschichte.“ Frieda runzelte die Stirn. „Frau Strickner hat diesen Verlust gar nicht gut verkraftet und sich danach immer weiter zurückgezogen.“
Tech überlegte wieder einen Moment, dann fragte er weiter: „Wann haben Sie sie das letzte Mal lebend gesehen?“
Frieda leckte sich über die Lippen. „Gestern Abend. Um 17:13 Uhr. Ich kam gerade vom Friseur. Da das Wetter so schlecht war, hatte ich mir ein Taxi genommen und mich nach Hause bringen lassen.“
„Heute haben Sie sie den ganzen Tag über nicht gesehen?“
„Nein.“
„Und als Sie sie gestern gesehen haben, haben Sie da mit ihr gesprochen?“
„Nur ‚Guten Abend‘, mehr nicht. Allerdings habe ich heute, am späten Nachmittag – 16:14 Uhr -, beobachtet, wie ein Mann an ihrer Tür klingelte. Ich habe es von meinem Fenster aus gesehen.“
„Was für ein Mann?“
„Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er war schon öfter bei Frau Strickner. Nicht sehr regelmäßig und nicht sehr oft, aber sein Wagen stand schon ein paar Mal vor ihrem Haus. Vermutlich fiel es mir nur deshalb auf, weil sie ja ansonsten, wie ich bereits sagte, kaum Kontakt zu anderen Menschen hatte.“
„Wissen Sie, was für einen Wagen der Mann fuhr?“
„Ich kenne mich nicht so gut aus mit Automarken.“
Schade, dachte Tech.
„Aber ich habe mir das Kennzeichen gemerkt.“
Tech sah auf und spürte, wie eine Art Rauschen durch seinen Körper ging.
„Ich konnte es mir ganz leicht merken. H wie Hannover. FB wie Frieda Behnke. 100.“ Frieda lächelte schüchtern.
„Ich danke Ihnen, Frau Behnke“, sagte Tech. „Sie haben mir wirklich sehr geholfen.“
4. KAPITEL
Steganografie
Hannover
21:16 Uhr
Julia und Eva befanden sich inzwischen wieder in der Innenstadt. Umgeben von wirbelndem, wallendem Weiß, konnten sie gerade noch die Umrisse einer kleinen Trinkhalle erkennen, die sich auf der anderen Straßenseite befand, deren Konturen sich aber mit jedem Augenblick weiter aufzulösen schienen.
„Tee!“, stieß Eva aus. „Köstlicher, heißer Tee!“
„Wir sollten nicht übermütig werden“, sagte Julia.
„Ich bitte dich, Julia! Ich bin durchgefroren bis auf die Knochen. Gönn mir wenigstens einen heißen Tee. Jetzt.“
„In der Pension haben wir es auch warm und dort können wir auch Tee trinken.“
„Bis wir die Pension erreicht haben, bin ich ganz bestimmt erfroren. Ich fühle mich, als wäre ich mitten in einen Film über die Apokalypse geraten.“ Ohne eine Antwort abzuwarten, überquerte Eva bereits die Straße.
Julia sah sich gezwungen, ihr zu folgen.
Schnaufend eilte Eva in die Trinkhalle und auf eine Theke mit Holzplatte zu. „Was muss ein Mädchen tun, um hier einen heißen Tee zu bekommen?“, fragte sie. „Und ich meine, einen richtig heißen Tee.“
Der Mann hinter der Theke, ein hochgewachsener Typ, dessen blonde Haare vom Kopf abstanden, als hätte er gerade in eine Steckdose gefasst, und an dessen Pullover ein Schild steckte, auf dem „Bertram“ stand, lächelte. „Heißer Tee mit Rum, wie wäre es damit?“
„Das klingt wunderbar.“
„Und Sie?“, wandte Bertram sich an Julia.
„Für mich auch.“
Er nickte und machte sich daran, einen Wasserkocher einzuschalten. „Da haben Sie sich aber einen beschissenen Tag für einen Spaziergang ausgesucht“, sagte er und deutete mit dem Daumen auf einen kleinen Fernseher, der auf der rechten Seite unterhalb der Decke befestigt war. Der Nachrichtensprecher, der nicht eine Falte im Gesicht hatte, wurde gerade von einer detailgetreuen Karte Deutschlands abgelöst, über die eine animierte weiße Masse ruckelte.
„Dieses beschissene Wetter wird uns noch ein paar Tage zu schaffen machen“, fügte Bertram hinzu. „Weshalb ich heute eigentlich gar nicht öffnen wollte. Sie beide sind die einzigen Gäste, die ich heute Abend hatte. Über die Feiertage lasse ich den Laden am besten geschlossen.“ Er seufzte leise. „Kommt sowieso keiner.“ Noch einmal seufzte er, dieses Mal etwas lauter. „Muss ich Weihnachten eben mit meiner Frau verbringen.“
„Sie müssen?“ Eva lächelte. „Klingt, als wäre es eine Tortur.“
Das ließ Bertram auflachen. „Und ob es das ist. Sie haben ja keine Ahnung. Ich bringe Ihnen gleich den Tee.“
Sie nickten und stellten sich an einen runden Tisch etwas abseits.
Wenig später wurden zwei Tassen vor ihnen abgestellt, die die Größe von Apfelweinkrügen hatten. „Bitte sehr. Darf‘s auch was zu knabbern sein? Eine Tüte Erdnüsse vielleicht?“
Evas Augen begannen zu leuchten. „Bitte, ja!“
Sie wurden ihr gebracht.
„Danke! Sie sind mein Retter!“
„Sehr gerne.“ Bertram verschwand wieder hinter seiner Theke und Eva trank mit einem erleichterten Seufzer von ihrem Tee. „Junge, tut das gut.“ Sie zog die Handschuhe aus und machte sich daran, die Tüte mit Erdnüssen zu öffnen, wovon sie sich beachtliche Mengen in den Mund schob. „Willst du auch?“, fragte sie.
„Nein, danke.“ Julia, auf deren Tasse in leuchtenden Buchstaben „Jemand liebt dich“ stand, trank ebenfalls einen Schluck. Dann zog sie sich die Strickmütze vom Kopf und fuhr sich mit den Fingern durch die feuchten Haare. „Möchtest du über das sprechen, was wir in dem Haus gesehen haben?“
„Ich möchte am liebsten nie wieder darüber sprechen.“ Eva griff sich noch eine Portion Erdnüsse.
„Okay.“
Sie schwiegen ein paar Minuten.
Erst als Eva alle Erdnüsse verspeist und die leere Tüte von sich geschoben hatte, sagte sie: „Warum könnten sie ihn umgebracht haben?“
Verwirrt sah Julia auf. „Ich dachte, wir wollten nicht darüber reden.“
„Ich habe gerade festgestellt, dass es mir auch nicht besser geht, wenn wir nicht darüber reden. Also, warum haben sie ihn an die Wand … genagelt?“
„Ich weiß es nicht. Vielleicht als Warnung.“
„An uns?“
„Ich weiß es wirklich nicht, Eva. Der Mann muss auf der Seite der Guten gestanden haben. Er war mein Ziel. Das Medaillon führte mich genau zu ihm. Hätte er noch gelebt, hätte er vermutlich in dem Haus auf mich gewartet. Aber sie haben ihn vorher gefunden und ausgeschaltet. Und jetzt stochern wir wieder im Nebel.“
Eva nickte und starrte in ihren Tee. „Der arme Mann. Diese Leute sind wahre Teufel.“
„Ja, das sind sie. Aber das wissen wir ja nicht erst seit heute.“
„So habe ich im letzten Frühjahr auch …“ Eva brach ab. „Nur dass ich an ein Kreuz genagelt war und nicht an die Wand. Und dass ich überlebt habe. Dank dir.“ Sie hob den Blick und sah Julia an.
„Packst du es?“, fragte diese.
„Ich werde den Rest meines Lebens brauchen, um das irgendwie zu packen.“ Eva schluckte. „Was können wir jetzt noch tun? Wenn der Mann in der Hütte den nächsten Hinweis für uns hatte, dann hat er ihn vermutlich mit in den Tod genommen.“
„Oder die Kraniche haben ihn.“
„Das würde bedeuten, dass sie die Kassette haben, oder?“
„Vermutlich ja.“
„Und was dann?“
„Dann haben wir verloren.“ Julias Blick fiel auf eine kleine Holztafel, die über der Theke hing. Darauf stand: Denkst du an Engel, so bewegen sie ihre Flügel.
Engel. Das Wort hallte durch ihren Kopf.
„Alles in Ordnung?“, fragte Eva.
Julia sah sie an. „Das Gemälde.“
„Was für ein Gemälde?“