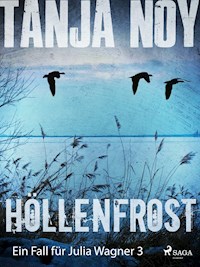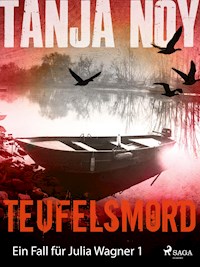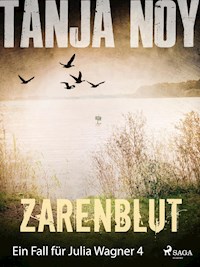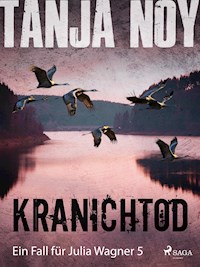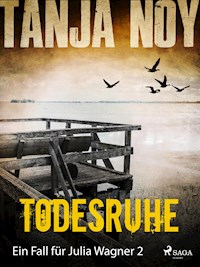
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Julia Wagner
- Sprache: Deutsch
Der zweite Fall für Julia Wagner und ihren ehemaligen Polizeikollegen Zander: In der geschlossenen Psychiatrie "Mönchshof" in Hannover, in der sich die Protagonistin nach den aufwühlenden Ereignissen aus dem ersten Band "Teufelsmord" erholt, geschieht ein schrecklicher Mord. Die internen Ermittlungen von Julia und Zander bringen so manche üblen Machenschaften in der Klinik ans Tageslicht. Doch scheint es jemandem aus Julias Vergangenheit gar nicht zu gefallen, dass sie dort herumschnüffelt...Eine bis zur letzten Seite spannende Krimireihe, in deren Zentrum die ehemalige Polizistin Julia Wagner steht, die mit ihrem früheren Kollegen Zander so manch rätselhaften und gefährlichen Fall löst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tanja Noy
Todesruhe - Ein Fall für Julia Wagner: Band 2
Für Katja. Immer.
Saga
Todesruhe - Ein Fall für Julia Wagner: Band 2Coverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 2014, 2020 Tanja Noy und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726643077
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
PROLOG
April 2010
Es war 3:34 Uhr, als Dr. Michael Jöst im Klinikum Hannover angepiepst wurde. Kurz darauf teilte man ihm mit, dass gerade zwei Frauen eingeliefert worden seien. Eine von beiden hätte schwere Schussverletzungen.
„In Ordnung“, sagte Jöst müde. Er hatte seit zwölf Stunden Dienst und gerade erst einen Schwerverletzten hinter sich gebracht, der nach einem Unfall von der Feuerwehr aus seinem Auto herausgeschnitten werden musste. Nun saß er im Bereitschaftszimmer, blickte aus dem Fenster und sah, dass es am Himmel heftig blitzte. Er nahm einen letzten Schluck kalten Kaffee, dann eilte er mit schnellen Schritten in die Notaufnahme.
Sein Kollege kümmerte sich um die erste Patientin, die hereingefahren wurde: Die Frau war eindeutig unterkühlt, mit diversen Schnittverletzungen und Löchern in Händen und Füßen. Es sah gerade so aus, als wären große Nägel hindurchgeschlagen worden.
Jöst selbst fiel es zu, sich um die zweite Patientin zu kümmern, die Frau mit den Schussverletzungen. Er untersuchte die Bewusstlose kurz und stellte fest, dass sie dreckverkrustet, blutverschmiert und schwer verletzt war. Eine Kugel war in die linke Seite eingeschlagen und zwischen der zweiten und dritten Rippe stecken geblieben. Die andere steckte knapp unterhalb des Herzens.
„Wir haben ihren Ausweis“, sagte eine der Krankenschwestern. „Ihr Name ist Julia Wagner.“
„Röntgen.“
Und dann begann seine Arbeit.
Zur selben Zeit warf Polizeiobermeister Arnulf Ebeling todmüde einen Blick auf die Uhr, während die Worte eines sichtlich erbosten Polizeichefs in Schallgeschwindigkeit an ihm vorbei rauschten. „Dilettant“ und „personifizierte Inkompetenz“ war noch das Freundlichste, was ihm um die Ohren flog. Und es war noch lange nicht zu Ende: „Wie konnten Sie alleine in diese Kapelle stürmen, wo Sie doch davon ausgehen mussten, dass sich dort ein hochgefährlicher Serienmörder aufhält? Der Mann hat mindestens fünf Menschen umgebracht, nach allem, was wir bis jetzt wissen. Und da marschieren Sie einfach so rein, als hätte er betrunken eine Spazierfahrt gemacht?“
Ebeling schloss für einen kurzen Moment die Augen. Er hatte gewusst, seine Zeit bei der Polizei war ohnehin beendet. Er hatte Fehler gemacht. Zu viele Fehler. Und vielleicht war gerade das der Grund gewesen, weshalb er, ohne noch einmal darüber nachzudenken, in die Kapelle gestürmt war, wo er Wolfgang Lange erschossen hatte, nachdem er den Anruf von Edna Gabriel bekam.
Nun lag ein hoch geachteter Kriminalbeamter tot auf dem Boden der alten Kapelle. Daneben ein ebenso erschossener katholischer Pastor und zwei Frauen: die eine mit zwei Kugeln im Leib, die andere lebendig an ein Kreuz genagelt.
Das war gar nicht gut. Und so war die erste Amtshandlung, die Ralf Jockel beging, kaum dass er am Tatort angekommen war, zu brüllen, dass er gefälligst eine Erklärung erwarte „für die verfluchte Scheiße hier“!
Ebeling erklärte ihm so ruhig wie möglich, dass Wolfgang Lange – der hoch geachtete Polizist – ein Satanist gewesen sei.
„Satanist?“, spie Jockel aus und wies einen Kollegen an, Ebeling fortzuschaffen und ins Irrenhaus zu bringen.
Ebeling protestierte und erklärte, dass Lange tatsächlich ein hochgefährlicher Mann gewesen sei. Es hätte nicht so viele Tote gegeben, so gestand er immerhin ein, wenn er sich früher eingeschaltet und durchschaut hätte, was in seiner Dorfgemeinschaft in Wittenrode tatsächlich vor sich ging.
Daraufhin blickte Jockel überhaupt nicht mehr durch. Er nannte Ebeling einen inkompetenten Trottel und brüllte: „Ich werde Sie wegen jedem einzelnen Ihrer Dienstvergehen drankriegen! Sie werden auf einem Polizeirevier nicht einmal mehr Bleistifte anspitzen! Darauf können Sie sich verlassen!“
Das wusste Ebeling, und deshalb schwieg er. Selbst wenn er hätte antworten wollen, er wäre gar nicht dazu gekommen, weil Jockel bereits die nächste Frage in Richtung Himmel brüllte: „Und warum, in drei Teufels Namen, wollte Lange ausgerechnet diese beiden Frauen umbringen?“
„Ich vermute, es geht um Sven Wagner.“
„Sv…“ Jockel brach ab und hustete. „Was hat Sven Wagner damit zu tun?“
Ebeling wischte sich den Schweiß von der Stirn. „Eine der beiden Frauen ist seine Tochter.“
Einen kurzen Moment hielt Jockel inne. Dann hob er langsam eine Hand und deutete dem Krankenwagen hinterher, der schon lange nicht mehr zu sehen war. „Das war Julia Wagner?“
„Sie kennen sie?“
„Natürlich kenne ich sie! Wie ich auch Sven Wagner kannte. Er hat 1987 die Anklage gegen Bruno Kalis erhoben. Den Teufelsmörder!“
„Kalis war nicht der Teufelsmörder. Der Fall war manipuliert.“
„Manipuliert.“
Ebeling lächelte schwach, weil ihm selbst klar war, wie verrückt sich die ganze Geschichte anhören musste. „Sie haben Kalis mit Absicht über die Klinge springen lassen, weil sie einen Mörder brauchten. Für die Presse und für die Öffentlichkeit. Vielleicht steckt aber auch noch mehr dahinter. Ich weiß nicht, worum es wirklich ging.“
„Sie?“, zischte Jockel.
„Wolfgang Lange, der damals leitende Ermittler. Ta Quok, sein Kollege bei der Kripo. Sven Wagner, der leitende Staatsanwalt. Und der damalige Polizeichef Norbert Kämmerer.“
Jockel wurde immer blasser.
„Sie werden auf Frau Wagners genaue Aussage warten müssen, aber ich weiß, dass Wolfgang Lange der wahre Teufelsmörder war“, fügte Ebeling hinzu. „Über zwanzig Jahre hat er nach den drei Morden damals stillgehalten. Jetzt hat er wieder zugeschlagen. Und alles mit dem Ziel, Julia Wagner zu töten. Und das hat irgendetwas mit ihrem Vater zu tun.“
„Sven Wagner ist seit über zwanzig Jahren tot“, stellte Jockel fest.
„Ich weiß.“ Ebeling hob müde die Schultern. „Und trotzdem …“
„Und wenn er damals tatsächlich vorsätzlich eine falsche Anklage erhoben hat“, zischte Jockel hinterher, „dann war er kriminell.“
„Ja. Das waren sie wohl alle. Irgendwie.“
Dreizehn Stunden später
16:34 Uhr
Oberstaatsanwältin Carina Färbert verschaffte sich einen Überblick über die Situation. Was sich da in dem kleinen Örtchen Wittenrode abgespielt hatte, war eine grauenhafte Geschichte, und in den letzten Stunden waren in dem gerade mal vierhundert Einwohner zählenden Nest von allen Seiten Unmengen an Überstunden angehäuft worden.
Kein Wunder, denn hier ging es gleich um mehrere Verbrechen: der Mord an dem örtlichen Schlachter und der Selbstmord seiner Frau, die hinterhältig in den Tod getrieben worden war; der Mord an einem ehemaligen Polizeichef sowie an einer Bäckersfrau, der von ihrem Mann die Kehle durchgeschnitten worden war – wenigstens dafür schien Wolfgang Lange nicht verantwortlich zu sein. Dann der Mord an einem gewissen Greger Sandmann aus Berlin und an einem katholischen Pastor. Und zuletzt die gefährliche Körperverletzung an einer Frau aus Hamburg, die lebendig an ein Kreuz genagelt worden war, sowie der Mordversuch an einer gewissen Julia Wagner. Zählte man die drei Verbrechen von vor zwanzig Jahren hinzu, konnte Wolfgang Lange inzwischen mit sieben Morden in Verbindung gebracht werden. Und als würde das noch nicht reichen, hatte sich inzwischen herausgestellt, dass er seine Finger offenbar auch noch in anderen kriminellen Geschäften hatte. Genau genommen war der Mann durch und durch böse und korrupt gewesen.
Carina Färbert klappte den Ordner mit den Unterlagen der Voruntersuchung zu und machte sich eine kurze Notiz mit ihrem goldenen Füller, ehe sie zu Klaus Martin hinübersah, Leiter des LKA Niedersachsen, dem sie gegenübersaß und der sie aufmerksam beobachtete.
„Hübsch“, bemerkte er und meinte den Füller.
Sie antwortete nicht darauf, lehnte sich nur etwas zurück. „Leider können wir Lange nicht mehr verhaften“, sagte sie. „Es wäre mir ein Vergnügen gewesen, ihn auf der Anklagebank zu sehen.“
Martin nickte. Ihm auch. Weiß Gott. „Diese Geschichte wird lästig werden. Sehr lästig.“
Die Oberstaatsanwältin nickte, richtete sich wieder etwas auf und steckte mit langsamen Bewegungen die Kappe zurück auf den Füller. „Lassen Sie uns auf Frau Wagner zu sprechen kommen. Was wissen wir bisher über sie? Ich meine, abgesehen davon, dass sie die Tochter des toten Staatsanwaltes Sven Wagner ist.“
Martin räusperte sich und begann in einem Notizblock zu blättern, der auf seinem Schoß lag. „Julia Wagner … am 20. 12. 1977 in Hannover geboren. Größe 1,66 m, Gewicht 55 kg. Dunkelbraunes, halblanges Haar, braune Augen. War bis Januar dieses Jahres in Mainz gemeldet, wo sie bei der Mordkommission gearbeitet hat.“
Carina Färbert hob eine ihrer beiden elegant gezupften Augenbrauen in die Höhe und wiederholte: „Mordkommission?“
„Richtig. Allerdings hat sie den Job nur sechs Jahre gemacht, dann warf sie ihn hin. Dieses Jahr im Januar, wie gesagt. Bis dahin gab es jede Menge Empfehlungen, sie hatte eine Aufklärungsquote von siebenundneunzig Prozent.“ Martin brach kurz ab, weil er diese Art von Berichten eigentlich nicht mochte, die sich irgendein Sesselfurzer irgendwann einmal ausgedacht hatte, damit wieder andere Sesselfurzer die Effektivität der Polizisten im Dienst in kleinen Diagrammen verfolgen konnten, um sie regelmäßig in Rankings an Schwarze Bretter zu hängen. Bildlich gesprochen. „Auf jeden Fall war sie ziemlich gut. Und ziemlich schnell.“ Er blätterte. „Machte 1995 Abitur. Danach ging sie sofort zur Polizei. Dann folgte ein geradezu rasanter Aufstieg. Wurde bereits sehr früh zur Kommissarin befördert.“ Martin sah auf. „Man hätte sie gerne in Hannover behalten, aber sie zog schon wenig später nach Mainz und arbeitete von da an dort für die Mordkommission.“
„Warum ausgerechnet nach Mainz?“, wollte die Oberstaatsanwältin wissen.
Martin hob die Schultern. „Wir überprüfen das noch. Übrigens war sie in Mainz vor drei Jahren an einer ziemlich großen Sache dran, zusammen mit ihrem damaligen Kollegen, es ging um doppelten Kindsmord. Die beiden haben den Fall gemeinsam gelöst und ernteten dafür jede Menge Applaus.“
„Hat dieser Kollege auch einen Namen?“
Martin blätterte wieder. „Zander. Ist immer noch bei der Kripo in Mainz.“
„Wenn Frau Wagner über einen solch guten Ruf bei der Polizei verfügte“, sinnierte die Oberstaatsanwältin, „warum hat sie den Job dann aufgegeben?“
„Das wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass sie im Januar, quasi von heute auf morgen, Job und Wohnung gekündigt hat und dann für ein paar Wochen ohne festen Wohnsitz unterwegs war. Sie übernachtete immer nur für kurze Zeit in irgendwelchen Hotels und fuhr dann weiter. Immer an der Ostseeküste entlang.“
„Und wissen wir auch, warum sie das getan hat?“
„Nein. Bisher leider noch nicht. Das müssten Sie schon sie fragen, Frau Oberstaatsanwältin.“
„Wenn ich sie fragen könnte, würde ich nicht mit Ihnen hier sitzen.“
Eine passende Antwort formte sich in Martins Geiste, doch er hatte sich im Griff. „Die Besitzer der Hotels, in denen sie in den letzten Wochen abgestiegen ist, sagen alle unisono, dass sie nicht sehr viel gesprochen hätte, aber freundlich und unkompliziert gewesen wäre. Sie benutzt eine Kreditkarte, die sie für fast alles verwendet und deren Konto sie jeden Monat ausgleicht.“
„Und woher nimmt sie das Geld dafür, wenn sie nicht mehr arbeitet?“
„Auch das konnten wir bisher noch nicht nachvollziehen. Offiziell heißt es, sie hätte eine Erbschaft gemacht. Allerdings gestaltet sich die Glaubwürdigkeit dieser Aussage etwas schwierig, da sich weit und breit kein Verwandter mehr in Frau Wagners Umfeld befindet, der ihr etwas vererben könnte, weder lebend noch tot. Und da sie auch kaum Freunde und Bekannte hat … bis auf jene beiden ehemaligen Schulfreunde, mit denen sie sich in Wittenrode getroffen hat, Greger Sandmann und Eva Haack. Sandmann ist inzwischen nicht mehr am Leben, wie wir wissen. Frau Haack wurde in der Kapelle an ein Kreuz genagelt und hat die Sache nur knapp überlebt. Beide verfügen über keinerlei Vorstrafen und scheinen nur durch Zufall in die Geschichte geraten zu sein.“
„Wissen wir, warum sich die beiden mit Frau Wagner in Wittenrode trafen?“
„Zur Beerdigung einer weiteren alten Freundin: Kerstin Jakob. Sie hatte sich im Gefängnis das Leben genommen, nachdem sie den Mord an ihrem Mann gestanden hatte.“
„Dem Schlachter von Wittenrode“, erinnerte sich Carina Färbert. „Den sie aber gar nicht getötet hat.“
„Nein. Auch dahinter steckte Wolfgang Lange.“
Die Oberstaatsanwältin zog düster die Augenbrauen zusammen, und Martin kam eilig zum Ende: „Julia Wagner verfügt über keinerlei uns bekannten Schulden. Kein Ärger mit dem Finanzamt. Sie fährt einen ziemlich alten Volvo. Mit amtlicher Zulassung und bezahlter Versicherung. Das war es.“ Damit klappte er den Notizblock zu und legte ihn zurück auf seinen Schoß.
Zwanzig Sekunden blieb es daraufhin still, während Carina Färbert nachdenklich an ihrer Unterlippe zupfte. Dann richtete sie sich auf und sagte: „Gut. Nein, ganz und gar nicht gut.“ Sie seufzte. „Wir werden uns mit Frau Wagner unterhalten, sobald sie in der Lage dazu ist.“
„Wir?“ Martin blinzelte.
„Nun, ich war schon lange nicht mehr draußen auf dem Schlachtfeld. An der Basis, sozusagen.“ Carina Färbert nickte unterstreichend. „Und in diesem Fall bin ich unbedingt der Meinung, dass ich mich persönlich mit Frau Wagner unterhalten sollte. Und dann … Nun ja, je eher die Akte geschlossen ist, desto besser.“
„Und Sie arbeiten wirklich bei der Mordkommission?“, fragte Sissi, deren Nachname Zander schon wieder entfallen war, zur gleichen Zeit und zog dabei kokett die blonden Augenbrauen nach oben. „Wie ist das so? Was müssen Sie da so alles sehen? Lieber Himmel, das muss ja aufregend sein!“ Sie gestikulierte mit den Händen, während die Worte ohne Atempause aus ihrem Mund purzelten.
Zander lehnte sich schwer in seinen Stuhl zurück. „Es ist ein Job. Und irgendjemand muss ihn schließlich machen, nicht wahr?“
Nebeneinander saßen sie am Ende eines ausgezogenen Wohnzimmertisches, bei seiner Schwester Nicole in Mainz. Er trank einen großen Schluck Kaffee und ließ den Blick zum Schrank schweifen, der die ganze Wand einnahm. Er war deckenhoch und erdrückte alles andere im Raum. Symptomatisch für den Rest des Hauses bogen sich die Borde unter einer Flut von Porzellan, Kleinkram und von Kindern getöpferten Kunstwerken und Bildern. Überall verteilt standen Familienfotos, darunter auch eins von ihm selbst.
Auf der anderen Seite des Tisches saß Nicole, die ihr glattes dunkles Haar lose hochgesteckt hatte und mit ihrem Mann Jonas und den beiden Kindern gestikulierte. Es war ihr dreiundvierzigster Geburtstag, deshalb saßen sie alle zusammen hier, aßen Kuchen und tranken Kaffee. Das Lachen und die hohen Stimmen hallten von der niedrigen Decke wider und versetzten Zanders rundem Schädel, der ohnehin schon ohne Unterlass brummte, noch zusätzliche spitze Stiche. Für gewöhnlich freute er sich, mit seiner Familie zusammen zu sein, aber er hatte in der letzten Nacht nicht gut geschlafen. Eigentlich passierte ihm das selten, er hätte auch nicht sagen können, warum.
„Es tut mir leid“, sagte Sissi.
Mühsam konzentrierte er sich wieder auf sie. „Was?“
„Ich wollte nicht so überrascht klingen, aber ich verbringe meine Tage mit Vorschulkindern im Kindergarten, während Sie … Kann ich mir das vorstellen wie im Fernsehen? Wie im Tatort, oder so?“
„Nein, in der Wirklichkeit ist es ganz anders.“
„Mein Bruder hatte schon mit einigen sehr interessanten Fällen zu tun“, schaltete Nicole sich in das Gespräch ein, während sie ihm ein weiteres Stück Käsekuchen auf den Teller schaufelte. „Frag ihn, ob er dir davon erzählt, Sissi.“
Sissi produzierte ein schwaches Lächeln, und Zander warf seiner Schwester einen warnenden Blick zu, den sie jedoch ignorierte.
Er seufzte leise auf. Das hatte sie sich fein ausgedacht. In drei Jahren würde er fünfzig werden, und seine Schwester war fest entschlossen, ihn diesen Tag nicht allein und als Single erleben zu lassen. Dafür konnte er nun schwerlich Sissi einen Vorwurf machen, die hoffentlich – wahrscheinlich aber eher nicht – ahnungslos war. Sie sah eigentlich ganz nett aus, und sicher war sie das auch, aber Zander hatte kein Interesse – und er hatte auch nicht die Absicht, seine Schwester die Fäden ziehen zu lassen, nur weil er ihrer Meinung nach nicht alleine sterben sollte.
Er bemerkte, dass die Kaffeekanne leer war, und erhob sich dankbar. Sofort wirkte es, als fülle er das ganze Zimmer aus. Das lag zum einen an seiner Größe, er war beinahe einen Meter neunzig groß, und zum anderen an seiner Breite, er wog um die hundertzwanzig Kilo.
Zander wusste, dass er dringend abnehmen musste, aber er war der Meinung, dass die Menschen erst einmal aufhören sollten, sich gegenseitig umzubringen. Wenn ihnen das gelang, dann würde er auch anfangen zu fasten.
Kaum hatte er die Küchenzeile erreicht, stand Nicole auch schon hinter ihm und zischte: „Ich mach das. Setz dich sofort wieder hin.“
Zander seufzte und trat den Rückweg an. Das Stechen in seinem Kopf wurde immer schlimmer.
„Wo waren wir stehen geblieben?“, fragte Sissi, kaum dass er wieder neben ihr Platz genommen hatte. „Ach so … Ich wäre nie darauf gekommen, was für einen Beruf Sie haben.“
„Sie meinen, ich sehe nicht aus wie ein Polizist?“
„Sie sehen jedenfalls nicht so aus, wie ich mir einen Kriminalbeamten immer vorgestellt habe. Sie wirken so …“ Sissi überlegte. „Seriös. Eher wie ein Politiker.“
Damit spielte sie auf Zanders teuren dunklen Anzug, die perfekt dazu abgestimmte Krawatte und die sauber geputzten, glänzenden Schuhe an.
Er hob die Schultern. „Ich mag es eben, wenn die Dinge ordentlich zusammenpassen.“
„Später kommt Fußball“, kam ihm Nicoles Mann Jonas endlich zu Hilfe. „Bleibst du, Schwager?“
Zander wollte zu einer Antwort ansetzen, als er das Vibrieren seines Handys in der Hosentasche verspürte. Er holte es heraus und stand schnell auf, mehr als dankbar für die Unterbrechung.
Er ging in die Diele und stieß mit dem Fuß die Tür zu, ehe er das Gespräch annahm.
Kurz darauf hatte er sich verabschiedet und war verschwunden.
18:34 Uhr
Julia wollte schlucken, stellte aber fest, dass ihre Zunge taub und wie gelähmt war. Auch ihre Augen konnte sie nicht öffnen. Ihr ganzer Körper fühlte sich an wie mit einem Presslufthammer bearbeitet.
Aus weiter Ferne vernahm sie eine Stimme, die mit ihr redete, aber sie konnte die Worte nicht verstehen. Dann spürte sie, wie jemand ihre Stirn berührte.
„Hallo? Können Sie mich hören?“
Sie wollte sich bewegen, doch im selben Moment durchzuckte ein höllischer Schmerz ihre linke Seite. Sofort erschlaffte sie wieder in der Bewegung.
„Können Sie die Augen aufmachen?“
Sie tat es widerwillig.
Zuerst sah sie nur seltsame Lichtpunkte, bis sich verschwommen eine Gestalt vor ihr abzeichnete. Sie sah ein fremdes Gesicht. Ein Mann. Dunkelhaarig. Bartstoppeln.
„Hallo“, sagte er. „Ich bin Doktor Michael Jöst. Sie befinden sich in einem Krankenhaus. Sie sind schwer verletzt, und wir mussten Sie notoperieren. Wissen Sie, wie Sie heißen?“
„Julia“, krächzte Julia.
„Sehr gut. Und jetzt zählen Sie bitte bis zehn.“
Julia tat wie geheißen.
Bei acht schlief sie wieder ein.
Als sie das nächste Mal zu sich kam, verspürte Julia einen dumpfen Kopfschmerz, der jedoch noch gar nichts war gegen den noch viel übleren, stechenden Schmerz in der linken Seite, der sie förmlich zu übermannen drohte. Als würde sie in Flammen stehen.
Mühsam versuchte sie, ihre Gedanken zu sammeln. Nach und nach kamen mehr und mehr Bruchstücke der Erinnerung zurück. Und als sie sich dann erinnerte, ergriff sie ein paar Sekunden lang Panik.
Wolfgang Lange.
Mit der rechten Hand tastete Julia vorsichtig ihren Körper ab und stellte dabei fest, dass sie vom Unterleib bis zur Brust dicke Verbände trug.
Dieser Mistkerl.
Dieser satanistische Höllenhund.
Sie erinnerte sich an den Moment, in dem die zweite Kugel ihren Körper getroffen hatte. Das war der Moment, in dem sie sicher war, dass sie sterben würde. Ganz alleine und ohne ein Leben, das vor ihrem inneren Auge Revue passierte. Einfach so.
Und jetzt lag sie da und wunderte sich, dass sie doch noch lebte.
Sie wusste nicht mehr genau, was sonst noch alles geschehen war, aber sie erinnerte sich schemenhaft an die alte Kapelle und an Eva, die am Kreuz hing.
Eva!
Julias Herz begann zu rasen. War sie noch am Leben?
Was mit Pastor Jordan passiert war, hätte Julia in diesem Moment auch nicht beschwören können, aber sie glaubte nicht daran, dass er überlebt hatte.
Und dann fiel ihr plötzlich wieder ein, dass sie Ebeling gesehen hatte. Ebeling, den Wittenroder Dorfpolizisten. Sie war nicht sicher, ob sie es nicht vielleicht nur geträumt hatte, aber sie erinnerte sich an die Tür zur alten Kapelle, die mit einem Mal aufflog, und an tausend kleine Holzsplitter, die in der Luft herumwirbelten.
Einen winzigen Moment öffnete Julia die Augen, dann schloss sie sie wieder. Lange hatte es also nicht geschafft, sie mitzunehmen. Sie hätte glücklich darüber sein müssen, wenigstens erleichtert, aber merkwürdigerweise regte diese Tatsache so gar nichts in ihr. Keine Freude, keine Erleichterung.
Nichts.
Nächster Tag
9:28 Uhr
„Frau Wagner, können Sie mich hören?“
Julia öffnete nicht die Augen.
„Mein Name ist Anita, ich bin Ihre Krankenschwester.“
Keine Reaktion.
„Sie brauchen keine Angst zu haben.“
„Ein Psychopath wollte mich umbringen.“
Die Schwester zögerte kurz. „Nun, das ist wohl richtig. Aber Sie sind noch am Leben, und Ihre Prognose ist gut.“
Julia öffnete die Augen immer noch nicht. „Was ist mit Eva?“
„Mit wem?“
„Eva Haack. Meine Freundin.“
„Ah, Sie meinen die Frau, die gemeinsam mit Ihnen eingeliefert wurde. Nun, sie hatte es ebenfalls ziemlich heftig erwischt, aber sie schwebt nicht in Lebensgefahr.“
„Wo ist sie?“
„Sie liegt ein paar Zimmer weiter. Aber Sie sollten sich jetzt ganz auf sich selbst konzentrieren, um wieder völlig gesund zu werden.“
Julia dachte kurz darüber nach, ob sie es wohl schaffen würde, aus dem Bett zu steigen und persönlich nach Eva zu sehen. Doch dann schob sie den Gedanken beiseite. Sie bekam ja kaum die Augen auf, geschweige denn, dass sie atmen konnte, ohne dass die Schmerzen überhandnahmen.
Aber sie würde es tun. Sie würde nach Eva sehen.
So bald wie möglich.
Der Tag darauf
14:32 Uhr
„Wie geht es Ihnen, Frau Wagner?“
Mühsam hob Julia die Schultern etwas an.
„Ich bin Oberstaatsanwältin Carina Färbert“, stellte die Frau sich vor. Dann deutete sie auf den Mann neben sich. „Und das ist Klaus Martin.“
„Landeskriminalamt“, fügte er erklärend hinzu.
Julia nickte und wartete ab.
„Ist es Ihnen recht, wenn wir das Gespräch aufzeichnen?“, wollte Carina Färbert wissen.
Wieder hob Julia nur leicht die Schultern an.
„Sie haben also keine Einwände?“
Kopfschütteln.
„Gut. Dann schalte ich jetzt ein. Donnerstag, 14. April. Gespräch mit Frau Julia Wagner.“ Carina Färbert warf Martin einen kurzen Blick zu, dann sah sie Julia wieder an. „Würden Sie uns erzählen, was in der Nacht vom 9. auf den 10. April genau geschehen ist, Frau Wagner?“
Keine Antwort.
„Frau Wagner?“
„Ich war in einer Kapelle.“
„Waren Sie alleine dort?“
Schweigen.
„Sie brauchen keine Angst zu haben.“
„Komisch. Das sagt mir jeder.“
Carina Färbert räusperte sich und fragte noch einmal: „Waren Sie alleine in der Kapelle?“
Wieder Schweigen.
„Frau Wagner?“
„Eva Haack. Pastor Jordan. Wolfgang Lange. Und ich.“
„Sie waren also zu viert?“
Nicken.
„Was haben Sie in der Kapelle gemacht?“
„Ich weiß es nicht mehr.“
„Sind Sie sicher?“
„Ziemlich sicher.“
„Warum nur ‚ziemlich sicher‘?“
„Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich an alles erinnere.“
„Versuchen Sie es.“
Keine Reaktion von Julia.
„Pastor Jordan und Wolfgang Lange sind tot, Frau Wagner.“
„Greger Sandmann auch.“
„Also erinnern Sie sich doch.“
Julias Gesicht blieb unbewegt. „Nicht gut genug.“
„Frau Wagner …“ Carina Färbert zögerte einen kleinen Moment, so als müsste sie ihr weiteres Vorgehen genau überdenken. „Wir waren inzwischen in Langes Haus und haben dort einige Dinge gefunden.“ Sie zog einen durchsichtigen Plastikbeutel hervor. Aus den Augenwinkeln erkannte Julia, dass sich Fotos darin befanden. Und ein zusammengefaltetes Stück Papier.
Carina Färbert zog das Papier heraus, faltete es vorsichtig auseinander, und reichte es an Julia weiter.
Es war die Kopie eines alten Zeitungsartikels. Er berichtete über den Autounfall, bei dem ihre Eltern vor über zwanzig Jahren ums Leben gekommen waren und den sie selbst nur knapp überlebt hatte. Julia reichte den Artikel wieder zurück. Sie hatte das alles schon tausendmal gesehen und gelesen.
Carina Färbert zog nun die Fotos hervor, die sie ebenfalls an Julia weiterreichte. Die griff widerwillig danach, blinzelte ein paarmal und konzentrierte sich dann. Das erste Foto zeigte sie selbst in einer Sporthalle beim Handball, damals musste sie so ungefähr neun Jahre alt gewesen sein. Am Rande des Spielfeldes war ihr Vater zu sehen, der aufmerksam das Spiel beobachtete. Das zweite Foto zeigte sie und ihren Vater gemeinsam in einem Schwimmbad, das musste etwa ein Jahr später aufgenommen worden sein. Das dritte Foto zeigte sie und ihre Eltern bei ihrer Einschulung.
„Die Fotos haben Sie bei Lange gefunden?“, fragte Julia.
„Ja. Wir fanden sie, als wir sein Haus durchsuchten.“
„Frau Wagner“, schaltete Klaus Martin sich nun ein, „was uns an den Fotos besonders interessiert, ist der Hintergrund. Sehen Sie bitte noch einmal genau hin.“
Julia betrachtete noch einmal jedes einzelne Foto, konnte aber nichts Ungewöhnliches entdecken.
„Sehen Sie ganz genau hin“, forderte Martin sie auf.
Julia tat wie geheißen. Nichts.
Der LKA-Beamte zog einen schwarzen Filzstift aus seiner Brusttasche und kreiste damit eine männliche Gestalt ein, die in der Sporthalle hinter ihrem Vater stand. Der Mann war kaum zu erkennen, inmitten all der anderen Zuschauer. Genau genommen war er nicht mehr als ein verschwommener Fleck, der einen langen Mantel und einen schwarzen Hut trug und in Julias Richtung zu blicken schien.
Martin machte einen weiteren Kreis, auf dem nächsten Foto, hinter ihr und ihrem Vater im Schwimmbad. Wieder befand sich der Mann in einem Pulk anderer Menschen. Es war Sommer, und es musste ziemlich heiß gewesen sein. Trotzdem war er schwarz gekleidet, dieses Mal trug er allerdings keinen Hut, stattdessen eine Sonnenbrille. Er stand allerdings so weit im Hintergrund, dass es jeder x-Beliebige hätte sein können. Tatsächlich konnte man kaum etwas erkennen.
Das dritte Foto. Martin machte eine weitere Markierung, dieses Mal stand der Mann hinter einer Gruppe von Eltern, am Eingang zur Schule. Allerdings war er nun im Profil abgebildet, deutlicher und aus geringerem Abstand. Irgendetwas an seiner Haltung, der Wölbung seiner Stirn, an seinem Nasenrücken brachte Julia dazu, sich etwas aufzurichten. Es dauerte noch einen Moment, dann sagte sie: „Nein.“
„Wie bitte?“ Carina Färbert zog die Augenbrauen nach oben.
„Ich weiß, was Sie hier versuchen. Aber das kann nicht sein.“ Julia schaute noch einmal genauer hin. Der Mann auf dem Foto hatte keinerlei Ähnlichkeit, was die physische Erscheinung betraf, vermutlich war er sogar fünfzehn Kilo leichter als Wolfgang Lange. Trotzdem kam er ihr bekannt vor. Dies jedoch sprach sie nicht aus. Stattdessen sagte sie: „Das ist nicht Lange. Es besteht überhaupt keine Ähnlichkeit.“
„Das denken wir allerdings doch.“
Julia hob den Blick, sah Carina Färbert an. „Wenn das Lange ist, wer hat dann die Fotos gemacht?“
Die Oberstaatsanwältin erwiderte den Blick ohne zu blinzeln. „Das wissen wir noch nicht. Aber wir sind uns sicher, dass er es ist. Und dass er Sie damals schon beobachtet hat.“
„Warum?“, wollte Julia wissen.
„Aus Liebe.“
„Aus Liebe?“
Carina Färbert räusperte sich. „Wir gehen davon aus, dass Wolfgang Lange Ihre Mutter geliebt hat, Frau Wagner. Wir haben in seinem Haus eine Art Schrein gefunden, den er für sie errichtet hat. Lange hat zweifellos viele schreckliche Dinge getan. Aber wenn er jemanden geliebt hat, dann Ihre Mutter.“
„Das ist Käse.“ Julia warf einen letzten Blick auf die Fotos, dann ließ sie sie auf die Bettdecke sinken und presste die Lippen zusammen.
Carina Färbert steckte die Bilder zurück in die Plastiktüte und holte nun etwas ganz anderes heraus. „Das hier haben wir ebenfalls in Langes Haus gefunden.“ Sie reichte Julia den Gegenstand, und der blieb nun endgültig das Herz stehen. Eine in der Regel übertriebene Aussage, aber genauso fühlte es sich an. Als würde eine Hand in ihre Brust greifen und ihr Herz so fest zusammendrücken, dass es nicht weiterschlagen konnte.
„Frau Wagner?“
Julias Hand bewegte sich wie von selbst, führte den Gegenstand dicht vor ihre Augen.
„Frau Wagner?“, sagte Carina Färbert noch einmal.
„Das ist der Ehering meiner Mutter“, sagte Julia leise.
„Das ist uns bekannt“, erklärte Klaus Martin. „Und genau darum sind wir hier.“
„Sie möchte nicht mit Ihnen sprechen, Herr Zander.“ In Dr. Jösts Blick lag ehrliches Bedauern.
„Aber warum nicht?“
„Sie ist schwer traumatisiert.“ Der Arzt brach ab, fügte aber sofort hinzu: „Sie wird wieder auf die Füße kommen. Nichtsdestotrotz hat es sie schlimm erwischt. Sie hatte zwei schwere Schussverletzungen, als sie eingeliefert wurde, und diverse Prellungen. Außerdem war sie von Kopf bis Fuß schmutzverkrustet und mit blauen Flecken übersät. Ich glaube, wir können uns alle nicht vorstellen, was in jener Nacht in dieser alten Kapelle vor sich gegangen ist.“
„Und gerade deshalb muss sie mit mir reden.“
Jöst stellte seine Kaffeetasse beiseite und strich sich über den weißen Kittel. „Nicht wir müssen mit diesem Albtraum zurechtkommen. Sie muss es. Und das muss sie erst lernen.“
„Redet sie denn mit Ihnen?“, wollte Zander wissen.
„Nein. Im Augenblick redet sie mit niemandem. Außer mit der Polizei. Und das wohl auch nur leidlich.“
„Dann lassen Sie mich zu ihr, verdammt! Ich will ihr helfen, und ich weiß, dass ich das kann.“
„Das hier kann man nicht angehen, so wie Sie es meinen.“
„Nein? Wie kann man es dann angehen? Sie war völlig hilflos in einer düsteren Kapelle, vollkommen verloren und ganz bestimmt außer sich vor Angst …“
„Es kann nicht mehr geändert werden“, unterbrach Jöst, „und es kann auch nicht mehr verhindert werden, denn es ist bereits geschehen. Wir müssen uns jetzt auf die Zukunft konzentrieren.“
„Am liebsten würde ich diesen Mistkerl von den Toten zurückholen und noch einmal umbringen. Nur geht das leider nicht.“
„Nein, das geht leider nicht. Aber immerhin, sie hat es überlebt. Und wenn sie wieder ins Leben zurückfindet, dann sind Sie da, Herr Zander. Ist Ihnen bewusst, was das bedeutet? Sie werden da sein, wenn sie Sie braucht, und Sie werden ihr helfen, sich dieser Geschichte zu stellen. Sie werden ihr dabei helfen, ihre Vergangenheit zu akzeptieren und sich einer neuen Zukunft zu widmen.“
„Und wie lange wird es dauern, bis sie sich darauf einlässt?“, wollte Zander wissen.
Darauf konnte der Arzt nicht antworten. Vermutlich weil er ahnte, dass es von diesem Tag an noch sehr, sehr lange dauern würde.
1. KAPITEL
Die finstersten Nächte
Drei Monate später
Dienstag, 26. Juli
22:07 Uhr
Sie wusste, dass sie so schnell wie möglich verschwinden musste. Dass sie in Gefahr schwebte und verloren war, wenn er erst auf sie aufmerksam wurde. Sie musste laufen. Doch gerade als sie sich abwenden wollte, stand er auf einmal wie aus dem Boden gewachsen vor ihr und sah auf sie herab.
In seinen Augen war nicht die Spur eines Gefühls zu erkennen. Als er sprach, war seine Stimme genauso kalt wie seine Augen: „Was machst du hier?“
Sie schluckte. „Nichts. Ich …“ Sie brach ab. Ich bin das Licht, er ist der Schatten, dachte sie bei sich. Und: Wäre ich in meinem Zimmer geblieben, hätte ich ihn nicht getroffen. Nicht jetzt. Nicht hier. Und: Wäre ich immer das brave Mädchen geblieben, zu dem man mich erzogen hat, dann wäre ich überhaupt nicht hier gelandet.
Aber für Reue war es nun zu spät. Sie war hier, an diesem Ort namens „Mönchshof“, einer geschlossenen psychiatrischen Klinik, in der alle kranken und verlorenen Seelen der Stadt begraben waren. Bildlich gesprochen. Auf jeden Fall ein düsterer, trostloser Ort.
Jeder Einzelne hier konnte eine lange Geschichte darüber erzählen, wie er hier gelandet war, und sie wusste genau, dass einige der Geschichten hier enden würden. Vielleicht auch alle. Auf jeden Fall war dies die finsterste Nacht ihres Lebens. In jeder Hinsicht. Sie konnte kaum etwas erkennen, die Mondsichel hinter dem vergitterten Fenster wurde von einer dicken Wolkenschicht verdeckt. Ihn aber sah sie, wie er sie von oben bis unten musterte, ehe er eine leichte Kopfbewegung machte. „Warum bist du nicht in deinem Zimmer?“
„Ich bin … gerade auf dem Weg dorthin.“ Sie überlegte, ob es vielleicht doch noch nicht zu spät war, um wegzulaufen. Oder wie lange es wohl dauern würde, bis jemand käme, wenn sie anfing zu schreien. Eindeutig zu lange. Nein, wenn ihr an ihrem Leben etwas lag, dann musste sie tapfer weiterlächeln und hoffen, dass er sie gehen ließ.
Und so lächelte sie tapfer weiter. Das Lächeln erwiderte er jedoch immer noch nicht. Er betrachtete sie nur weiter aus diesen starren Augen, die so kalt waren, als wäre überhaupt kein Leben in ihnen. Sie spürte sein Misstrauen, seinen Argwohn, und ihre Angst bekam nun einen Geschmack, eine Konsistenz und brannte in ihrer Kehle wie Galle, während er herauszufinden versuchte, ob sie etwas gesehen hatte. Er schien das Risiko abzuwägen, das sie darstellte. Dann zischte er: „Wenn du was sagst, bist du tot.“
Sie antwortete nicht, sondern wandte sich um und rannte los.
Stefan Versemann begriff zuerst nicht, was draußen vor sich ging.
Er war gerade auf der Toilette gewesen, nun wusch er sich die Hände, als er mit einem Mal reglos innehielt und aufsah. Für einen kurzen, dämmrigen Moment war er davon überzeugt, draußen auf dem Flur etwas gehört zu haben.
Er verließ das Badezimmer, öffnete die Tür einen Spalt und schaute hinaus. Und da war tatsächlich etwas. Ein verschwommener Schatten, der über den Flur zu schweben schien.
Versemann hielt die Luft an und ärgerte sich, dass er seine Brille nicht aufhatte.
Der Geist Annegrets? War das etwa ein schwarzer Umhang gewesen, den er gesehen hatte? Elisa Kirsch erzählte ständig davon, dass Annegret Lepelja nachts durch die Flure der Klinik geisterte. Allerdings war Elisa auch permanent auf Tranquilizern.
„Müssen Geister eigentlich auch mal auf den Topf?“, hatte Robert Campuzano gefragt, woraufhin sie ihn nur wortlos angestarrt hatte.
„Im Ernst“, sagte Campuzano. „Muss so ein Geist noch Geschäfte verrichten, oder ist das für die kein Thema mehr?“
Wie idiotisch, dachte Versemann nun. Geister. Natürlich gab es keine Geister. Damit schloss er die Tür wieder und legte sich zurück in sein Bett. Es war ein Mensch gewesen, den er dort draußen gesehen hatte, dessen war er sich nun sicher. Und dieser Mensch war natürlich nicht geschwebt, er war lautlos gerannt.
Oder doch nicht?
Doch die tote Annegret?
Versemann seufzte auf. Auf einmal war er sich überhaupt nicht mehr sicher. Auf einmal war er sich nicht einmal mehr sicher, ob er überhaupt etwas auf dem Flur gesehen hatte.
Er seufzte noch einmal leise auf. War das der Wahnsinn, von dem alle hier sprachen?
Aus dem Tagebuch von Annegret Lepelja, 1881:
Wär’s abgetan, so wie’s getan ist, dann wär’s gut. Nun, da ich wieder alleine bin, gestehe ich mir ein, dass ich zur Mörderin geworden bin. Oder zur Vollstreckerin, so wie Svetlana es mir auftrug.
Vielleicht bin ich nur närrisch, doch sind meine Gedanken derart leuchtend bunt gefärbt, dass es mich überrascht, dass die Welt sie nicht aus meinem Schädel bersten sieht. Ich habe diese Gedanken tief in meinem Inneren begraben. Denn dies ist eine riskante Zeit, und ich brauche Nerven wie aus Stein gemeißelt.
Die Gefahren wurden vorher sorgfältig von mir abgewogen. Doch woher sollte ich wissen, wie hätte ich mir je vorstellen können, wie es wäre, es so tot vor mir liegen zu sehen? So still.
Es ist das Beste, nicht mehr daran zu denken.
Jetzt ist es an der Zeit, an mich selbst zu denken.
Vorsichtig und vor allem ruhig muss ich sein. Mir ist kein Fehler unterlaufen. Und so muss es bleiben. Ich werde meine Gedanken tief in mir begraben, damit niemand sie hört.
Dies war Kind Nummer eins.
2:18 Uhr
„Können Sie schon wieder nicht schlafen, Frau Kirsch?“, fragte Felix Effinowicz mit einem leichten Anflug von Gereiztheit. Er war hundemüde und hatte noch beinahe vier Stunden Nachtdienst vor sich.
Elisa Kirsch, ein Spatz von einer Frau, gerade mal ein Meter fünfundfünfzig groß, Prima Ballerina längst vergangener Tage, trug schon wieder ihre bunten Gummistiefel unter einem langen Nachthemd und einer offenen Strickjacke. „Den hier hat sie nach mir geworfen!“, sagte sie und hielt ihm einen dunklen Keramikaschenbecher unter die Nase, der aussah wie ein Hundenapf. „Sehen Sie? Die eine Seite ist ganz abgesplittert. Das ist passiert, als er auf den Boden gefallen ist.“
„Ich verstehe“, sagte Effinowicz, hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, sie einfach zu ignorieren, und dem Pflichtbewusstsein, seinen Job zu machen, was beinhaltete, ihr zuzuhören, irgendwie Verständnis zu zeigen und sie wieder zurück in ihr Bett zu bekommen. Sein Pflichtbewusstsein siegte. „Der Aschenbecher ist also durch die Luft geflogen.“
„Ich hätte die anderen Teile aufheben sollen“, stellte Elisa erschrocken fest. „Hab ich nicht dran gedacht.“ Sie begann, ihre Strickjacke bis zum Kinn zuzuknöpfen, als würde ihr das etwas mehr Zeit geben, um diese Information zu verarbeiten.
„Ist schon in Ordnung. Ich werde gleich danach sehen. Und jetzt gehen Sie wieder ins Bett.“
Elisa rührte sich nicht. „Ich hab gesehen, wie er hoch in der Luft geschwebt ist! Und dann ist er direkt auf mich zugerast. Verstehen Sie?“ Sie zuckte zur Seite, als würde das Ding erneut auf sie zufliegen. „Schnell. Richtig schnell!“
„Okay.“ Effinowicz gähnte. „Und jetzt gehen Sie zurück in Ihr Zimmer und legen sich wieder schlafen.“
Elisa blinzelte. „Sie glauben mir nicht! Natürlich glauben Sie mir nicht! Aber ich weiß doch, was passiert ist! Ich weiß es!“
„Ja. Davon bin ich überzeugt.“
„Denken Sie nicht, Sie wären stärker als sie. Sie fordert, was ihr zusteht.“
„Elisa, gehen Sie jetzt …“
„Sie ist hier, ich weiß es. Aber Sie begreifen es nicht.“
„Das macht nichts“, sagte Effinowicz. „Ich bin es gewohnt, dass ich manches nicht begreife. Und jetzt gehen Sie wieder in Ihr Zimmer, sonst muss ich nachhelfen.“
Elisa hob das Kinn und machte sich davon, allerdings ließen ihre Wortsalven dabei keinesfalls nach: „Dich wird sie sich auch noch holen, wenn du hier weiter große Töne spuckst! Was glaubst du denn? Dass du stärker bist als sie? Und meine Tabletten geben sie mir auch nicht! Aber ich weiß, was ich gesehen habe! Ich weiß es!“
Effinowicz ließ sich schwer auf einen der Stühle im Pflegerzimmer sinken und murmelte: „Ich brauche dringend einen Kaffee.“
4:10 Uhr
Wer würde bestreiten wollen, dass die Seelen der Menschen abgründig sind? Dass ihr Wesen aus dunklen Kammern und unzähligen verwinkelten Gängen besteht? Dass der feste Boden, auf dem wir uns bewegen, gar nicht fest ist? Niemand würde das tun.
Im Gegenteil. Der feste Boden, auf dem wir uns bewegen, ist nichts weiter als eine Illusion. Unter uns befinden sich Abgründe, Hohlräume, tiefste Dunkelheit, und wir bewegen uns darüber, im festen Vertrauen darauf, aus der Gegenwart, im Hier und Heute, eine einigermaßen annehmbare Zukunft formen zu können – und die Vergangenheit zu vergessen.
Aber die Vergangenheit lässt sich nicht übertünchen, egal, was wir auch versuchen. Zu vieles bleibt tief in uns verankert und stößt uns immer wieder an, damit wir es nur ja nicht vergessen. Es quillt hervor wie flüssige Lava, und alles, was ihm in den Weg gerät, zerfällt zu Asche.
Dies war die neunundvierzigste Nacht. Und genau wie in den achtundvierzig Nächten zuvor kroch der Traum wie ein langsam wirkendes Gift in Julias Körper und lähmte sie, während er in die dunkelsten Winkel ihrer Erinnerung vordrang. Es gab kein Entrinnen, keine Möglichkeit die Augen von dem Grauen zu verschließen. Sie war gezwungen, hinzusehen, sie erkannte den Ort. So, wie sie Sandmanns entstellte Leiche erkannte. Die Blutlache, die sich unter seinem reglosen Körper ausbreitete, während das Leben in ihm längst erloschen war.
Dann war auf einmal alles um Julia herum dunkel. So dunkel, dass sie die Hand vor Augen nicht mehr sehen konnte. So lange, bis ein kleines Licht die Schwärze erhellte und auf sie zukam. Die Wände waren unendlich hoch, und es gab nur dieses eine kleine Licht. Das Licht einer Kerze. Sie wusste, dass er es war, und in ihr lieferten sich Angst und Hass einen erbitterten Kampf.
Einen Augenblick lang hörte sie die Stimme ihres toten Vaters: Nur eine einzige Entscheidung, Julia. Und nur du kannst sie treffen. Dann trat Wolfgang Lange aus dem Schatten, lautlos, wie ein Geist. Sie sah es in seinen Augen. Etwas Wildes, Primitives. Seine Lippen formten sich zu einem boshaften Lächeln. In jeder Nacht dasselbe boshafte Lächeln.
Julia wollte schreien, fliehen, doch ihr Körper gehorchte ihr nicht. Sie war starr. In der nächsten Sekunde befand sie sich mit unerträglichen Schmerzen auf dem Boden. Sie konnte nicht mehr schlucken, nicht mehr atmen, kroch verzweifelt rückwärts. Dann sah sie das überdimensionale Kreuz.
An dem Kreuz hing Eva.
„Es ist Zeit, mich um deine Freundin zu kümmern. Sie ist überreif, sozusagen.“
Langes Stimme prallte von den Wänden ab, und in diesem Moment verlor Julia endgültig die Nerven. Sie schrie, aber kein Ton kam aus ihrer Kehle.
Das Messer in seiner Hand wurde zu einer Pistole, zu ihrer eigenen Pistole, ein Schuss krachte wie ein Donnerschlag, und ihr Körper explodierte. Dann ein zweiter Schuss, und Julia sah sich selbst, wie sie zur Seite sackte. Der Boden kam ihr entgegen, sie schlug mit der Schläfe auf und hörte in weiter Ferne Evas Weinen. Der Boden unter ihrer Wange fühlte sich kalt an, aber ihr eigenes Blut wärmte sie, während sie spürte, wie ihr Körper immer schwächer wurde. Die Welt um sie herum verschwamm vor ihren Augen, ehe völlige Dunkelheit sie verschlang.
In dieser Sekunde schlug Julia die Augen auf. Sie blinzelte, versuchte, sich zu orientieren, und stellte fest, dass sie in ihrem Bett lag, vermeintlich sicher in einer psychiatrischen Klinik.
Sie atmete ein paarmal tief durch, um ihren Herzschlag zu beruhigen. Das Blut rauschte in ihren Ohren. Schweiß klebte auf ihrem Gesicht, und ihr T-Shirt war völlig durchnässt. Sie würgte. Ihre Augen brannten. Decke und Wände drehten sich um sie herum.
Kraftlos wollte sie sich vom Bett erheben und sank doch nur auf den Boden davor, rang weiter nach Luft, aber ihre Lungen wollten sich nicht beruhigen, schenkten ihr keinen Sauerstoff.
Mit mehr Kraft, als sie eigentlich besaß, zwang Julia sich auf die Füße und eilte ins Badezimmer, ehe sie sich in die Toilette übergab.
Eine ganze Weile blieb sie anschließend neben der Schüssel sitzen und starrte auf die kalten Fliesen. Dann richtete sie sich auf, zog das feuchte T-Shirt aus und warf es auf den Boden, zwang sich auf die Füße und blickte in den Spiegel. Sie blinzelte nicht, starrte sich einfach nur an. Sie war älter geworden. Oder vielleicht wirkte sie inzwischen auch nur viel älter als zweiunddreißig Jahre. Sie hatte immer noch dieselben dunkelbraunen, halblangen Haare, denselben langen Pony, der ihr über das linke Auge fiel, dieselbe Größe, dieselbe Figur, dieselben Tätowierungen. Aber nun war noch etwas anderes hinzugekommen. Sie betrachtete die beiden Narben, eine unterhalb des Herzens und eine etwas tiefer auf der linken Seite, und plötzlich erinnerte sie sich an das letzte Gespräch mit Frau Dr. Sattler, der Psychologin.
„Ich habe mit Ihrem Kollegen Zander über Sie gesprochen, Frau Wagner.“
„Exkollegen.“
„Sie haben ihn schon wieder hinausgeworfen. Warum wollen Sie nicht mit ihm sprechen?“
Keine Antwort.
„Er macht sich große Sorgen um Sie. Er würde Ihnen gerne helfen.“
Schweigen.
„Sie sind nicht sehr mitteilsam, Frau Wagner.“
„Sie stellen nicht die richtigen Fragen.“
„Wolfgang Lange war Ihr Mentor, richtig? Sie haben ihm vertraut.“
„Ich habe zu vielen Menschen vertraut. Und zu viele Menschen haben mir vertraut.“
„Sie haben in unserem letzten Gespräch angedeutet, er wollte beweisen, dass er besser ist als Sie.“
Schweigen.
„Aber das war er nicht, sonst hätten Sie jene Nacht im April nicht überlebt. Sie waren besser als er.“
Nichts.
„Und Sie sind es noch, denn Sie sind hier. Sie haben sich freiwillig in eine Behandlung begeben, weil Sie leben wollen.“
„Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das wirklich will.“ Julia klappte den Mund zu, und wieder herrschte ein paar Sekunden lang Schweigen.
Dann fragte Frau Dr. Sattler: „Warum wollte dieser Mann Sie töten?“
Keine Antwort von Julia.
„Frau Wagner?“
Julia stand auf, stopfte die Hände in die Taschen ihrer Jogginghose und lief im Zimmer auf und ab. Es dauerte eine ganze Weile, ehe sie sagte: „Ich kenne die Antwort auf diese Frage nicht.“
„Wirklich nicht?“
Erneutes Schweigen.
„Sie gestatten es sich nicht, wütend zu sein“, blieb die Psychologin am Ball.
„Weshalb sollte ich wütend sein?“
„Weil dieser Mann Sie zerstören wollte.“
Keine Antwort.
„Aber er ist tot. Und Sie sind noch am Leben. Wie auch Ihre Freundin noch am Leben ist. Wo ist sie jetzt?“
„Eva? Sie ist abgereist. Mit unbekanntem Ziel. Wer kann es ihr verübeln?“
„Sind Sie jetzt wütend?“
„Wenn ich es bin, dann nicht auf Eva.“
Julia starrte sich immer noch im Spiegel an.
Die Realität hat die lästige Eigenschaft, immer das letzte Wort zu haben.
Selbst wenn die Träume und Erinnerungen nicht gewesen wären, allein durch diese beiden Narben auf ihrem Körper würde sie jeden Tag an das Geschehene erinnert werden.
Sie sah sie, und sie spürte den Schmerz. Und so würde es bleiben.
2. KAPITEL
Störung
Fast genau drei Stunden später, um 7:06 Uhr, gab es in der Klinik eine „Störung“. Gerade hatten die Patienten noch im Speiseraum beim Frühstück gesessen, nun fanden sie sich auf dem Flur wieder und beobachteten interessiert, wie Heide Sacher und Jan Jäger mit großen Schritten auf das Zimmer von Karl Waffenschmied zueilten und dann darin verschwanden. Nur wenige Sekunden später kam auch schon Dr. Silvia Sattler angerannt. Auch sie verschwand in dem Zimmer.
Man sagt, das Schlimmste in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik sei die Langeweile. Und tatsächlich, dies entspricht der Wahrheit. Denn wenn man nicht gerade eine Therapiestunde hat, tut man als Patient den ganzen langen Tag nichts anderes, als sich vom Frühstück zum Mittagessen und vom Mittagessen zum Abendessen zu schleppen. Dazwischen raucht man sich zu Tode – sofern man raucht und über genügend Zigaretten verfügt –, führt belanglose Gespräche – sofern man jemanden findet, der dazu in der Lage ist, sich auf belanglose Gespräche einzulassen – und tut ansonsten … nichts.
Vielleicht spielt man gelegentlich ein Gesellschaftsspiel, was wiederum davon abhängt, ob man jemanden findet, der dazu in der Lage ist, den Sinn und die Spielregeln eines solchen Unterfangens zu erfassen. Oft genug ist dies nicht der Fall, was zur Folge hat, dass Prügeleien entstehen, Spielbretter durch die Luft geworfen oder Spielsteine samt Würfel einfach verschluckt werden, was wiederum jede Menge „Störungen“ zur Folge hat. Ansonsten, wie gesagt, tut man nichts. Außer vielleicht die Welt hinter dem Fenster zu betrachten und sich vorzustellen, was all die freien und – mehr oder minder – gesunden Menschen dort draußen jetzt wohl gerade taten. Vielleicht denkt man auch an die Familie, was dieselbe Frage zur Folge hat. Im Sommer ist es besonders schlimm. Weil die Sonne für jeden scheint. Nur nicht für die Patienten in der Klinik.
Nun also überzog mehr oder minder lautes Gemurmel den Flur, denn endlich passierte wieder einmal etwas.
Der Einzige, dem die Ablenkung von aller Tristesse nicht gefallen wollte, war Stefan Versemann. Störungen jedweder Art brachten seinen Rhythmus durcheinander, und das mochte er gar nicht, weil es ihn unsicher machte. Er brauchte feste Konstanten. Dinge, die absolut sicher waren, die sich beständig wiederholten und auf die er sich verlassen konnte. Deshalb legte sich sein Blick nun auch unwillig auf Waffenschmieds verschlossene Zimmertür. Vermutlich hatte der Alkoholiker, der hier schon zum x-ten Mal eine Entgiftung machte, sein Bett angezündet. Das tat er ständig. Genau genommen war das auch schon wieder eine Konstante, auf die man sich verlassen konnte. Beinahe erleichtert atmete Versemann auf. Dann sah er sich um, und sein Blick fiel auf Robert Campuzano. Der große Mann mit den langen Haaren und den vielen Tätowierungen stand, die Arme vor der Brust verschränkt, vor der Tür zum Speiseraum. „He, Schlaumeier“, sagte er.
„Guten Morgen“, murmelte Versemann und wandte den Blick schnell wieder ab. Er hatte es sich zum Grundsatz gemacht, einen großen Bogen um diesen riesigen Kerl zu machen. Allerdings brachte er es auch nicht fertig, ihn nicht zu grüßen. Campuzano war nämlich höchst aggressiv und leicht reizbar. Man durfte ihn auf keinen Fall provozieren.
Ganz in dessen Nähe stand der alte Viktor Rosenkranz, der wieder einmal sein Jesuskind in den Armen hielt. Das Jesuskind war eine Plastikpuppe, die er immer bei sich trug, niemals losließ und beständig fest an sich drückte.
Viktor litt unter Demenz und war in diesem Augenblick ganz bestimmt in einer ganz anderen Welt, denn wäre er in dieser gewesen, dann hätte er sich nicht so nahe bei Campuzano aufgehalten. Jeder, der noch irgendwie – und wenn auch nur andeutungsweise – klar denken konnte, machte einen großen Bogen um den Mann. Und gerade der alte Viktor, der die achtzig bereits überschritten hatte, konnte sich kaum wehren, was ihn zu einem beliebten Opfer machte.
Versemann sah sich weiter um.
Von Elisa Kirsch war weit und breit nichts zu sehen. Von ihr wusste er nur, dass sie früher einmal eine einigermaßen erfolgreiche Balletttänzerin gewesen war. Er erinnerte sich noch sehr gut daran, wie sehr er sich wunderte, als er zum ersten Mal davon hörte.
„Man darf Menschen nicht nur nach ihrem Jetzt-Zustand beurteilen“, hatte Effinowicz damals zu ihm gesagt. „Für sie alle gab es auch einmal ein Leben vor der Klinik.“
Wie auch immer, Elisa war schwer zu berechnen. Sie nahm nicht täglich am Frühstück teil, obwohl das eigentlich zum Pflichtprogramm gehörte, und es war Versemann noch nicht gelungen, eine echte Regelmäßigkeit in ihren Zeiten zu entdecken. Darüber ärgerte er sich, kam aber nicht dazu, weiter darüber nachzudenken, weil er in diesem Moment Ilona Walter entdeckte, die offenbar die Chance nutzte, sich unbemerkt vom Frühstück zu entfernen und für einen Moment in ihrem Zimmer zu verschwinden, um wenig später mit einem Kulturbeutel unter dem Arm wieder heraus und in Richtung Duschraum zu eilen. Das war merkwürdig, denn sonst duschte sie immer schon vor dem Frühstück. Irritiert zog Versemann die Augenbrauen in die Höhe. Eben noch beim Frühstück hatte er Ilona heimlich beobachtet, wie sie sich eine Tasse von dem koffeinlosen Gebräu eingeschenkt hatte, das sie hier Kaffee nannten. Dann hatte sie die Tasse in kleinen, langsamen Schlucken leer getrunken. Neben ihr hatte eine alte, zerfledderte Zeitschrift gelegen, aber sie hatte nicht hineingeschaut. Sie hatte nur vor sich hingeblickt. Das tat sie oft. Und wie meistens hatte Versemann bei sich gedacht: Sie ist sehr, sehr unglücklich.
Sich wieder konzentrierend, sah er sich nun weiter um. Um den Kreis in seinem Kopf zu schließen und die Störung einigermaßen verarbeiten zu können, fehlten ihm noch drei Personen. Unsicher setzte er sich in Bewegung und schritt suchend den Flur ab. Weder Weinfried Tämmerer noch Susanne Grimm hatten am Frühstück teilgenommen. Julia Wagner war zumindest körperlich anwesend gewesen, jetzt aber gerade nicht zu sehen.
Er ging an Aufenthaltsraum und Pflegerzimmer vorbei. Beide Räume lagen sich direkt gegenüber und verfügten über hohe Glastüren – wobei das Glas natürlich kein Glas war, sondern aus Kunststoff bestand –, damit die Pfleger alles im Blick hatten und sofort einschreiten konnten, wenn es im Aufenthaltsraum zu Streitereien kam.
Susanne Grimm hielt sich im Pflegerzimmer auf. Sie war dort mit der Spüle beschäftigt und schien sich nicht für die Störung zu interessieren. Dafür umso mehr für die Freiheit jenseits des Fensters. Immer wieder warf sie sehnsüchtige Blicke hinaus.
Erleichtert atmete Versemann auf. Auch das war eine Konstante. Dieser sehnsüchtige Blick nach draußen war symptomatisch für die Frau mit den bunten Haaren. Sie stand fast immer am Fenster und blickte hinaus. Natürlich wohnte die Sehnsucht nach Freiheit, nach der Rückkehr in die „normale“ Welt, in ihnen allen. Aber bei Susanne Grimm schien sie besonders stark ausgeprägt.
Jetzt schritt auch Julia Wagner an Versemann vorbei. Auch sie schien sich nicht für die Störung zu interessieren, was ebenfalls nichts Ungewöhnliches war. Die Frau schien sich ohnehin für nichts zu interessieren, was um sie herum geschah. Deshalb nahm er ihr auch nicht übel, dass sie ihn nicht grüßte, ging er doch davon aus, dass sie ihn überhaupt nicht wahrnahm. Sie hatte sich völlig in sich zurückgezogen, sprach so gut wie nie, weshalb man auch nicht viel über sie wusste. Untereinander aber munkelten die Patienten, dass ihr etwas ganz Furchtbares passiert sein musste. Etwas, das sie völlig aus der Bahn geworfen hatte.
So schloss sich der Kreis in Stefan Versemanns Kopf. Jedenfalls beinahe.
Noch einmal sah er sich suchend um.
Wo war Weinfried Tämmerer?
Julia hatte Versemann sehr wohl bemerkt. Er interessierte sie nur schlicht nicht. In ihrem Kopf spielten sich ganz andere Dinge ab. Wie in Trance versuchte sie sich auf die Zimmernummern zu konzentrieren, an denen sie vorbeiging, die geraden Zahlen rechts, die ungeraden links. Auf gar keinen Fall wollte sie nachdenken – und konnte es trotzdem nicht verhindern. Einmal mehr hatte sie das letzte Zusammentreffen mit Eva vor Augen …
An jenem Tag im Mai hatte es geregnet, und Julia hatte sich gefragt, warum zum Teufel es auf einmal so heftig regnete. Genau genommen hatte es geschüttet wie aus Eimern. Die Bäume vor dem Fenster bogen sich im Sturm. Von fern grollte der Donner. Ein heftiges, lautes Maigewitter.
Mit bleierner Mattigkeit in den Knochen, die es ihr schwer machte, sich überhaupt zu erheben, hatte Julia Minuten damit zugebracht, sich unter heftigen Schmerzen ein frisches Sweatshirt überzustreifen, als es an die Tür des Krankenzimmers klopfte. Und dann stand sie auf einmal da. Eva.
Das Licht von draußen brachte ihre hellen roten Locken zum Leuchten, und ihre grünen Augen blickten Julia aufmerksam an.
So standen sie sich ein paar Sekunden gegenüber, unbeholfen, jede erwartete von der anderen, dass sie den ersten Schritt tat und damit den Tenor ihres Wiedersehens bestimmte. Und Julia hatte bei sich gedacht: So ist sie also, die Begrüßung, über die ich so lange nachgedacht habe. Zwei ehemalige Freundinnen, die dem Tod nur knapp entkommen sind, sich nun wiedersehen und nicht mehr wissen, wie sie miteinander umgehen sollen. Dann fiel ihr auf, dass ein Koffer an Evas Seite stand. „Du gehst.“ Mehr fiel ihr nicht ein.
„Ich bin heute entlassen worden.“
„Schön.“ Julia fühlte ein merkwürdiges Stechen in der Brust und blickte zu Boden.
Eva machte zwei Schritte auf sie zu, dann legten sich ihre Finger einen Moment lang auf Julias Hand. „Es ist besser für mich, wieder dahin zurückzugehen, wo ich hingehöre.“
Julias Blick verharrte auf dem Verband, der um Evas Hand gewickelt war. Sie senkte die Augen und blickte auf die andere Hand, die ebenfalls umwickelt war. Die beiden Verbände verbargen die Narben, die die Nägel darin hinterlassen hatten. Noch. Ein Stigma. Auf alle Ewigkeit deutlich sichtbar für jeden.
„Es tut mir so leid, Eva. Es tut mir so unendlich leid.“
Julia hatte gedacht, es würde ihr besser gehen, wenn sie es ausgesprochen hatte. Irgendwo in einem kindischen, idiotischen Winkel ihres Gehirns hatte sie die vage Hoffnung genährt, alles würde irgendwie besser werden, wenn sie sich entschuldigt hatte. Vielleicht würde Eva sie beschimpfen, aggressiv werden. Wahrscheinlich hätte es Julia sogar geholfen, wenn es so gewesen wäre. Aber Eva schimpfte nicht. Sie war auch nicht wütend. Sie stand einfach nur da, und Julia stellte fest, was für eine Idiotin sie doch gewesen war. Naiv war das Wort, das sie heute für jene Gedanken von damals fand. Wenn ein Mensch um ein Haar sein Leben wegen eines anderen Menschen verlor, dann war man ein Idiot, wenn man glaubte, eine Freundschaft würde dadurch keinen Schiffbruch erleiden.
„Wir müssen beide damit leben“, sagte Eva leise. „Du für dich und ich für mich. Verzeih mir.“
Damit ging sie, und die Tür fiel hinter ihr zu.
Julia zählte die Schritte, die sie den Flur auf und ab machte. 199, 200, 201 … Alles war in jenem Augenblick in ihr zerbrochen, sosehr sie Eva auch verstand. Sie fragte sich, was sie wohl getan hätte, wenn auch sie ihretwegen gestorben wäre. Sie musste schon mit Sandmanns Tod leben, wie hätte sie auch noch Evas Tod verkraften sollen?
In diesem Augenblick konnte Julia wieder Langes Gelächter hören. Es war einfach überall, und sie spürte schon wieder einen Anfall von Übelkeit in sich.
Es wäre so einfach, dachte sie. So einfach, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Das Ringen zu beenden. Die Stimmen zum Verstummen zu bringen und die Albträume ein für alle Mal zu zerschmettern. Die Vorstellung war verlockend. In gewisser Weise bot sie sogar die Lösung auf alles. Aufhören zu atmen. Aufhören zu träumen. Aufhören zu denken. So, wie Kerstin es getan hatte. Ein Schritt genügt. Ende und aus.
Als Julia das nächste Mal den Blick hob, stellte sie fest, dass sie gerade an Zimmer Nummer 9 vorbeikam. Nicht, dass es wichtig gewesen wäre, sie registrierte es nur. Doch dann trat sie mit ihrem Turnschuh auf etwas und hielt inne. Eine Serviette. Sie bückte sich, um sie aufzuheben.
Es war eine ganz normale, weiße Papierserviette, wie sie jeden Tag zu Dutzenden im Speiseraum ausgegeben wurden. Der einzige Unterschied zu den anderen war der, dass jemand mit einem dicken schwarzen Stift, vermutlich einem Edding, die Zahl 5 darauf geschrieben hatte.
Julia sah sich um. Hatte jemand die Serviette verloren? Die Patienten hier sammelten alles Mögliche, warum nicht auch Papierservietten?
Julias Blick blieb an der Tür hängen, vor der sie gelegen hatte. Sie stand ein Stück weit offen und als sie genauer hinsah, entdeckte sie im Inneren des Zimmers etwas, was sie nicht sofort einordnen konnte. Ein roter Fleck auf dem Fußboden.
Aus dieser Entfernung hätte alles Mögliche dahinterstecken können, aber Julia wusste instinktiv, dass es sich dabei um nichts Gutes handelte.
Sie zwang sich, einen Schritt auf die halb offene Tür zuzugehen. Dann sah sie etwas, was aussah wie ein ausgestreckter Arm, der sich nach Hilfe reckte. In der nächsten Sekunde kippte das Bild vor Julias Augen und formte sich neu. Sie ließ eine Minute verstreichen, zählte die Sekunden. Dann betrat sie das Zimmer.
3. KAPITEL
Was zu tun oder zu lassen ist
Susanne Grimm beugte sich über den Ausguss der Spüle und löste mit der Zange den Wasserhahn. Dann wischte sie sich den Schweiß von der Stirn und sah noch einmal für einen kurzen Moment aus dem vergitterten Fenster.
Ich hab schon beinahe vergessen, wie sich die Sonne auf meinem Körper anfühlt. Oder der Regen.
Es war Sommer, aber die Farben existierten nur draußen.
Das einzig Gute war, dass der heutige Tag nicht wesentlich schlimmer werden konnte als der gestrige. Aber war das wirklich ein Trost?
Susanne seufzte leise, und während sie weiterarbeitete, versuchte sie sich zu erinnern, wann sie das letzte Mal Sex gehabt hatte. Etwas, an das man sich eigentlich ohne Schwierigkeiten erinnern sollte, aber vor ihrem inneren Auge entstand kein Gesicht. Jedenfalls nicht gleich. Es war einfach zu lange her. Wahrscheinlich auch nicht wichtig genug. Vermutlich auch nicht gut genug.
Doch dann erinnerte sie sich plötzlich wieder. Damals – vor ein paar gefühlten Jahrhunderten –, als sie noch Bass in einer Band gespielt hatte, mit ihrer unvergänglichen Liebe zu Punk. „Punk ist unser Lebensgefühl!“, hatten sie zu Beginn jedes Auftrittes ins Publikum geschrien. Und mit dieser Erinnerung kam auch die Erinnerung an die letzte Frau zurück, mit der sie im Bett gewesen war. Und an den Sex. Und an die Enttäuschung danach. Gerade mal ein bisschen Zeit, um zu tasten und zu schmecken, ein bisschen Gestöhne, und schon trat die Langeweile ein und schimmerte in ihrer ganzen Pracht oberhalb des Bettes.
Der nächste Gedankenschnitt. Susanne sah noch einmal die beiden Polizisten vor sich, die sie vor zwei Monaten aus ihrer Wohnung geholt hatten. Der eine war ziemlich groß gewesen und hätte mit seinem hellbraunen welligen Haar und dem Oberlippenbart perfekt zu den Village People gepasst. Der andere war um einiges kleiner, wesentlich gepflegter, mit schütterem grauem Haar. Beide hatten demonstrativ die rechte Hand an ihre Waffen gelegt, während sie in ihrer Wohnung standen.
„Ziehen Sie sich etwas an und kommen Sie mit“, hatte der mit dem Oberlippenbart gesagt und sie dabei auffordernd angesehen.
Susanne hatte sich nicht gerührt, die beiden nur angesehen. Immerhin, sie hatte gelächelt. Die beiden lächelten jedoch nicht zurück.