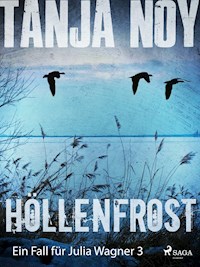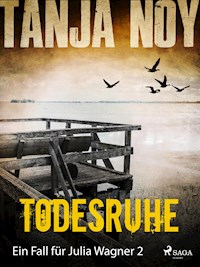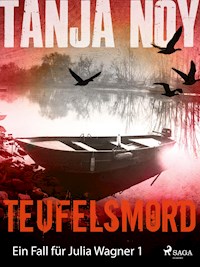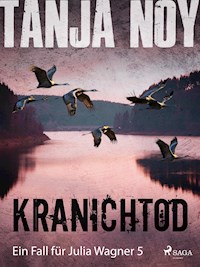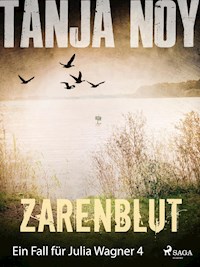
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Julia Wagner
- Sprache: Deutsch
Auch im vierten Teil der Julia Wagner-Krimiserie geht die Jagd gegen das Böse weiter: Scheinbar hat der Geheimbund der Kraniche Julias Mitstreiter Zander entführt – jedenfalls fehlt von ihm jede Spur. Als die von der Polizei gesuchte Susanne, die Julia aus der Psychiatrie "Mönchshof" kennt, in Verbindung zu einem Mord gesehen wird, werden die Dinge immer undurchsichtiger. Und dann sind da immer noch die Fetzen aus Julias Vergangenheit...Eine bis zur letzten Seite spannende Krimireihe, in deren Zentrum die ehemalige Polizistin Julia Wagner steht, die mit ihrem früheren Kollegen Zander so manch rätselhaften und geheimnisvollen Fall löst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tanja Noy
Zarenblut - Ein Fall für Julia Wagner: Band 4
Für Katja. Immer.
Saga
Zarenblut - Ein Fall für Julia Wagner: Band 4Coverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 2016, 2020 Tanja Noy und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726643091
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
PROLOG
November 1989
Mainz
Als Max Laurus sich das letzte Mal von dem alten Mann verabschiedet hatte, hatte er keinen Moment daran gedacht, dass er nicht noch einmal dazu kommen könnte, mit ihm zu sprechen. Er zog die Schultern hoch und steckte die Hände in die Taschen seiner Jacke. Schon die ganze Zeit hatte er ein sonderbares Gefühl. So, als ob irgendetwas Ungutes bevorstand. Etwas wirklich Ungutes.
Der Wind schlug ihm kühl entgegen, während er auf das Haus zuging.
In der ersten Zeit ihrer Freundschaft war der alte Mann noch freundlich gewesen. Nicht besonders redselig, er hatte sich stets nur auf das Wesentliche beschränkt, aber er war immer nett gewesen. Ab und zu ein kurzes, aufmunterndes Lächeln, mehr nicht. Sie hatten sich auch ohne viele Worte verstanden.
Dann aber hatte der alte Mann plötzlich angefangen, sich zu verändern. Immer häufiger hatte er ungeduldig die Stimme erhoben, wenn Max seine Worte nicht sofort verstand. Vor allem in letzter Zeit. Er lebte immer mehr in seiner eigenen Welt, war immer öfter in Gedanken versunken. Aber er war nie gemein. Er wurde auch nie wirklich wütend. Und er war nicht nachtragend. Doch wenn eine Frage zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt gestellt wurde, dann bekam er diesen Ausdruck im Gesicht …
Max seufzte leise und hob den Kopf. Links und rechts des Weges war der Wald schwarz, nackte Bäume zeichneten sich vor dem dunklen Himmel ab und wogten im Wind. In der Ferne bellte ein Hund. Dann fiel ihm ein heller Lieferwagen auf, der ein paar Meter entfernt an der Straße parkte. Er blieb stehen und musterte das Auto genauer: Die Scheiben waren verspiegelt, das Nummernschild nicht zu erkennen. Und doch bildete er sich ein, den Wagen vor ein paar Tagen schon einmal gesehen zu haben. Er erinnerte sich nur nicht mehr daran, wo das gewesen war.
Vielleicht war es aber auch nur Einbildung. Max setzte sich wieder in Bewegung, und gleich darauf erreichte er das Haus des alten Mannes.
Auf dem Boden entdeckte er etwas Glänzendes. Er stutzte, hob es auf und stellte fest, dass es sich um ein Bonbonpapier handelte. Es roch süß, irgendwie außergewöhnlich.
Als Max sich wieder aufrichtete und zum Fenster sah, verschlug es ihm den Atem.
Max Laurus war zwar erst achtzehn Jahre alt, aber er hatte schon immer schlechte Augen gehabt. Jetzt schob er seine Brille auf der Nase etwas höher und starrte noch einmal durch das Fenster.
Er verstand nicht sogleich, was er da sah. Dann jedoch bohrte sich die Erkenntnis, das Verstehen wie eine glühende Nadel in sein Bewusstsein.
Max blinzelte, schluckte. Sein Herz begann zu rasen.
Durch das Fenster sah er, dass der alte Mann in der Mitte des Wohnzimmers auf einem Stuhl festgebunden war. Sein Gesicht war voller Blut und seine Miene von Schmerzen gezeichnet. Ein Auge war zugeschwollen. Sein Bauch hob und senkte sich mit jedem gequälten Atemzug.
Ihm gegenüber stand eine Gestalt, ein Mann, der aussah wie ein Geist. Die Haare waren schneeweiß, und seinem Gesicht fehlte jegliche Farbe. Es schien vollkommen blutleer zu sein. In der Hand hielt er ein Schwert mit einer glänzenden Klinge.
Max konnte die Worte nicht verstehen, glaubte aber, sie von den Lippen des merkwürdigen Mannes ablesen zu können.
„Wo ist der Schlüssel?“
Mit dem gesunden Auge starrte der alte Mann auf ein Kreuz an der Wand und antwortete so etwas wie: „Ihr werdet ihn nicht finden.“
„Weißt du, wer wir sind?“
Nicken.
„Sag es.“
„Ihr seid die Kraniche.“
„Dann weißt du auch, dass du das hier nicht überleben wirst, nicht wahr?“
Wieder ein Nicken.
„Dann mach es dir doch nicht noch schwerer. Sag, wo er ist, und es wird ganz schnell gehen. Ich verspreche es dir.“
Der alte Mann begann leise zu beten: „Vater unser, der du bist im Himmel …“
„Meinetwegen. Du hast es so gewollt.“
Der Weißhaarige legte die Spitze des Schwertes an den Hals des alten Mannes, und dann, in einer einzigen fließenden Bewegung, wurde ihm der Kopf von der Kehle getrennt.
Ein, zwei, drei Sekunden lang war Max völlig gelähmt. Die Scheibe, durch die er starrte, verwandelte sich in eine Wolke aus einer Million kleiner Kristalle. Er schrie nicht, obwohl der Schrei ihm in der Kehle steckte. Aber er bewegte sich auch nicht. In diesem Moment war er davon überzeugt, dass er sich nie wieder würde bewegen können. Er war durchdrungen von Schock und Angst. Lediglich in seinem Gehirn arbeitete es. Ein regelrechter Sturm stob durch seinen Kopf.
Der alte Mann war tot.
Geköpft.
Geköpft!
In der nächsten Sekunde wandte der farblose Mann den Blick in Richtung Fenster, und Max schrak zusammen.
Sie sahen sich direkt in die Augen. Und jetzt, endlich, machte etwas in Max’ Kopf „klick“, und er begann zu laufen.
Er hatte soeben einen kurzen Einblick in die Hölle bekommen, und dieser Hölle, das wusste er, würde auch er nicht lebend entkommen. Sie würden auch ihn schon sehr bald in ihren Klauen haben.
Und deshalb rannte Max jetzt.
Und rannte und rannte.
Und drehte sich nicht mehr um.
Zwanzig Minuten später stand er zitternd in einer Telefonzelle, hielt den Telefonhörer an die Wange gepresst und wählte aus dem Gedächtnis eine lange Reihe von Zahlen. Während kurz darauf der Wählton in seinem Ohr dröhnte, glühten die Gedanken in seinem Kopf wie heiße Nadeln. Der Schmerz war fast unerträglich. Verzweifelt versuchte er, klar zu denken, aber er verspürte nichts als fürchterliche Angst.
Sie lassen niemanden davonkommen, dachte er. Sie sind nicht erfüllt von grenzenloser, göttlicher Liebe, im Gegenteil, sie sind die Teufel, von denen der alte Mann immer erzählt und vor denen er gewarnt hat.
Schweiß rann über Max’ Gesicht, tropfte von seiner Nasenspitze und ließ den Hörer in seiner Hand glitschig werden. Er blinzelte, während es am anderen Ende klingelte. Und noch einmal klingelte. Und zum dritten Mal. Und zum vierten Mal, bevor endlich abgenommen wurde.
„Was ist passiert?“
Es wurden keine Begrüßungsworte ausgetauscht. Es würden auch keine Namen fallen. So war es viele Male einstudiert worden.
„Er ist tot. Sie haben ihm mit einem Schwert den Kopf …“ Max brach ab, hatte das Gefühl, zu fallen. Ein endloser Fall, schwindelerregend und ohne Ende.
Am anderen Ende herrschte ein paar Sekunden lang Schweigen. Dann: „Somit ist es jetzt deine Aufgabe.“
„Aber ich … Ich bin doch nur …“ Verzweifelt zwang Max sich dazu, zu denken, gegen die Panik anzukämpfen. „Wie soll ich das anstellen?“
„Du weißt, was zu tun ist, du bist der Richtige.“
Die Worte verstärkten die Anspannung in Max nur noch zusätzlich. „Sie wissen selbst, dass das nicht stimmt. Und wer sagt mir überhaupt, dass sie mich finden wird? Dass sie überlebt? Und dass ich überlebe.“
Wieder rauschte einen Moment lang das Schweigen in der Leitung, als der Angerufene offenbar über das Gesagte nachdachte. Dann: „Niemand.“
„Das erfüllt mich nicht gerade mit Zuversicht.“
„Sie wird geleitet werden. Pastor Jordan ist ein guter Lehrer. Ihr verstorbener Vater hat ihn wegen genau dieser Qualitäten dafür ausgewählt.“
„Aber wie soll sie mich finden?“
„Wie ich gerade sagte, sie wird geleitet werden.“
„Sie kann dabei sterben. Wir können alle dabei sterben.“
„Ja. Aber wir haben keine andere Wahl. Ich weiß es, und du weißt es auch. Möge Gott mit dir sein.“
Einen Moment später war die Leitung tot.
Ganz langsam legte Max den Hörer auf die Gabel zurück und verließ die Telefonzelle. Er spürte, wie schon wieder Übelkeit in ihm aufstieg. „Keine Wahl“, sagte er leise, rang nach Luft und verharrte in der Bewegung. Dann wirbelte er herum und starrte gebannt den farblosen Mann an, der langsam näher kam. War das wirklich ein Mensch? Max blinzelte. Es musste ein Mensch sein, aber er sah nicht so aus. Kälte kroch sein Rückgrat hinauf, als er in die kalten, durchsichtigen Augen blickte. Nein, das war kein Mensch, das war ein Dämon. Ein Dämon mit einem blutigen Schwert in der Hand.
Genau in dem Moment, in dem Max sich in Bewegung setzte, um davonzulaufen, durchbrach die lange Klinge des Schwertes die Dunkelheit und verfehlte seinen Hals nur um Haaresbreite.
Gott im Himmel, hilf mir!
Max rannte, und die bleiche Gestalt folgte ihm, jedoch ohne Eile. „Du kannst mir nicht entkommen! Das weißt du doch.“
Todesangst pulsierte schmerzhaft durch Max’ Adern.
„Du weißt, wo der Schlüssel ist, nicht wahr?“ Als würde er es ihm direkt ins Ohr flüstern. „Und du weißt, dass wir ihn haben wollen.“
Weiter!
In Max’ Kopf pochte es, sein Atem ging rasselnd. Gab es hier noch mehr, die auf ihn warteten?
Dort drüben! Eine Bewegung!
Kaltes Entsetzen presste Max die Luft aus den Lungen, aber er wollte auch nicht aufgeben und sich dem Unabwendbaren fügen, also rannte er in die andere Richtung. Er stolperte und fiel, schrammte sich das Gesicht auf, verlor die Brille, suchte sie verzweifelt mit den Händen, fand sie, stand wieder auf und rannte weiter. Sein Herzschlag dröhnte wie eine Glocke. Plötzlich wusste er nicht mehr, wo er war. Schatten verwandelten sich in Bäume und Bäume in Schatten.
Max stolperte erneut und fiel hin. Ein heftiger Schmerz fuhr in seinen linken Arm. Mit dem gesunden Arm hielt er ihn fest und rannte weiter.
Mit letzter Kraft erreichte er die Hauptstraße, schluchzend vor Todesangst.
Er sah die Scheinwerfer eines Autos auf sich zukommen. Hell und gleißend.
Ohne noch einmal darüber nachzudenken, warf Max sich auf die Straße.
Hannover
Langsam ließ Walter Wendt sich in seinen Sessel sinken. Dann legte er die Kassette in seinen Schoß und faltete die Hände darüber. Er zerbrach sich den Kopf, wie er die ihm übertragene Aufgabe lösen sollte, eine Aufgabe, für deren Lösung er eigentlich gar nicht die Mittel besaß. Vermutlich auch nicht den Verstand. Er war doch nur ein einfacher Mann.
Nachdenklich starrte er aus dem Fenster.
Es gab keine Alternative, das wusste er. Dies war seine Aufgabe auf Erden.
Man hatte ihm gesagt, dass die Kassette alles enthalte, was sie irgendwann bräuchte, um die Gegner ein für alle Mal zu besiegen. Wendt sah auf den silbernen Kasten hinab, betrachtete die eingravierten Zeichen und Symbole, deren Bedeutung niemand verstand, der die Sprache nicht kannte. Er selbst verstand sie auch nicht. Aber er wusste, dass sie alles verstehen würde, wenn die Zeit gekommen war.
Wenn die Zeit gekommen war.
Wendt seufzte leise. Die Aufgabe würde alles von ihm fordern, und er hoffte von ganzem Herzen, dass er den Mut und die Kraft finden würde, bis zum Ende durchzuhalten.
Während er seine eigenen Augen betrachtete, die sich im Fenster spiegelten, nickte er leicht.
Dann erhob er sich wieder und machte sich daran, die Kassette vor den Feinden zu verstecken. So, wie es ihm aufgetragen worden war.
Wittenrode
Nach dem Abendbrot und dem Gebet, wenn die Kinder des Waisenhauses in ihren Betten lagen und eingeschlafen waren, wenn endlich alles still war, dann saßen sie in Pastor Jordans Büro. Er trug selbst zu dieser späten Stunde immer noch seinen schwarzen Anzug, und vor ihm auf dem Tisch lag ein ebenso schwarzes Notizbuch.
„Erzählen Sie mir von ihm“, bat Julia, während feine Staubteilchen wie aufgewirbelter Goldstaub in der Luft schimmerten. „Erzählen Sie mir von meinem Vater.“
Jordan sah sie einen Moment lang an, dann sagte er mit ruhiger und ernster Stimme: „Er war ein guter Mann. Ein tapferer Mann.“
„Ein Held.“
„Ja. Ein Held, der sich vor keinem Kampf scheute.“
Julias Augen schimmerten im dämmrigen Licht. „Er hatte keine Angst.“
„Oh doch“, sagte Pastor Jordan. „Er hatte Angst. Aber man kann auch ein Held sein, obwohl man Angst hat. Vielleicht gerade dann. Verstehst du, was ich meine?“
„Dass man weitermacht, auch wenn man Angst hat?“
„Richtig. Und genau das hat dein Vater getan. Er tat, was er für richtig hielt, obwohl er sehr viel Angst hatte. Und das macht ihn zu einem wahren Helden.“
Für einen kurzen Moment sah Julia aus dem Fenster, suchte nach den Sternen am Himmel, die kaum zu sehen waren. Dann wandte sie sich Jordan wieder zu. „Er hat gesagt, dass ich ein Engel bin. Ein guter Engel.“
„Oh ja, das bist du“, antwortete Jordan. „Du bist ein guter Engel. Dein Vater hat dich sehr geliebt, und deshalb tat er das Tapferste, was es gibt. Und er tat es für dich.“
„Und was war das?“
„Das wirst du erfahren, wenn du etwas älter bist.“
Es war Julia anzusehen, dass sie mit dieser Antwort nicht zufrieden war, und so fügte Jordan hinzu: „Was wir hier tun, ist ein Geschenk deines Vaters an dich. Was du später damit machen wirst, ist dein Gegengeschenk an ihn.“
„Das verstehe ich nicht.“
„Ein Jegliches hat seine Zeit, Julia. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Es ist noch nicht so weit, aber wenn es so weit ist, wirst du vorbereitet sein.“
„Aber …“
„Lass uns anfangen.“ Jordan schlug das Notizbuch auf.
Auf den ersten Seiten war die einst schwarze Tinte im Laufe der Jahre zu einem trüben Braun verblasst, und es war eine schwierige Aufgabe, die Kreise, Striche, Kreuze und Punkte zu erkennen. Die Schrift war krakelig und völlig fremd, geschrieben in einer Sprache, die man nicht in der Schule lernte. Nicht Griechisch, nicht Hebräisch, nicht Arabisch.
Es war schwer, sich alles zu merken. „Warum müssen die anderen Kinder das nicht lernen?“, fragte Julia. „Warum nur ich?“
Jordan war einen Moment lang verblüfft. Nicht über die Frage selbst, die stellte sie fast jeden Abend, nein, er war überrascht über den Tonfall ihrer Stimme.
„Weil es wichtig ist“, sagte er. „Das habe ich dir doch gerade erklärt. Es ist sehr wichtig für das, was noch kommen wird.“ Seine Augen machten klar, dass er mehr dazu nicht sagen würde, und so lernten sie wieder, wie sie es jeden Abend taten.
Schließlich kamen sie zu den Symbolen.
„Weißt du, was das hier bedeutet?“, fragte Jordan und deutete auf einen Kreis in einem zweiten Kreis.
Julia nickte. „Es bedeutet Licht.“
„Richtig. Es ist das Zeichen der Engel.“
Und so ging es weiter, Symbol für Symbol. Und es waren nicht wenige, die es zu lernen galt.
„Die Wahrheit verbirgt sich im Rätsel.“ Das sagte Jordan oft. „Sie ist nie das, was sie vorgibt zu sein. Deshalb müssen wir lernen, sie zu erkennen und zu entziffern. Verlasse dich niemals nur auf deine Augen. Du musst hiermit sehen.“ Er deutete zuerst auf seine Stirn und dann auf sein Herz. „Wenn du das tust, wirst du die Wahrheit erkennen. Du wirst sie sehen.“ Er beugte sich etwas vor und sah Julia tief in die Augen. „Das darfst du niemals vergessen, hast du das verstanden?“
Sie nickte langsam.
„Du musst immer genau hinsehen“, fügte Jordan ernst hinzu. „Versprichst du mir das?“
Sie nickte noch einmal, und dann entließ er sie.
Bis zum nächsten Abend.
TEIL 1
1. KAPITEL
Der Mensch ist des Menschen Hölle
20. Dezember 2010
18:25 Uhr
Mainz
Der Winter zeigte dem Land sein bissigstes, unschönstes, strengstes Gesicht. Die eisige Kälte ging den Menschen durch Mark und Bein und führte dazu, dass die Ladenbesitzer eine Stunde früher als üblich schlossen und in den Kneipen dreimal so viel Glühwein und Feuerzangenbowle serviert wurde wie an normalen Dezembertagen.
Ein Nachrichtensprecher im Radio hatte es vor wenigen Minuten ein „Weltuntergangsszenario“ genannt.
„Diese Schneemassen werden uns auch noch die nächsten Tage zu schaffen machen, es werden weitere zwanzig Zentimeter Neuschnee erwartet, was keine guten Nachrichten für diejenigen sind, die irgendwie nach Hause kommen müssen, um die Weihnachtsfeiertage im Kreise ihrer Lieben zu verbringen.“
Und damit hatte er recht. Der Wind war längst zu einem erbarmungslosen, unberechenbaren Sturm geworden und die Temperatur bis unter den Gefrierpunkt gesunken. Der Schnee lag mehrere Zentimeter hoch und hing gleichzeitig wie ein weißer Spitzenvorhang in der Luft. Eine weiße Masse, wie ein gähnender Schlund, der alles verschlang.
Im Zimmer der billigen Pension war das Licht gedämpft. Während Julia aus dem Fenster sah, hätte sie nie geahnt, wohin diese Geschichte sie in den nächsten Tagen noch führen würde. Niemals. Nicht in ihren kühnsten Träumen.
Eva, die erschöpft auf der zerschlissenen Couch saß und deren rote Locken noch unbändiger als sonst in alle Himmelsrichtungen von ihrem Kopf abstanden, fragte: „Warum mussten wir eigentlich ausgerechnet einen derartigen Schrotthaufen von Auto klauen? Die Sprungfedern im Sitz haben Löcher in meinen Hintern gebohrt wie in einen Schweizer Käse. Ich weiß noch nicht einmal, was das für eine Marke ist, mit der du uns da durch die Gegend geschaukelt hast.“
„Es ist ein Saab“, gab Julia zurück, ohne den Blick vom Fenster zu nehmen. „Und wir sind damit immerhin vom Schwarzwald bis hierher gekommen.“
„Ja, aber in was für einem Zustand.“
„Es gab nun mal auf die Schnelle keine andere Lösung.“
„Nein?“ Eva verzog das Gesicht. „Wir hätten auch einfach dort bleiben können, wo wir waren.“
„Und darauf warten, dass wir verhaftet werden?“ Julia schüttelte den Kopf. „Das wäre keine gute Idee gewesen.“
„Früher oder später kommen sie uns sowieso auf die Spur.“
„Ja. Aber nicht, solange das Wetter so schlecht ist.“
Sie schwiegen einen Moment. Irgendwo im Haus rauschte Wasser durch eine Leitung.
Dann sagte Eva: „Und du bist dir sicher, dass das hier funktionieren wird?“
„Nein.“ Jetzt wandte Julia sich zu ihr um. „Und deshalb solltest du eigentlich auch gar nicht hier sein. Du solltest längst irgendwo anders sein. Es ist viel zu gefährlich. Ich dachte, ich hätte es dir erklärt, aber anscheinend habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt.“
„Du hast dich deutlich genug ausgedrückt. Aber das hier kannst du alleine nicht schaffen, und das weißt du auch. Du brauchst meine Hilfe.“
„Tot bist du mir aber keine Hilfe.“
„Das gilt auch umgekehrt.“ Eva hob die Hände in die Höhe. „Wie, glaubst du, würde es mir gefallen, wenn ich dich alleine lasse und dann irgendwann erfahre, dass du tot bist? Ich sag es dir: gar nicht. Also werde ich an deiner Seite bleiben und mich nicht mehr wegbewegen. Gewöhn dich besser an die Vorstellung.“
Julia seufzte leise, durchquerte den Raum mit ein paar Schritten und setzte sich neben sie auf die Couch. „Du erstaunst mich.“
„Warum?“
„Weil du eigentlich völlig durch den Wind sein müsstest. Erledigt. Fertig mit den Nerven. Am Ende.“
Eva nickte langsam. „Ja, das müsste ich wohl. Immerhin habe ich vor noch nicht einmal achtundvierzig Stunden einen Mann erschossen – und zwar ohne das geringste Zögern.“ Sie hielt kurz inne, bevor sie fortfuhr: „Und eigentlich ist mir auch ununterbrochen danach, zu weinen, aber ich kann nicht. Es tut mir nicht einmal leid. Es kommt mir selbst merkwürdig vor, dass ich keine Reue empfinde, aber ich tue es nicht. Es ist, als wären all meine Gefühle taub geworden. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefallen soll, aber es ist nun mal so.“
„Du stehst immer noch unter Schock“, sagte Julia.
„Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch etwas anderes.“ Eva wandte ihr den Blick zu. „Ich sage mir die ganze Zeit, dass ich schlichte Gerechtigkeit geübt habe. Ich meine, es steht doch sogar in der Bibel, oder nicht? Auge um Auge, Zahn um Zahn.“
„Du weißt, dass damit etwas anderes gemeint ist.“
„Das ist alles Auslegungssache.“
Ja, vermutlich war es das.
„Cirpka war ein Mörder“, sprach Eva weiter. „Ein durch und durch schlechter Mensch, und ich habe meine Zweifel daran, dass er für seine Taten vor einem ordentlichen Gericht bestraft worden wäre.“
Julia nickte langsam und schloss für einen kurzen Moment die Augen. Noch einmal hörte sie den Schuss, sah Cirpka auf dem Boden liegen. Und sie hörte seine letzten Worte: „Finde Sten Kjaer.“
„Glaubst du, er ist in der Hölle?“, durchbrach Evas Stimme ihre Gedanken.
Julia öffnete die Augen wieder. „Cirpka?“
„Ja. Glaubst du, er ist in der Hölle?“
„Es gibt keinen Ort, der Hölle heißt.“
„Bist du dir da sicher?“
„Ganz sicher. Wenn es eine Hölle gibt, dann ist es der Mensch. Der Mensch ist des Menschen Hölle.“
Darüber dachte Eva einen Moment lang nach. Dann sagte sie: „Wahr ist, dass das, was in den letzten Tagen, Wochen und Monaten passiert ist, teuflisch war, und wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass am Ende das Gute gewinnt, würde ich vermutlich zusammenbrechen.“
„Ich auch“, gab Julia zu.
Sie schwiegen wieder einen Moment.
Dann fragte Eva: „Glaubst du denn, dass Zander noch lebt?“
Die Frage erwischte Julia nicht kalt. Sie dachte seit Stunden über nichts anderes nach. „Solange ich seine Leiche nicht real und echt vor mir gesehen habe“, antwortete sie, „ist er für mich immer noch am Leben.“ Sie erhob sich von der Couch. „Und deshalb sollten wir jetzt auch keine Zeit mehr verlieren. Denn egal, wo er gerade steckt, ich werde ihn dort nicht lassen.“
„Und wo fangen wir mit der Suche an?“
„Bei seinem letzten Fall.“ Julia griff nach ihrer Jacke. „Das ist unser erster Ansatzpunkt.“
Als Zander zu sich kam, blendete ihn helles Licht. Es fühlte sich an, als ob ein gleißender Scheinwerfer mitten auf sein Gesicht gerichtet war. Er versuchte, den Kopf zu drehen, aber es gelang ihm nicht. Sein Kopf, sein ganzer Körper, schien mit nichts gefüllt zu sein als mit Schwere. Er schaffte es nicht einmal, seine Hand zu heben.
Immerhin, es war ihm noch möglich, zu blinzeln.
Und zu denken.
Was zum Teufel hatten sie ihm gegeben? Was hatten sie ihm in die Venen gejagt?
Er stellte fest, dass er auf einer Matratze lag. Er war nicht gefesselt. Wozu auch? Er konnte sich ja nicht rühren. Noch einmal versuchte er, die rechte Hand anzuheben, und endlich gelang es ihm. Jedoch nicht sehr lange. Sie war einfach zu schwer.
Der Raum, in dem er sich befand, war kalt, und sein Atem zeichnete Spuren in der feuchten Luft.
Mühsam wandte Zander den Kopf, konzentrierte sich, sah sich um. Aber es gab nicht viel zu sehen. Bis auf die Matratze, auf der er lag, war der Raum vollkommen leer.
Er fühlte sich sterbenselend. Er hätte nicht sagen können, wie lange sein Magen schon keine Nahrung mehr bekommen hatte. Viel schlimmer aber war, dass er die Hoffnung, dass Hilfe käme, auf gerade mal ein Prozent einschätzte. Fröstelnd starrte er an die Decke. Dann hörte er Schritte vor der Tür. Und Stimmen. Er wollte lauschen, was gesagt wurde, merkte aber, wie ihm der Kopf schon wieder schwer zur Seite sank.
Erst als er von irgendwoher einen leichten Zug verspürte, wurde ihm klar, dass er einen kurzen Moment lang eingeschlafen sein musste. Inzwischen hatte jemand die Tür geöffnet. Eine Gestalt stand vor seiner Pritsche und blickte auf ihn hinab. Zu gerne hätte Zander gesehen, wie die Gestalt aussah, aber sein Blick war zu verschwommen.
„Nicken Sie, wenn Sie mich verstehen können“, hörte er eine Stimme.
Er nickte schwerfällig.
„Wenn wir Sie hätten umbringen wollen, dann wären Sie schon tot. Das wissen Sie, nicht wahr?“
Erneut nickte Zander. Es kostete ihn unglaublich viel Kraft.
„Wir haben allerdings etwas anderes …“
Die verschwommene Gestalt redete weiter, aber die Wörter verschmolzen miteinander, und als sie Zanders Ohren erreichten, hatten sie ihre Bedeutung bereits verloren.
Dann registrierte er, dass er wieder alleine war. Die Gestalt war gegangen. Wann? Er hatte es nicht mitgekriegt.
Er war wieder alleine. Und jetzt, zum ersten Mal in seinem Leben, empfand Zander tiefe Angst. Ein Prozent Hoffnung. Und dieses eine Prozent hatte einen Namen.
Bitte, Julia, flehte er im Stillen, beeil dich.
19:07 Uhr
„Hallo, Julia“, sagte Nikolas Augustin in der Tür. „Lange nicht mehr gesehen.“ Zwar sah er immer noch gut aus, aber es ging ihm nicht gut, das war ihm deutlich anzusehen. Er wirkte übermüdet, sein kurzes dunkles Haar war zerzaust, sein Hemd zerknittert. Er hatte immer etwas von einem männlichen Unterwäschemodel gehabt, davon war jetzt nicht viel zu sehen. Sein Blick schweifte zu Eva. „Ist das deine Freundin?“
„Ja“, sagte Julia.
Er reichte Eva die Hand. „Nikolas. Julia und ich waren bei der Kripo hier in Mainz in einem Team. Also, Zander, sie und ich.“ Er ließ die Hand wieder los und trat zur Seite. „Kommt rein.“
Sie betraten eine kleine, aber gemütliche Küche und setzten sich an einen Holztisch.
„Du warst im Schwarzwald“, sagte Augustin zu Julia.
Erstaunt sah sie ihn an. „Woher weißt du das?“
„Zander gab mir die Anweisung, dein Handy orten zu lassen.“
„Wirklich? Wann?“
„Vor zwei Tagen.“
„Warum?“
„Weil er sich Sorgen um dich gemacht hat.“ Augustin lehnte sich etwas zurück. „Daher wussten wir, wo du bist. Wir wussten nur nicht, warum du dort warst. Verrätst du es mir?“
Julia schüttelte den Kopf. „Je weniger du weißt, desto besser.“
Einen Moment lang sahen sie einander in die Augen, dann fügte sie hinzu: „Und jetzt sag mir bitte, was hier in Mainz geschehen ist. Zander ist spurlos verschwunden, das weiß ich, mehr aber auch nicht. Was habt ihr inzwischen herausgefunden? Was sagen seine Nachbarn? Hat irgendjemand etwas gesehen?“
„Autos“, antwortete Augustin. „Zwei Personen haben einen roten Wagen in Richtung Autobahn fahren sehen. Eine andere Person sah ein Taxi in dieselbe Richtung fahren. Was allerdings nicht weiter verwunderlich ist, immerhin befindet sich Zanders Wohnung nicht weit von der Autobahnauffahrt entfernt.“
„Sonst nichts?“
„Nein. Alle Proben aus seiner Wohnung sind schon im Labor, und die Handyortung hat leider nichts ergeben. Kein gewaltsames Eindringen in seine Wohnung. Er scheint seinen Entführer ins Haus gelassen zu haben.“
„Oder dieser hat sich geschickt Zutritt verschafft.“
„Oder das.“
Julia schwieg einen Moment, dann sagte sie: „Woran habt ihr zuletzt gearbeitet?“
„Du weißt, dass ich dir darüber keine Auskunft geben darf. Was ich dir bis jetzt gesagt habe, ist schon viel zu viel. Du bist nicht mehr bei der Polizei, Julia, und somit überhaupt nicht befugt. Und ich bin es genauso wenig.“
„Ich werde euch nicht in die Quere kommen, Nikolas, aber du weißt selbst, dass ihr jede Hilfe gebrauchen könnt. Und Ermitteln ist nun mal das, was ich am besten kann.“
„Wir können auch ermitteln, denn das ist unser Job.“
„Entschuldigung, könnte ich vielleicht eine Tasse Tee haben?“, schaltete Eva sich ein.
„Natürlich. Tut mir leid.“ Augustin stand auf und goss heißes Wasser in eine Tasse. „Du auch, Julia?“
„Nein, danke.“
Er hängte einen Teebeutel in die Tasse und reichte sie an Eva weiter. Dann setzte er sich wieder an den Tisch und sah Julia an. „Ich kann das wirklich nicht machen.“
„Ich kann es mir doch wenigstens anhören“, sagte sie. „Das kann ja wohl nicht schaden.“
Daraufhin setzte Schweigen ein.
Julia wartete darauf, dass Augustin etwas sagte, und als zu lange nichts von ihm kam, erklärte sie eindringlich: „Wir dürfen jetzt keinen Fehler machen, keiner von uns.“
Er sagte immer noch nichts, und sie wartete wieder ab. Als ob sie vollkommen ruhig wäre, was nicht der Fall war. Sie wusste, dass die Chancen, etwas herauszufinden, was niemand vor ihr entdeckt hatte, gering waren, aber sie wollte es dennoch versuchen.
Schließlich sagte Augustin: „Okay. Was willst du wissen?“
„Alles.“
Noch einmal vergingen Sekunden. Dann erhob er sich, verließ die Küche und kam wenig später mit einem Stapel Papieren zurück. Er legte sie auf den Tisch und schob sie ihr zu. „Das ist der Fall, an dem wir gearbeitet haben, als Zander verschwand.“
Julia griff nach den Papieren und sah sie durch. Es waren Kopien der gesammelten Informationen und Dokumente, bis hin zu den Ergebnissen der Spurensicherung und den Protokollen der Verhöre. „Ich hab es mit nach Hause genommen, weil ich dachte … ja, weil ich dachte, vielleicht finde ich ja doch noch einen Hinweis, den wir bisher übersehen haben.“
„Fass es für mich zusammen“, bat sie.
„Es ging um Entführung und schwere Vergewaltigung sowie Folter von mehreren Frauen.“ Augustin schob ihr ein Foto zu. „Das hier war Nathalia Snietka, sie hat uns auf die Spur gebracht.“
„Warum sagst du ‚war‘? Was ist passiert?“
„Sie hat sich inzwischen umgebracht.“
Julia senkte den Blick auf das Foto. Die junge Frau musste wunderschön gewesen sein. Die hellen, leicht gewellten langen Haare fielen ihr sanft auf die Schultern. Aber sie waren auch blutverklebt. Die Augenfarbe war nicht zu erkennen, weil die Augen blau verfärbt und angeschwollen waren.
„Sie war erst zwanzig Jahre alt“, fuhr Augustin fort. „Ukrainerin. Sie wurde entführt und über mehrere Monate festgehalten. Während der Zeit ist sie mehrfach vergewaltigt und gefoltert worden. In diesem Keller.“ Er schob Julia das nächste Foto hin. Es zeigte einen lichtlosen Raum, kaum größer als ein fensterloser Öltank. An der Eisentür ein Riegel, an der Decke eine nackte Glühbirne, im hinteren Bereich war ein Eisenbett mit einer Matratze zu erkennen. An der Wand über dem Bett hingen Haken, an denen man Fesseln anbringen konnte.
„Vor drei Tagen gelang Nathalia die Flucht“, fügte Augustin hinzu. „Es ist uns gelungen, den Keller ausfindig zu machen, aber leider haben wir dort nichts gefunden. Keine Spuren, gar nichts.“
„Also ist er gründlich gereinigt worden, bevor ihr kamt“, stellte Julia fest.
„Ja. Aber wir wissen dennoch, dass in diesem Keller insgesamt fünf Frauen festgehalten wurden.“
„Fünf?“, entfuhr es Eva, die sich bisher zurückgehalten hatte.
Augustin nickte. „Wir fanden fünf Verschläge, und Nathalia sagte aus, dass dort noch weitere Frauen festgehalten worden sind. Sie konnte sie nicht sehen, aber hören.“ Er lehnte sich etwas zurück. „Wir nehmen an, dass sie alle über das Internet nach Deutschland gelockt wurden. Immer mit derselben Masche. Eine Datingseite hat heiratswillige osteuropäische Frauen mit allen möglichen Versprechen geködert. Kaum waren sie dann hier gelandet, wurden sie entführt und in dem Keller als Sexsklavinnen gehalten, deren Dienste an fremde Männer verkauft wurden.“
„Ein Netzwerk?“, fragte Julia.
„Wir gehen davon aus.“
„Was soll das heißen?“, fragte Eva dazwischen. „Dass es noch mehr solcher Keller gibt?“
„Ja“, antwortete Augustin in ihre Richtung.
„Das heißt, es gibt einen Markt für … so etwas?“
„Es gibt genügend Männer, die dafür bezahlen, ja.“
„Mein Gott.“ Eva wurde ganz bleich. „Wie pervers ist das denn?“
„Wie pervers das Ganze wirklich ist, könnt ihr euch noch gar nicht vorstellen.“ Augustin schüttelte den Kopf. „Zander gelangte während der Ermittlungen an einen Film aus dem Internet, auf dem die ganze Perversität in vollem Umfang zu sehen ist. Aber ich würde euch nicht empfehlen, ihn euch anzusehen. Das ist mehr als kranke Scheiße.“
„Ich will ihn sehen“, sagte Julia und sah zu Eva. „Du kannst so lange rausgehen, wenn du möchtest.“
Eva schüttelte den Kopf. „Ich bleibe hier.“
„Wirklich, denkt noch einmal darüber nach“, warnte Augustin.
„Ich will ihn sehen“, beharrte Julia.
„Ich auch“, sagte Eva, wenn auch weit weniger überzeugt.
Augustin seufzte leise auf und holte seinen Laptop. Er schob eine DVD hinein und drückte auf Start.
Und bereits zwei Sekunden später wurde die Küche, in der sie saßen, winzig und luftlos.
Auf dem Bildschirm war eine nackte Frau auf einem schmalen Eisenbett zu sehen. Sie lag auf dem Rücken, ihre Hände waren mit Lederriemen an das Kopfteil gefesselt. Ihr Gesicht war nass vor Tränen, und ihr Mund stand weit offen. Man hörte keinen Schrei, denn die Aufnahme war ohne Ton, aber man sah, wie ihr Körper zuckte und wie sie versuchte, sich loszureißen. Ihre Halsmuskeln waren angespannt, jeder einzelne Knochen trat hervor.
Ein Mann trat ins Bild. Er trug nur ein dunkles T-Shirt, keine Hose. Er vergewaltigte sie, wobei er die Hände um ihren Hals legte.
Dann kam noch ein Mann. Und noch einer.
„Oh mein Gott!“, entfuhr es Eva, die jetzt überhaupt keine Farbe mehr im Gesicht zu haben schien. „Die haben eine Vergewaltigung gefilmt und ins Netz gestellt?“
Augustin nickte. „Es scheint ebenso unglaublich wie alles andere, aber auch hier gibt es Männer, die für einen solchen Film sehr viel Geld bezahlen.“
Julia deutete auf den Bildschirm. „Seid ihr an diesen Männern dran?“, wollte sie wissen.
„Ja, aber es gestaltet sich schwierig, weil die natürlich alle nicht ihre richtigen Namen hinterlassen, wenn sie sich im Netz bewegen. Aber wir arbeiten mit sehr guten IT-Experten zusammen. Wir kriegen sie – früher oder später.“
„Ich muss an die Luft“, sagte Eva und verließ den Raum.
Julia sah ihr kurz hinterher, dann deutete sie noch einmal auf den Bildschirm. „Ist das Nathalia?“
Augustin nickte.
„Du hast gesagt, ihr sei die Flucht aus diesem Keller gelungen …“
„Richtig. Ein Autofahrer fand sie völlig am Ende am Straßenrand. Er brachte sie sofort in ein Krankenhaus.“
„Dann ist sie dort doch untersucht worden. Habt ihr nichts gefunden? Keine Spuren? DNA? Kein Sperma am Körper?“
„Nein.“ Augustin deutete ebenfalls auf den Bildschirm. „Wie du siehst, tragen die Männer Kondome. Die sind nicht blöd.“
Julia atmete tief durch und lehnte sich zurück. „Wie ist Zander an den Film gekommen?“
„Das kann ich dir leider nicht sagen. Er hat kein Wort darüber verloren, wo er ihn herhatte.“ Augustin stoppte den Film, und der Bildschirm wurde schwarz.
„Wie seid ihr dann weiter vorgegangen?“, wollte Julia wissen.
„Nun ja, keine zwölf Stunden nach Nathalias Flucht fanden wir eine männliche Leiche. Der Name des Mannes war Matthias Bartholomäus, und uns war ziemlich schnell klar, dass er einer ihrer Entführer war.“
„Wie kamt ihr darauf?“
„Der Keller in seinem Haus.“ Augustin deutete noch einmal auf das Foto, das den Keller zeigte. „Das war dieser. Hier wurde Nathalia festgehalten.“
Julia dachte einen Moment nach. „Das heißt, er wurde umgebracht, nachdem ihr die Flucht gelungen war.“
„Ja. Offenbar rechnete man damit, dass wir früher oder später dort auftauchen und ihn zum Sprechen bringen würden. Also hat man ihn vorher umgebracht. Und er blieb nicht unsere einzige Leiche. Kurz darauf fanden wir einen weiteren Ermordeten. Sein Name war Lars Dexter. Wir nehmen an, dass er der zweite Entführer war. Beiden Männern wurde das Genick gebrochen. Sehr schnell. Sehr professionell. Sehr außergewöhnlich. Es gibt nicht viele Menschen, die auf diese Art und Weise töten, es musste sich also um ein und denselben Täter handeln.“
„Und habt ihr auch einen Verdächtigen?“
„Ja.“
Julia sah auf. „Wen?“
Augustin schob ein Phantombild zu ihr hin. „Sein Name ist Sten Kjaer.“
In dem Moment, in dem er den Namen aussprach, spürte Julia, wie alles aus ihr entwich. Wirklich alles. Die Luft. Der Gleichgewichtssinn. Alles.
Die Welt blieb für einen kurzen Moment stehen. Ein erstarrtes Bild, in dem sich nichts mehr bewegte.
Finde Sten Kjaer. Eric Cirpkas letzte Worte im Schwarzwald.
Eva kam in die Küche zurück und setzte sich wieder zu ihnen an den Tisch. „Wer ist das?“, wollte sie wissen und deutete auf das Phantombild.
Julias Blick ruhte auf dem kalkweißen Gesicht, den irgendwie durchsichtigen Augen. „Das ist Sten Kjaer“, sagte sie.
„Wirklich? Das ist Kjaer?“ Eva sah etwas genauer hin. „Warum sieht er so merkwürdig aus, so … farblos?“
„Er ist ein Albino“, sagte Augustin.
„Dann sollte man doch meinen, dass es ein Leichtes wäre, ihn zu finden, oder nicht?“, wandte Eva sich an ihn.
„Ja, sollte man. Aber so einfach ist es leider nicht.“ Augustin atmete tief durch. „Wir gehen davon aus, dass der Mann ein Berufskiller ist. Er hat gute Kontakte, bei denen er unterschlüpfen kann. Und er ist nie lange an einem Ort.“
In Julias Kopf drehte sich immer noch alles. Sie riss sich zusammen und hob den Blick. „Sten Kjaer. Der Name klingt skandinavisch, oder?“
„Er ist Norweger. Bevor Zander verschwand, hat er sich mit einem Kommissar in Bergen in Verbindung gesetzt. Der Mann ist inzwischen in Rente, hat sich allerdings in den letzten Jahren sehr intensiv mit Kjaer beschäftigt. Er erzählte, dass der Mann auf der schwarzen Liste der norwegischen Polizei steht, also sozusagen zu deren most wantedpeople gehört. Die sind dort seit geschlagenen fünfzehn Jahren hinter ihm her, da ist er zum ersten Mal bei ihnen auf dem Radar aufgetaucht. Im Laufe dieser Zeit ist es ihm gelungen, vier Polizisten zu liquidieren. Das heißt, für die ist Kjaer längst zu einer persönlichen Angelegenheit geworden. Es wurde sogar eine Sondereinheit gegründet. Die haben sieben Tage die Woche rund um die Uhr damit verbracht, den Mann zu kriegen. Und es trotzdem nicht geschafft.“
„Und jetzt ist er in Deutschland“, sagte Julia.
„So sieht es aus, ja. Die Art der Morde würde auf jeden Fall zu ihm passen. Genickbruch. Es ist anzunehmen, dass er auch anders tötet, aber diese Art scheint er besonders gut zu beherrschen.“
Julia wollte etwas sagen, doch Augustin war noch nicht am Ende. „Allerdings ist Kjaer kein Entführer und auch kein Vergewaltiger, das sollte man nicht durcheinanderbringen. Er ist … einfach nur ein Killer.“
Was immer Julia eben noch hatte sagen wollen, sie sagte es nicht. Stattdessen blickte sie wieder auf das Phantombild. Sie war sich sicher, noch nie einem Menschen wie Sten Kjaer begegnet zu sein. Das waren wohl die wenigsten Menschen. Und die wenigsten von denen, die ihm tatsächlich begegnet waren, hatten es überlebt.
„Okay“, sagte sie nach ein paar Sekunden. „Fassen wir das mal zusammen: Zwei Männer entführen mehrere Frauen und sperren sie in einen Keller, wo sie von fremden Männern, die dafür bezahlen, vergewaltigt und gefoltert werden. Einer der Frauen gelingt die Flucht, und kurz darauf sind die beiden Entführer tot. Umgebracht von einem Mörder, der mit den Entführungen und Vergewaltigungen selbst nichts zu tun hatte. Er ist nur unterwegs zum Töten.“
„Ja.“
„Das heißt, dass er einen Auftrag hatte.“
„Ja.“
„Was wiederum heißt, es gab einen Auftraggeber.“ Julia deutete auf den dunklen Bildschirm. „Es bedarf einer Organisation, um solch ein ekelhaftes Geschäftsmodell ins Leben zu rufen. Leute, die die Fäden ziehen und hinter den Kulissen abkassieren.“
Augustin nickte. „Wir haben es ganz sicher mit einer Organisation zu tun, und ich kann dir sagen, es ist verdammt schwer, an die heranzukommen, weil die in einem System arbeiten, bei dem das Wissen aus tausend Quellen in eine Richtung fließt – und zwar durch ein Nervensystem, das immer dünner wird, je näher es der Spitze kommt. Wer gefährlich wird, der wird ausgelöscht, ganz einfach. So verhindern sie Infektionen, Störungen im System. Anders ist nicht zu erklären, warum wir bisher nichts, aber auch wirklich gar nichts von ihnen gewusst haben.“
„Aber jetzt wisst ihr von ihnen. Und wisst ihr auch, um welche Organisation es sich dabei handelt?“ Julia kannte die Antwort, noch bevor Augustin sie aussprach: „Sie nennen sich offenbar die Kraniche.“
Und so fügten sich die Dinge eins nach dem anderen zusammen. Eric Cirpka, Sten Kjaer, die Kraniche. Ein Puzzle, das Stück für Stück mehr ein Bild ergab und doch immer noch zu viele Lücken enthielt.
Julia atmete tief durch. „Wie seid ihr auf diese Organisation gekommen?“
„Genau genommen war es reiner Zufall“, sagte Augustin. „Während unserer Ermittlungen tauchte ein Mann auf dem Präsidium auf, sein Name war Edi Kern. Er behauptete steif und fest, er hätte Dexter und Bartholomäus umgebracht, und wollte unbedingt verhaftet werden. Zander und unser Kollege Dettloff haben die Vernehmung geführt. Es war allen von vornherein klar, dass Edi Kern kein Mörder war, aber hatte furchtbare Angst. Er war auf der Flucht. Vor den Kranichen. Behauptete er.“
„Gibt es ein Protokoll von dem Verhör?“, wollte Julia wissen.
Augustin nickte, suchte in den Papieren und schob es schließlich zu ihr hin.
Sie rieb sich über die Augen und las …
Edi Kern: „Ich war es. Ich hab die beiden Typen umgebracht. Und jetzt will ich verhaftet werden.“
Zander: „Warum haben Sie Bartholomäus und Dexter umgebracht?“
Edi Kern: „Ich wollte es ja gar nicht. Ich kannte sie ja überhaupt nicht.“
Zander: „Warum haben Sie es dann getan?“
Edi Kern: „Die Stimmen haben es mir befohlen.“
Zander: „Was für Stimmen?“
Edi Kern: „Stimmen eben. In meinem Kopf. Und jetzt will ich, dass Sie mich einsperren. Werden Sie das tun?“
Zander: „Sie mögen ja vielleicht andere Talente haben, Edi, aber es wäre wirklich verrückt, zu glauben, Sie könnten diese beiden Morde begangen haben. Erzählen Sie uns eine andere Geschichte, möglichst eine wahre, oder wir beenden die Vernehmung an dieser Stelle.“
Edi Kern: „Ich war es aber. Ihr habt mein astreines Geständnis, Leute.“
Noch einmal rieb Julia sich über die Augen und las dann weiter …
Edi Kern: „Jetzt passt mal auf! Ich brauch einen Platz, wo ich sicher bin, okay? Die wollen mich nämlich killen! Ich weiß es! Die wollen mich umlegen! Letzte Nacht war einer vor meinem Fenster. Zuerst war’s nur ein Vogel. Der war fürchterlich laut. Auf jeden Fall laut genug, um nicht schlafen zu können. Also bin ich hingegangen und hab überlegt, ob ich was nach dem Vieh werfen soll. Einen Schuh oder so. Bin ganz gut im Werfen, hätt ihn bestimmt getroffen. Ich steh da also am Fenster, den Schuh in der Hand, und da seh ich plötzlich was ganz anderes als den Vogel.“
Zander: „Was haben Sie denn gesehen?“
Edi Kern: „Einen ganz üblen Typen, der in mein Schlafzimmer geguckt hat. Ich sag euch, ich bin so erschrocken, bin direkt ohnmächtig geworden. Mannomann!“
Dettloff: „Warum sollte denn jemand in Ihr Schlafzimmer gucken, Edi? So hübsch sind Sie nun auch wieder nicht.“
Edi Kern: „Wollen Sie mich grad verarschen? Ich sagte doch eben, die wollen mich killen.“
Zander: „Wer?“
Dettloff: „Und warum?“
Edi Kern: „Ich hab versucht, die zu bescheißen, okay? Das sollte man nicht machen. Das verzeihen die einem nämlich nicht.“
Zander: „Wen haben Sie versucht zu betrügen, Edi?“
Edi Kern: „Schon mal was von den Kranichen gehört?“
Zander: „Erzählen Sie davon.“
Edi Kern: „Die sind der schwarze Rauch des Satans. Seelenräuber, jawohl. Die glauben, sie stehen über den anderen Menschen und erst recht über den Gesetzen. Und das Schlimme ist, dass es auch tatsächlich so ist. Niemand weiß, wer die sind, aber alle wissen, dass es sie gibt. Und wenn man sich mit denen anlegt, dann kann man sich auch gleich selbst aufhängen. Und wenn ich jetzt hier wieder rausgeh, dann schweb ich in Lebensgefahr.“
Julia sah auf. „Ihr habt ihn trotzdem wieder gehen lassen?“
„Was hätten wir tun sollen?“ Augustin hob abwehrend die Hände. „Der Mann hatte Angst, okay, aber er war nicht der Mörder von Bartholomäus und auch nicht der von Lars Dexter. Mit welcher Begründung hätten wir ihn verhaften sollen?“
Julia nickte, senkte den Blick und las weiter.
Dettloff: „Was haben Sie mit diesen Menschen zu tun?“
Edi Kern: „Hab ein paar Jobs für einen Kumpel gemacht. Kleine Sachen. Drogen vertickt und so. Wusst ja nicht, dass der Kumpel einer von denen ist.“
Dettloff: „Ein Kranich?“
Edi Kern: „Ja.“
Dettloff: „Sie selbst sind also kein Kranich?“
Edi Kern: „Meine Fresse, nein! Ich hab nur ein paar kleine Sachen für den gemacht und ein bisschen in meine eigene Tasche gewirtschaftet.“
Dettloff: „Sie meinen, Sie haben Ihren Kumpel über den Tisch gezogen.“
Edi Kern: „Jepp. Hätt ich nicht machen sollen. Scheißidee. Jetzt hab ich sie am Hals.“
Zander: „Hat Ihr Kumpel Ihnen erzählt, dass er diesen Kranichen angehört?“
Edi Kern: „Das hat er ganz bestimmt nicht getan.“
Zander: „Woher wissen Sie dann davon?“
Edi Kern: „Mann, ich hab vielleicht keinen Doktortitel, aber ich kann hören, okay? Ich hab Ohren. Das ist ’ne ganz üble Truppe. Die sind das Böse, sag ich euch. Die haben in allem ihre Finger.“
Zander: „Prostitution?“
Edi Kern: „Auch. Aber nicht nur. Die haben eine Menge Knete und ganz schön viel Macht. Aber in Wahrheit haben die ein ganz anderes Ziel.“
Zander: „Was für ein Ziel?“
Edi Kern: „Die wollen das Gute von innen heraus zerstören. Dann können sie nämlich über die ganze Welt herrschen. So ist das. Jawohl.“
Zander: „Wenn es diese Kraniche tatsächlich gibt, warum wissen wir – die Polizei – dann nichts von ihnen?“
Edi Kern: „Weil ihr Tomaten auf den Augen habt, deswegen. Weil ihr nur seht, was ihr sehen wollt. Und weil die ihre Leute auch in eurem Laden haben. So sieht’s aus.“
Augustin sagte: „Man mag kaum unterscheiden, was von dem ganzen Gerede Wahrheit und was erfunden ist.“
Julia sah auf und schüttelte langsam den Kopf. „Diese Kraniche existieren, daran gibt es keinen Zweifel, aber ich gebe dir insofern recht, als dass sie nicht aus der Hölle emporgestiegen sind, wie Edi Kern es glaubt. Es sind Mörder. Killer. Schlechte Menschen – aber es sind Menschen. Allerdings ist es ausgesprochen clever, solch einen Mythos zu streuen.“
Als Augustin fragend eine Augenbraue hob, fügte sie hinzu: „Mit Tod und Teufel und Hölle kann man den Menschen Angst einjagen. Man kann sie einschüchtern und leichter manipulieren. Und das ist genau das, was diese Kraniche tun.“
Augustin seufzte: „Wie auch immer. Das war es. Mehr haben wir nicht. Wir wissen nicht mehr über diese Vögel, als dass es sie gibt. Wir gehen zwar davon aus, dass Sten Kjaer als Killer für sie arbeitet, aber wir haben keine Ahnung, wo er jetzt gerade steckt. Wir wissen und wir haben nichts.“
Julia schwieg einen Moment nachdenklich. „Ihr seid den Kranichen auf die Spur gekommen“, sagte sie dann. „Und Zander war vermutlich näher an ihnen dran als alle anderen. Ich kann es nicht beweisen, aber ich habe das sichere Gefühl, dass er genau deswegen verschwunden ist. Das bedeutet, der Faden muss von hier an weitergesponnen werden.“ Sie hob den Kopf und sah Augustin an. „Danke.“
Plötzlich hatte sie es sehr eilig.
„Was hast du vor?“, fragte er, als sie sich erhob.
„Ich werde versuchen, noch einmal mit diesem Edi Kern zu reden. Hast du eine Adresse?“
„Willst du einfach mal vorbeigehen und ihn ins Kreuzverhör nehmen? Dazu hast du keine Befugnis, Julia. Du bist nicht mehr bei der Polizei.“
„Mag sein, aber mir bleibt keine Zeit für Feinheiten. Ich will ihm auch nur ein paar Fragen stellen, mehr nicht. Oder habt ihr inzwischen noch einmal mit Edi Kern gesprochen?“
„Nein.“
„Das dachte ich mir. Und warum nicht?“
„Wir hielten es für … nicht wichtig genug.“
„Siehst du, und weil ich das anders sehe, übernehme ich das jetzt.“
Augustins Blick war ebenso ernst wie Julias. „Ich halte das für keine gute Idee.“
„Das musst du auch nicht. Du musst mir nur vertrauen und mit niemandem darüber sprechen, dass wir uns heute Abend getroffen haben. Mit niemandem. Ich war nicht hier. Okay?“
Er fixierte sie weiter. „Natürlich. Wie kann ich dich erreichen?“
Julia kritzelte ihre Handynummer auf einen Zettel. „Und die darf auch niemandem sonst unter die Augen kommen, ja?“
„Ja.“
„Edi Kerns Adresse?“
„Sie ist hier irgendwo.“ Augustin machte sich daran, in den Papieren zu suchen. Dann griff er ebenfalls nach einem Zettel, notierte die Adresse darauf und reichte ihn Julia. „Du hältst mich auf dem Laufenden, okay?“
„Ja.“
„Wirklich.“
Julia seufzte leise. „Du musst mir vertrauen, Nikolas.“
Kurz darauf hatten sie das Haus verlassen.
2. KAPITEL
So empfängst du mich …
Hannover
Ungefähr zur selben Zeit kam Susanne Grimm mit zwei Stunden Verspätung wieder in Deutschland an – ebenfalls vollkommen ahnungslos, wohin diese Geschichte sie noch führen würde.
Sie fand eine schneegepeitschte Stadt vor, die völlig konturenlos schien. Die Menschen in der Flughafenhalle drückten und schoben und stießen mit ihren Koffern um sich. Aus den Lautsprechern erklang Jingle Bells. Bunte Lichter, die überall von den Decken hingen, kündigten Weihnachten an, das Fest der Liebe.
Nach fünf Monaten in der Einsamkeit Norwegens war die überwältigende Menschenfülle ein Angriff auf jeden einzelnen von Susannes Sinnen. Sie war überhaupt nicht mehr an die beklemmende Dichte von Geräuschen, Gerüchen und Gesichtern gewöhnt, und einen Moment lang wünschte sie sich zurück und dachte an das letzte Telefonat mit Jo und Edda, kurz vor ihrem Abflug nach Deutschland.
„Du brauchst mich wirklich nicht alle zehn Minuten anzurufen, Jo“, hatte sie gesagt. „Du hast doch bestimmt Wichtigeres zu tun.“
Aber Jo hatte nichts Wichtigeres zu tun. „Hast du dir das auch wirklich gut überlegt?“, fragte er sie noch einmal.
„Wir haben jetzt wirklich oft genug darüber gesprochen.“
„Hast du auch genügend Geld?“
„Du warst doch dabei, als die fünfzigtausend Euro vom Konto meines Vaters auf mein Konto gebucht wurden.“
„Illegal.“
„Ich konnte ihn leider nicht fragen.“
„Und er kann es ja nun wirklich verkraften“, erklang Eddas Stimme aus dem Hintergrund.
„Jo“, sagte Susanne, „du machst dir zu viele Gedanken. Wirklich. Warum setzt du dich nicht auf die Couch, legst die Beine hoch und entspannst dich ein bisschen?“
„Du wirst mich nicht dazu zwingen können, mich zu entspannen, solange ich nicht weiß, wohin das führt, was du da vorhast.“
„Ich danke dir für alles, was du in den letzten Tagen für mich getan hast. Danke auch dir, Edda. Ihr seid zu meinen zwei besten Freunden geworden.“
„In Zeiten der Freude wie der Not, so sagt man doch, nicht wahr?“ Das war wieder Eddas Stimme aus dem Hintergrund.
„Ja“, sagte Susanne. „In der Freude wie in der Not.“
Dann hatten sie sich verabschiedet. Sie war in den Flieger gestiegen, und nun war sie hier. Und erst jetzt bemerkte sie, wie nervös sie tatsächlich war. Tief atmete sie durch, zwang sich zur Ruhe.
Niemand starrt mich an.Niemand erkennt mich.
Aber konnte sie da wirklich sicher sein?
Unauffällig suchte Susanne mit den Augen die Ankunftshalle ab.
Mit allem hätte sie gerechnet, aber nicht damit, von einer derartigen Angst übermannt zu werden. Nicht damit, derart zu schwitzen. Denn eigentlich kannte sie sich inzwischen mit Angst aus. Schließlich lebte sie seit Monaten permanent mit der Angst, und da sie auf der Flucht vor der Polizei war, war das wohl auch kein Wunder. Ihr Foto hing vermutlich in allen Polizeistationen der Stadt. Vielleicht sogar im ganzen Land. Und ganz bestimmt auch hier.
Susanne zwang sich, nicht weiter darüber nachzudenken, doch merkwürdigerweise schien es so, als sei die Fähigkeit, an nichts zu denken, in diesem Moment ganz besonders schwierig zu meistern. Während sie sich in Richtung Ausgang bewegte, überschlugen sich die Gedanken förmlich in ihrem Kopf. Sie hatte in ihrem Leben einige Bücher gelesen, in denen die Hauptfigur ständig auf der Flucht war. Der Flüchtige war seinen Verfolgern immer einen Schritt und einen Gedanken voraus, und für sie als Leserin war das stets recht unterhaltsam gewesen. Inzwischen konnte sie aus Erfahrung sagen, dass es in Wahrheit alles andere als lustig war. Sie steckte ihre Hand in die Manteltasche und überzeugte sich davon, dass ihre neuen Papiere noch da waren. Claudia Müller, das war der Name, den Edda für sie ausgesucht hatte. Hervorragend gefälschte Papiere. Dazu die neue Frisur, ein Pagenkopf, die neue hellbraune Haarfarbe, hellrotes Rouge und Kleidung, die so teuer und elegant war, dass sie sie vor ein paar Monaten nicht einmal angesehen hätte. Nein, kein Mensch von früher hätte Susanne, die Punkerin, sofort wiedererkannt.
Großartige Edda, dachte Susanne, wunderbare, großartige Edda. Dann sah sie auf und … erstarrte.
Ein paar Meter von ihr entfernt stand ein Polizeibeamter, der sie aufmerksam musterte. Zu aufmerksam.
Vermutlich hatte sie sich zu schnell in Richtung Ausgang bewegt, vielleicht auch zu hektisch. Auf jeden Fall hatte sie seine Aufmerksamkeit erregt, und jetzt sahen sie sich direkt in die Augen.
Alles Blut sackte aus Susannes Kopf in die Füße. Sie zwang sich, ganz langsam weiterzugehen, während sie überlegte, was sie jetzt tun sollte. In die Toilette verschwinden? Sich in Bewegung setzen und rennen? Vermutlich keine gute Idee. Man würde sie zur Strecke bringen, noch ehe sie den Ausgang erreicht hatte.
Also ganz langsam weitergehen.
Der Beamte wandte sich jetzt mit dem ganzen Oberkörper in ihre Richtung, und sein Blick bohrte sich regelrecht in sie hinein.
Susanne grüßte ihn freundlich, aber er grüßte nicht zurück. Doch dann wandte er den Blick ab, und sie atmete erleichtert durch.
Jetzt hatte sie es fast geschafft.
Nur noch etwa zehn Meter.
Obwohl ihre Reisetasche so klein und leicht war, grub sich der Riemen tief in Susannes Schulter. Sie hatte nur wenig eingepackt, denn falls sie etwas benötigte, konnte sie es hier in Deutschland nachkaufen. Über der anderen Schulter baumelte lediglich ihre Handtasche.
Noch fünf Meter.
Gleich war sie draußen. Susanne war so sehr in Gedanken, dass sie den Mann, der seitlich auf sie zukam, gar nicht wahrnahm. Bis zu dem Moment, in dem sie mit ihm zusammenstieß.
Hatte sie ihn angerempelt oder er sie? Sie hätte es hinterher nicht mehr sagen können. Auf jeden Fall stolperten sie gegeneinander, und er sagte aufgeregt: „Entschuldigung, tut mir leid. Habe ich Ihnen wehgetan? Ist alles in Ordnung?“
Susanne wollte antworten, doch alles, was sie zustande brachte, war, ihn erschrocken anzustarren.
„Hallo?“, sagte er.
„Nein.“ Sie riss sich zusammen. „Es ist … alles in Ordnung.“
„Tut mir wirklich leid.“ Der Mann ging um sie herum und war kurz darauf mit seinem Rollkoffer in der Menge verschwunden.
Susanne sah ihm einen Augenblick hinterher, dann wandte sie sich wieder in Richtung automatische Tür.
Ein Schritt.
Noch ein Schritt.
Die Tür glitt vor ihr auf, und Dunkelheit kam dahinter zum Vorschein.
Jetzt wusste sie, dass sie es geschafft hatte.
Erleichtert trat Susanne hinaus und sog die eisige Luft ein. Dann sah sie sich um und blinzelte. Hannover, meine Stadt, so begrüßt du mich also, dachte sie. Mit Schnee und Kälte. Und als würde die Stadt ihr antworten, fegte ein steifer Wind ihr Schnee ins Gesicht, der sich anfühlte wie eine Mischung aus Eis und Sand. Schaudernd zog sie die Schultern hoch, drückte den Kragen ihres Mantels enger an den Hals und ließ den Blick erneut über das Areal streifen. Ein paar Taxifahrer saßen in ihren Wagen und ließen die Motoren laufen, um die Heizung anzutreiben.
Einen Fuß vorsichtig vor den anderen setzend, um nicht mit ihren teuren und wenig bequemen Schuhen auf dem Schnee auszurutschen, bewegte Susanne sich auf einen davon zu – und wäre dabei fast in ein Auto gelaufen. Eine Hupe dröhnte, und sie hob entschuldigend eine Hand.
Erst als sie im Fond einer der Taxen saß, spürte sie, wie sich etwas in ihr entspannte. Sie nannte dem Fahrer, einem alternden Hippie, die Adresse, zu der sie wollte. Er nickte, gab Gas, und der Wagen machte einen so schnellen Satz nach vorne, dass Susanne tief in den Sitz gedrückt wurde. „Meine Güte!“, entfuhr es ihr.
„Tut mir leid“, sagte der Hippie und konzentrierte sich auf die Straße. Die Heizung lief auf Hochtouren, es war brütend heiß im Wagen. „So ein Wetter hab ich schon lange nicht mehr erlebt“, sagte er. „Eigentlich habe ich so ein Wetter überhaupt noch nie erlebt. Das wirkt irgendwie bedrohlich, finden Sie nicht auch? Also, wer spätestens jetzt keinen warmen Unterschlupf hat, der krepiert, das steht fest.“
Susanne antwortete nicht darauf. Während sie aus dem Seitenfenster blickte, hatte sie das Gefühl, dass das Taxi nicht vorwärts, sondern rückwärts fuhr. Zurück in die Vergangenheit. Sie sah Restaurants und Fastfoodläden, hässliche Bürobauten inmitten riesiger Parkplätze. Tankstellen. Ein Einkaufszentrum. Noch ein Einkaufszentrum. Da bin ich wieder, dachte sie.
Zwanzig Minuten später verlangsamte der Hippie mit einem leichten Schlingern und brachte den Wagen schließlich zum Stehen. „Da sind wir.“ Schweißperlen standen ihm auf der Stirn, die Fahrt hatte höchste Konzentration von ihm gefordert.
Es schneite so sehr, dass Susanne keine Ahnung hatte, ob dies tatsächlich ihr gewünschtes Ziel war. Sie nahm es aber einfach mal an und bezahlte. Nachdem sie ausgestiegen war, stand sie im gelblichen Licht einer Straßenlampe inmitten von unzähligen Schneeflocken und hörte, wie ein Fremder mit lauter Stimme ein anderes Ziel nannte und in das Taxi einstieg. Gleich darauf war es im Schneegestöber verschwunden.
Willkommen daheim, dachte Susanne. Sie wandte sich um, und was sie dann sah, wirkte wie eine Vision aus einem amerikanischen Weihnachtsspielfilm. Das Hotel war ein weitläufiger Bau, dessen Mauern irgendwie von innen heraus zu leuchten schienen. Es war sehr elegant, manche Menschen hätten es dekadent genannt, sie selbst hätte das vor ein paar Monaten auch noch getan. Am Haupteingang waren zwei uniformierte Pagen damit beschäftigt, die wenigen Autos der Gäste zu parken und die zu empfangen, die mit einem Taxi kamen.
Unwillkürlich fiel Susanne ein Satz ein, den ihr Vater irgendwann einmal zu ihr gesagt hatte: „Die Menschen brauchen Klassensysteme.“ Und als sie hatte wissen wollen, warum, hatte er geantwortet: „Weil das Klassensystem den Menschen ein Ziel gibt. Einen Antrieb, der über Essen und Schlafen hinausgeht. Etwas, das sie dazu bringt, gewisse Leistungen zu vollbringen. Verstehst du das?“
Nein, Susanne hatte es nicht verstanden. Vielleicht hatte sie es auch nicht verstehen wollen. „Wenn ich einen dicken Mercedes fahre“, hatte sie geantwortet, „heißt das noch lange nicht, dass ich besser bin als jemand, der mit dem Fahrrad fährt.“
„Das mag sein“, hatte ihr Vater geantwortet. „Aber ein Mercedes ist ein wichtiges Symbol der Leistung, der Position. Ein Fahrrad ist das nicht.“
„Ein teures Auto, eine Villa, eine hübsche Frau, das sind die Symbole, nach denen du schon immer gestrebt hast, Vater, ich weiß. Aber ich werde das nie tun.“ Davon war Susanne absolut überzeugt gewesen.
„Doch, das wirst du.“ Ihr Vater klang nicht weniger überzeugt. „Und ich sage dir auch, warum: weil niemand gerne ein Verlierer ist. Weil niemand gerne mit Verlierern arbeitet und weil sich niemand gerne mit Verlierern umgibt.“
„Es mag sein, dass ich in deinen Augen ein Verlierer bin, Vater, aber ich wette, ich bin jeden einzelnen Tag glücklicher als du.“
Blinzelnd kam Susanne in die Gegenwart zurück. Alles in ihr sträubte sich dagegen, das Hotel zu betreten. Sie wollte sich nicht zu einem Klon ihres Vaters machen, aber sie wusste auch, dass man sie hier am allerwenigsten suchen würde.
„Hohoho!“
Sie fuhr herum und sah den Weihnachtsmann, der an ihr vorbeiging. Ein bärtiger Hüne mit einem Jutesack über der Schulter, der verdächtig nach Schnaps roch. Der Hüne, nicht der Sack.
„Frohe Weihnachten.“
„Frohe Weihnachten“, gab Susanne zurück.
„Die schönste Zeit des Jahres.“ Der Weihnachtsmann lächelte unter dem weißen Bart. „Das Fest der Liebe.“
„Wenn Sie das sagen.“ Sie sah ihm einen kurzen Moment lang hinterher, beobachtete, wie er durch die dichten Schneeflocken davonstapfte. Dann wandte sie sich wieder dem Hotel zu, gab sich einen Ruck, trat durch die verspiegelte Glastür und buchte wenig später am Empfang ein Zimmer.
Ihr Gepäck brachte sie selbst hinauf. Sie hatte ohnehin nicht vor, lange zu bleiben. Sie hatte heute Abend noch etwas vor.
Vorher jedoch schrieb sie noch eine kurze SMS an ihren Bruder: Hallo Jörg, bin wieder da. Treffen uns morgen früh. Komm vorbei. Dazu schickte sie ihm die Adresse des Hotels, ehe sie sich noch einmal auf den Weg machte.
3. KAPITEL
Ein merkwürdiges Paar
20:37 Uhr
Mainz
Die mächtige Betonburg, vor der Julia und Eva standen, war zwölf oder noch mehr Stockwerke hoch.
Julia begutachtete die zahlreichen Klingelschilder, die den schmutzigen, abblätternden Beton an der Eingangstür überwucherten. „108“, las sie auf einem davon und drückte auf den Knopf.
Als daraufhin nichts geschah, drückte sie nacheinander auf alle Knöpfe. Eine Frauenstimme meldete sich und sagte: „Ja?“
„Polizei“, sagte Julia.
Einen Moment lang geschah gar nichts, dann ertönte ein lautes Summen, sie drückte die Tür auf, und sie traten ein.
„Der sieht nicht sehr vertrauenswürdig aus“, bemerkte Eva und deutete auf den Fahrstuhl.
„Möchtest du bis in den sechsten Stock laufen?“, fragte Julia.
„Nein.“
Sie traten hinein und stellten fest, dass die Spiegel aus ihren Fassungen herausgebrochen waren. Die Metallverkleidung der Fahrstuhlkabine war mit leuchtend roter Schrift besprüht. Die Sprache war nicht zu identifizieren. Auf dem Fußboden allerdings stand deutlich zu lesen: Beate bläst dir einen.Wähle 0157 – 8894 … Die Nummer endete an der sich schließenden Tür, die restlichen Ziffern fand man offenbar auf einem anderen Stockwerk.
„Immerhin“, murmelte Eva. „Fehlerfrei geschrieben.“
Im sechsten Stock stiegen sie aus und stellten erleichtert fest, dass sich Edi Kerns Wohnung genau gegenüber dem Fahrstuhl befand.
Sie gingen auf die Tür zu, und obwohl sie nichts anderes erwartet hatte, veränderte ihr Anblick Julias Stimmung. Die Anspannung wich Ernüchterung. War das hier wirklich der richtige Ansatzpunkt? Was hoffte sie hier zu erfahren? Und was immer es war, würde es ihr helfen, Zander näher zu kommen?
Ihr Blick fiel auf die Klingel.
Irgendwo müssen wir schließlich anfangen.
Sie drückte auf den Knopf, und wieder öffnete niemand.
Sie klingelte noch einmal, nachdrücklicher, aber es schien tatsächlich niemand zu Hause zu sein. Wahrscheinlich hatte Edi Kern längst die Flucht ergriffen. Denkbar war allerdings auch, dass ihm etwas zugestoßen war. Dass die Menschen, vor denen er solche Angst hatte, ihn zum Schweigen gebracht hatten. Die Kraniche.
„Was machen wir jetzt?“, fragte Eva.
„Noch nicht aufgeben.“ Julia ging zur Nachbartür und drückte dort auf den Klingelknopf. Die Tür wurde fast sofort geöffnet, und eine junge Frau irgendwo in den Zwanzigern, mit einem eng anliegenden T-Shirt und einer bunten Leggins, schaute sie fragend an. „Ja?“
„Entschuldigen Sie“, sagte Julia. „Wir sind auf der Suche nach Edi Kern.“