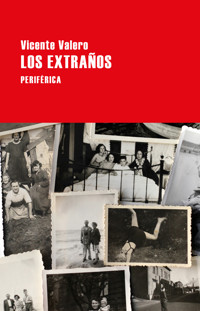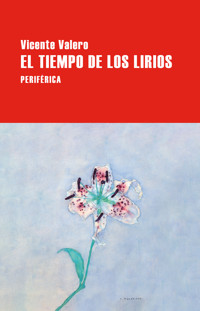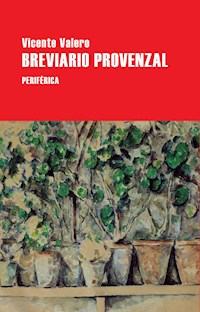Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer war das wohl, da, im Sessel oder im Bett eingesunken, alt oder auch nicht, jedenfalls bestimmt nicht ganz gesund ? Und drumherum, die halbe Stadt, meistens Frauen, ein paar Männer und vielleicht der Doktor oder sein mit ihm verfeindeter Kollege. Vicente Valero erzählt ein seltsames Kapitel aus Ibiza – zur Zeit seiner Kindheit noch ein abgelegenes Stück Land im Meer, wohin erst Künstler kommen, dann Touristen, mit denen sich alles zu verändern beginnt. Nur die Kranken bleiben, wie sie sind, ob sterbenskrank oder erkältet. Abwesend, aber nicht einsam. Denn auch wo gehustet oder gestorben wird, auch da vergeht die Zeit, und eine neue kommt. »Es gibt Bücher, die einem den Tag retten. Dieses ist so eines.« 5plus über »Schachnovellen«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vicente Valero
Krankenbesuche
Aus dem Spanischen von Peter Kultzen
BERENBERG
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
1
In einer meiner frühesten Erinnerungen sehe ich einen Mann mit Bart, der in einem Sessel am Ofen sitzt. Der Mann, über den ich sonst nichts sagen kann – weder, ob er alt oder jung ist, noch, wie er heißt, noch, wo er wohnt –, schweigt. An seiner Stelle sprechen drei, vielleicht auch zwei oder vier Frauen, die offenbar streiten, sich schreiend ins Wort fallen und sich einer anderen Frau verständlich machen wollen, die gerade eintrifft, mit mir, und die, ich erkenne sie wieder, meine Mutter ist. Laufen kann ich schon, natürlich, und so entferne ich mich auf einmal von der seltsamen Gruppe und steuere eine andere Ecke des unbekannten Zimmers an, warum, weiß ich nicht, möglicherweise habe ich dort etwas gesehen – einen Gegenstand, eine Farbe –, was meine Aufmerksamkeit auf sich zieht, oder ich habe mich erschreckt. In diesem Augenblick höre ich auch, wie eine Vase mit lautem Knall auf dem Boden aufschlägt, woraufhin der aufgeregt kreischende Chor mich entsetzt ansieht. Das ist alles. Mindestens so weit zurück liegt eine Erinnerung, in der meine Mutter und ich eine sehr enge Treppe hinaufsteigen, so eng, dass wir nicht nebeneinander gehen können, weshalb ich, trotz ihrer Unterstützung nur mit Mühe, die Vorhut übernehme. Irgendwann erreichen wir eine Tür, die von einer mageren und sehr großen Frau geöffnet wird, die weinend meine Mutter umarmt, die ihrerseits schreit, allerdings vor Schmerz, wir treten aber gar nicht erst ein, sondern machen uns gleich wieder an den Abstieg, als hätten wir soeben ein überaus wichtiges Ereignis verpasst. Um diese hilflos sich selbst überlassenen Erinnerungsbruchstücke zu verstehen – sage ich mir jetzt, soll heißen: während ich sie in meinem Heft festhalte –, sollte man sie vielleicht als die tiefste Schicht einer Ausgrabung betrachten, als dunkle, scharfkantige Reste einer alten Siedlung, deren vollständiger Grundriss sich nur mithilfe genauer Angaben über die dazugehörige Epoche – die dazugehörige verschwundene Zivilisation – und der Einbildungskraft rekonstruieren lässt. Oder man betrachtet sie als das Fundament, auf dem später, zu aufeinanderfolgenden Zeiten, andere Gebäude, andere Zimmer – mit anderen Vasen – und schließlich auch andere mehr oder weniger enge Treppen errichtet wurden, deren Ruinen einen wesentlich besser erhaltenen Eindruck machen. Außer diesen archäologischen Bruchstücken gibt es nichts als nackte Erde. Beziehungsweise, in unserem Fall, die Mutter, die wir damals begleiteten und die in den untersten sowie allen darüberliegenden Schichten deutlich auszumachen ist, wie sich ihr – irdisches und mütterliches – Gedächtnis dem unseren auch stets überlegen erweist: Da waren wir doch auf Krankenbesuch, weißt du das nicht mehr?
Diese Gewohnheit hatte sie von ihrer Mutter übernommen, oder anders gesagt: Von ihrer Mutter hatte sie nicht nur die Gewohnheit übernommen, Kranke zu besuchen, sondern auch die Kranken selbst, hinterließ meine Großmutter doch, als sie mit nicht einmal sechzig starb, also ohne im eigentlichen Sinne alt zu sein, eine stattliche Anzahl Frauen, mit denen sie zeitlebens befreundet gewesen war. Fast alle erfreuten sich damals bester Gesundheit, und meine Mutter besuchte sie von da an regelmäßig – ausnahmslos alle, wie mir scheint – und verwandelte sich auf diese Weise in ihre eigene Mutter, die Freundin von deren Freundinnen. Sie erlebte mit, wie sie alt wurden – alle, und dazu ihre Männer, Geschwister und Eltern –, oftmals krank, und schließlich starben, und an all diesen Übergängen und den damit zusammenhängenden Zeremonien nahm sie getreulich teil. Natürlich weiß ich das noch, na klar. Vor allem weiß ich noch, wie gut gelaunt sie die Häuser der Kranken betrat und dass es ihr fast immer gelang, selbst diejenigen aus ihrer Erstarrung zu holen, die sich dem Leiden schon ganz ergeben hatten. So wahr es ist, dass sie auf diese Weise ihrer allzu früh verstorbenen Mutter die Treue hielt und die christliche Forderung nach Nächstenliebe und Barmherzigkeit erfüllte – zu deren sieben leiblichen Werken der Besuch der Kranken zählt –, muss auch gesagt werden, dass der Spaß am häuslichen Beisammensein hier ebenfalls eine Rolle spielte, fanden sich doch regelmäßig ganze Gruppen von Besuchern ein, die sich lachend unterhielten, aßen und tranken, und das wahrscheinlich mehr, als dem Kranken zuträglich war. Heute ist mir allerdings sehr wohl klar, dass die Besuche weniger diesem als seiner Familie galten, deren Bedürfnis nach Ausgelassenheit und lautstarkem Meinungsaustausch womöglich viel größer war. Krankheiten waren damals zumeist langwierige Angelegenheiten, anders gesagt, die Ärzte – die Ärzte jener Tage, redselige Raucher, die sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen ließen und, das Köfferchen in der Hand, die Behausungen ihrer Patienten betraten wie Klempner, die man gerufen hat, um in Bad oder Küche einen eher harmlosen Schaden zu beheben –, die Ärzte also verordneten für gewöhnlich ausgiebige Bettruhe, oder, wieder anders gesagt, für Krankheiten galt damals das Gleiche wie für alle übrigen Lebensbereiche: Sie waren der Beschleunigung, von der die Dinge später erfasst wurden, noch nicht unterworfen. Rekonvaleszenz hieß also die mehr oder weniger begeistert befolgte Parole – man nahm sich eine »Auszeit«, wie man heute sagen würde, gönnte, warm eingepackt, Körper und Geist eine ordentliche Ruhepause. Auf diese Weise krank zu sein schien mir damals weder gut noch schlecht – zumal die Patienten sich stets erholten, so dass wir sie Wochen oder auch Monate nach unseren Besuchen seelenruhig die Straße entlangspazieren sahen. Es bezeichnete, soweit ich begreifen konnte, einen selbstverständlich keineswegs beneidenswerten Zustand – der Anblick der großen Flaschen mit Hustensirup auf dem Ess- oder Nachttisch löste panischen Schrecken in mir aus –, in sozusagen gesellschaftlicher Hinsicht hatte dieser jedoch nicht ausschließlich unangenehme, ja, manchmal sogar durchaus angenehme Folgen. In jedem Fall nahmen nicht alle Kranken an diesen Zusammenkünften teil, manche hatten schlichtweg zu hohes Fieber, um in den Morgenmantel zu schlüpfen und sich im Wohnzimmer im Sessel niederzulassen. Davon abgesehen stellten sich häufig so viele Besucher ein, dass sie unmöglich alle im Zimmer des Kranken Platz gefunden hätten, mit der Folge, dass die eigentliche Hauptfigur, von den anderen vergessen, allein im Bett liegen blieb. Dieser Umstand wiederum erlaubte es mir, mich durch den Flur davonzustehlen und den einsamen Kranken von der Türschwelle aus heimlich zu beobachten. Eine schrecklichere Form der Einsamkeit hätte ich mir damals kaum vorstellen können. Wenn ich auf dem Heimweg meine Mutter danach befragte, erwiderte sie, für den Kranken sei es am besten so, er hätte an diesem Tage eigentlich gar keinen Besuch nötig gehabt, worauf ich mich fragte, warum sich dann so viele Leute zu ihm aufgemacht hatten.
Mein Vater war ein einzelgängerischer Mensch; dass er uns bei diesen Besuchen allzu häufig begleitete, war nicht zu erwarten. Außerdem war er, wie ich später erfuhr, ein ausgesprochener Hypochonder. Meine fünf Jahre ältere Schwester taucht ebenfalls nur selten in diesen Erinnerungen auf. Als sie irgendwann aufsässig wurde und anfing, auf eigene Faust die Welt zu erkunden – auch darin war sie, zur Verwirrung meiner Eltern, erstaunlich frühreif –, verabschiedete sie sich bestimmt von derlei gemeinsamen Unternehmungen. (Ich erinnere mich allerdings noch genau, dass wir beide einmal den gesamten Schokoladenvorrat einer Familie auffutterten, bei der wir zu Besuch waren. Auch die Strafpredigt, die wir uns anschließend anhören mussten, habe ich nicht vergessen.) Die Lieblingsbeschäftigungen meines Vaters passten zu seinem zurückhaltenden und schüchternen Wesen: lesen, Schach spielen, lange spazieren gehen. Dass er an den Lieblingsvergnügungen meiner Mutter teilnahm, war gleichermaßen unwahrscheinlich: Sie ging für ihr Leben gern zu Fußballspielen, Stierkämpfen, in den Zirkus, zum Trabrennen oder zu Prozessionen. Dafür ließ mein Vater sich, so kam es mir wenigstens vor, bei der Rückkehr gern von unseren Eindrücken erzählen. Meine Mutter nahm mich zu alldem nicht nur mit, um mir eine Freude zu machen – den größten Spaß daran hatte sie selbst. Ja, als ich eines Tages erwachsen war, ging ich zu nichts dergleichen mehr, sie dagegen hörte erst auf, als ihr Fußballverein sich wegen Zahlungsunfähigkeit auflöste, die Stierkampfarena endgültig geschlossen wurde – offenbar gab es auf der Insel nicht genügend Stierkampfanhänger –, die Pferderennbahn in eine Diskothek umgewandelt wurde und die Zirkusse, die in regelmäßigen Abständen bei uns vorbeikamen, immer trauriger wurden, während die Flöhe dort immer mehr überhandnahmen. Immerhin gab es noch Prozessionen sowie verschiedene neue Festlichkeiten, für die sie sich rasch begeisterte. Ich glaube, ich habe die jeweiligen Vorlieben meiner Eltern geerbt, die ja eigentlich nicht zusammenpassen, so dass mich stets das ausschweifende Gesellschaftsleben angezogen hat, andererseits die völlige Einsamkeit und Abgeschiedenheit, was zu einem so aufwühlenden wie erschöpfenden Zwiespalt geführt hat – sobald ich das eine habe, wünsche ich mir nichts so sehr wie sein Gegenteil. (Einen befriedigenden Mittelweg habe ich nie finden können.) Kinder denken für gewöhnlich nur sehr wenig oder gar nicht darüber nach, wie sie als Erwachsene leben werden, welches Erbteil sich bei der Ausbildung ihres Charakters durchsetzen wird, ob sie eher ihrem Vater oder ihrer Mutter ähneln werden, und trotzdem verkünden sie schon früh, welchen Beruf sie eines Tages ausüben wollen. Offensichtlich ist ihnen klar, dass das Erwachsenenleben, über das sie sonst nicht nachdenken, so oder so irgendwann beginnen wird. Ich hätte verschiedene Möglichkeiten gehabt, aber ich wollte nie Torero werden, und auch nicht Fußballer oder Dompteur. Die vielen Kranken, die wir damals besuchten, weckten vermutlich in mir die Berufung zum Arzt.
2
Es gibt keine Krankheiten, es gibt nur Kranke. Diesen Spruch habe ich oft gehört, zum ersten Mal vielleicht bei einer dieser Plauderrunden, bei denen, soweit ich mich erinnere, über alles Mögliche, vor allem jedoch – und am eifrigsten und mit größerer Beteiligung als bei anderen Themen – über Krankheiten und Kranke gesprochen wurde. Dort wurde mir auch zum ersten Mal bewusst, wie sehr es zutrifft, dass Krankheiten uns jederzeit begleiten – auch diese Formulierung dürfte ich, zu meiner Verwunderung oder zu meinem Schrecken, aus dem Mund eines der Teilnehmer dieser Zusammenkünfte gehört haben –, beziehungsweise, dass für alle Krankheiten gilt – für die, die wir gehabt haben, und die, die wir noch haben werden –, dass sie nicht nur unvermeidliche Hindernisse darstellen, die wir überwinden müssen, sondern oftmals auch notwendige Veränderungen unseres Organismus herbeiführen, die unser Weiterleben überhaupt erst möglich machen. Für das Kind, das während dieser Unterhaltungen als Ohrenzeuge, jedoch nicht im eigentlichen Sinne Zuhörer, ein Comicheft las oder seine Spielzeugautos über den Wohnzimmerteppich oder den Flurboden schob, nahmen all diese, wie man so sagt, »nebenbei aufgeschnappten Wörter« im Verlauf seiner ersten eigenen Erkrankungen eine mehr oder weniger nachvollziehbare Bedeutung an, etwa als es, gelangweilt und, wie damals üblich, in fast völliger Dunkelheit, die Masern durchmachte oder den Mumps, an dem es gleichzeitig mit seiner Schwester und den drei Kindern von gegenüber erkrankte. Wurde man etwa nicht bei jeder Krankheit ein Stück größer? Was auch immer der eingangs genannte Spruch besagen wollte, Krankheiten gab es sehr wohl, und alle im Haus des Kranken Versammelten wussten eine Menge darüber zu berichten. In einem schier endlosen Wettlauf – von den auf dem Tisch stehenden Keksen und dem Muskateller war dabei irgendwann nichts mehr übrig – und unter Nennung der Namen und dazugehörigen Leiden zählte ein jeder auf, was er alles durchgemacht hatte, vielleicht war es dem, der gerade mit dem Kranksein an der Reihe war, ja ein Trost, in jedem Fall aber trug es zum Ansehen desjenigen bei, der mit der Beschreibung der meisten und schlimmsten Erkrankungen aufwarten konnte. Auf diese Weise lernte ich die Bezeichnungen vieler Leiden kennen, die mich offenbar im Lauf des Lebens erwarteten, von chronischer Bronchitis bis Rheuma über Migräne, Venenentzündung und Ischias. Ich prägte sie mir mit der gleichen Selbstverständlichkeit ein wie die Namen bekannter Fußballer oder Stierkämpfer, konnte ihnen jedoch, anders als diesen, vorläufig weder ein Gesicht noch besondere Fähigkeiten zuordnen.
Einige der schlimmsten Krankheiten waren damals bereits verschwunden, unter den Besuchern befanden sich für gewöhnlich jedoch nicht wenige Alte, die bei ihren Aufzählungen mit so beeindruckenden Dingen wie den Pocken, der Malaria oder dem Typhus aufwarten konnten. Dass sich Krankheiten ausrotten ließen, erstaunte mich sehr, hieß das doch, dass es eines Tages womöglich überhaupt keine mehr geben würde. Wie sollten Kinder dann aber wachsen und größer werden? Sie würden schon einen Weg finden. Mit den Krankenbesuchen wäre es daraufhin natürlich auch vorbei. Eine Welt ohne Kranke und ohne Krankheiten war also vorstellbar – woran sollten die Menschen in diesem Fall allerdings sterben? Meine immergleiche Antwort lautete: am Alter. Es sei denn, man wurde von einem Auto überfahren oder ertrank beim Baden im Meer, was einem aber nur passieren konnte, wenn man sehr unvorsichtig war oder einfach Pech hatte. Die Namen der oben genannten Krankheiten, die angeblich nie wieder auftreten würden, hatten für mich einen magischen Klang, sie würden mir nichts mehr anhaben können, mich nicht betreffen, sagte ich mir, während ich neugierig die Greise betrachtete, die behaupteten, die eine oder andere davon durchgemacht zu haben, und versuchte, mir die dabei erlittenen Qualen auszumalen. Malaria. Diese Krankheit wurde durch Mücken übertragen. Im Ernst? Oder sollte das ein Witz sein? Den Ton der Unterhaltungen konnte ich nicht immer ohne weiteres einschätzen, legten die Beteiligten ihre misstrauischen oder mitleidvollen Mienen doch manchmal mit erstaunlicher Geschwindigkeit ab, um gemeinsam ein herzhaftes Gelächter anzustimmen. Pocken. Darüber sprach man nur, wenn die einst davon Betroffenen nicht anwesend waren, war doch niemand stolz auf die Narben, die dieser schreckliche Virus im Gesicht hinterließ. Typhus: Was auch immer davon berichtet wurde, ich konnte es nur mit Schaudern anhören. Und wer diese Krankheit einst durchgestanden hatte, dem zitterte bei der Erinnerung daran immer noch die Stimme, als hätte er eine unfassbare Tragödie überlebt. Auf dem Nachhauseweg war meine Mutter jedes Mal bemüht, dem, was ich möglicherweise gehört hatte, die Schärfe zu nehmen: Die Alten übertreiben immer ein bisschen.
Ja, vielleicht übertrieben sie wirklich, aber eben bloß ein bisschen, und wenn diese alten Krankheiten bei uns nicht mehr vorkamen, lag das vor allem daran, wie man ebenfalls bei diesen fröhlichen Zusammenkünften sagte, dass die Armut von der Insel verschwunden war und der Fortschritt – an dieser Stelle sagten sie in Wirklichkeit der Tourismus, weil der die einzige Form von Fortschritt war, die sie kennengelernt hatten – endlich auch auf unseren Straßen, in unseren Bars, Metzgereien und Fischgeschäften, unserem Gemüsemarkt und schließlich unseren Häusern Einzug gehalten hatte, als wären all diese Orte bis dahin nichts als Brutstätten der übelsten Mücken, Viren und Bakterien gewesen, mit deren Ausmerzen man erst seit der Ankunft der Touristen begonnen hatte. In diesem Punkt waren sich alle einig, und keiner verspürte auch nur die geringste Sehnsucht nach der Vergangenheit, der sie, ihre Herzen und Gewohnheiten, doch eigentlich angehörten. Vor allem freuten sie sich ihrer Kinder und Enkel wegen, die bereits mehr oder weniger erfolgreich dabei waren, sich ihren Platz in der neuen, so viel Glück verheißenden Zeit zu suchen. Und trotzdem waren ihre Überlegungen von Skeptizismus überschattet, sagte die eigene Erfahrung ihnen doch, dass es für die Bewohner einer Insel nicht darum gehen konnte, Erfolg zu haben und voranzukommen, sondern einzig und allein darum, zu überleben. Schließlich waren sie, ohne sich dessen bewusst zu sein – oder vielleicht doch –, die letzten und eigenartigsten Bakterien, die aus dieser alten Zivilisation noch nicht verschwunden waren.
3
Wie das Herz meiner Großmutter, die ihre beste Freundin gewesen war, war auch das Doña Antonias groß, aber sehr empfindlich, vielleicht, weil es so viele abgebrochene Geschichten und bittere Enttäuschungen in sich barg. Ihre kleinen Rhythmusstörungen, ihre kleinen Infarkte – so bezeichnete die kleinwüchsige, rundliche und fast immer lächelnde Frau ihre Beschwerden. Alles in ihrer Welt war klein, vor allem ihre Wohnung im Hafenviertel. Ich ging gern dorthin, erwarteten mich bei ihr doch stets ein Stück frisch gebackener Kuchen und eine Tasse heiße Schokolade. Der kleine