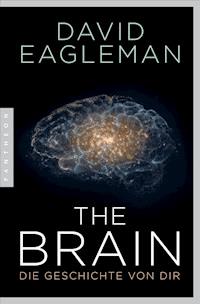19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wie entsteht das Neue? Durch Biegen, Brechen und Verbinden!
Wir Menschen wollen ständig Neues erschaffen - was aber macht unser Gehirn dabei so besonders? Warum erfinden Krokodile keine Speedboats?
Der Neurowissenschaftler David Eagleman und der Komponist Anthony Brandt schildern, wie in unseren Köpfen Innovation entsteht. Sie erzählen Geschichten neuer Ideen von Picasso bis zur Raumfahrt und zeigen uns, dass wir die Herausforderungen der Zukunft nur meistern können, wenn wir die kreative Software unseres Gehirns verstehen lernen.
Ein faszinierendes Duett von Naturwissenschaft und Kunst: Der weltbekannte Hirnforscher David Eagleman und sein Freund, der Komponist Anthony Brandt, widmen sich in ihrem Buch der Frage, wie das Neue entsteht. Dabei blicken sie auf die kreative Software des Gehirns: Wie funktioniert sie? Was machen wir damit? Wohin führt sie uns? Es erweist sich, dass der kreative Prozess vor allem von drei Fähigkeiten des Gehirns abhängt: Biegung, Brechung und Verbindung.
An vielen Beispielen, von der Raumfahrt über die Wirtschaft und die Kunst bis zum Sport, demonstrieren die Autoren, wie unser Denken die Welt immer wieder neu erschafft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ein faszinierendes Duett von Neurowissenschaft und Kunst: Der weltbekannte Hirnforscher David Eagleman und sein Freund, der Komponist Anthony Brandt, widmen sich der Frage, wie das Neue entsteht. Dabei blicken sie auf die kreative Software des Gehirns: Wie funktioniert sie? Was machen wir damit? Wohin führt sie uns? Es erweist sich, dass der kreative Prozess vor allem von drei Fähigkeiten des Gehirns abhängt: Biegen, Brechen und Verbinden. An vielen Beispielen, von der Raumfahrt über die Wirtschaft und die Kunst bis zum Sport, zeigen die Autoren, wie unser Denken die Welt immer wieder neu erschafft.
David Eagleman, geboren 1971, wurde in Neurowissenschaften promoviert und war Schüler des legendären Biologen Francis Crick. Er ist einer der angesehensten und bekanntesten Hirnforscher der Welt. Eagleman forscht und lehrt über das Unbewusste und die menschliche Wahrnehmung an der Stanford University. Mit »Fast im Jenseits«, einer Sammlung von kurzen Geschichten über das Leben nach dem Tod, gelang ihm ein in 20 Sprachen übersetzter Weltbestseller. Zuletzt erschienen bei Pantheon »Inkognito. Die geheimen Eigenleben unseres Gehirns« (2013) und »The Brain.« (2013)
Anthony Brandt, geboren 1961, ist Professor für Musik an der Rice University und Komponist. Zu seinem Œuvre zählen sinfonische Werke ebenso wie Kammer- und Vokalmusik. Zudem ist er in besonderer Weise bei der Präsentation musikalischer Werke im öffentlichen Raum und in der Musikerziehung engagiert. Seine Konzerte haben bis heute ein Publikum von zehntausenden Schülern und Lehrern erreicht.
DAVID EAGLEMAN& ANTHONY BRANDT
KREATIVITÄT
Wie unser Denken die Welt immer wieder neu erschafft
Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer
Siedler
Die Originalausgabe ist 2017 unter dem Titel »The Runaway Species. How Human Creativity Remakes the World« bei Canongate Books, Edinburgh, erschienen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.Erste Auflage
April 2018
Copyright © Anthony Brandt, 2017
Copyright © David Eagleman, 2017
© 2018 für die deutsche Ausgabe by Siedler Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Rothfos&Gabler, Hamburg
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-22462-2V002www.siedler-verlag.de
Für unsere Eltern, die uns ein Leben der Kreativität geschenkt habenNat und Yanna · Cirel und Arthur
Für unsere Frauen, die unser Leben mit Neuem bereichernKarol · Sarah
Für unsere Kinder, die mit ihrer Fantasie die Zukunft gestaltenSonya, Gabe, Lucian · Ari und Aviva
INHALT
Einleitung
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Teil 2
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Teil 3
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Dank
Literatur
Personenregister
Bildnachweis
Anmerkungen
EINLEITUNG
WAS DIE NASA UND PICASSO GEMEINSAM HABEN
Einige Hundert Menschen drängen sich in ein Kontrollzentrum in Houston, um drei Männer zu retten, die im Weltall festsitzen. Wir schreiben das Jahr 1970, und Apollo 13 ist seit zwei Tagen zum Mond unterwegs, als plötzlich ein Sauerstofftank explodiert und die Raumkapsel beschädigt. Mit dem Understatement eines Soldaten meldet Astronaut Jack Swigert an die Bodenstation: »Houston, wir haben ein Problem.«
Die Astronauten sind über 300 000 Kilometer von der Erde entfernt. Treibstoff, Wasser, Strom und Sauerstoff werden knapp. Die Hoffnung auf eine Lösung geht gegen Null. Doch Einsatzleiter Gene Kranz im NASA-Kontrollzentrum lässt sich nicht beirren. Seiner versammelten Mannschaft erklärt er:
Wenn ihr diesen Raum verlasst, dann müsst ihr fest daran glauben, dass diese Besatzung nach Hause kommt. Es ist mir scheißegal, wie wahrscheinlich das ist und dass wir so etwas noch nie gemacht haben … Ihr müsst daran glauben, und eure Leute müssen daran glauben, dass diese Besatzung nach Hause kommt.1
Aber wie konnte das Kontrollzentrum diese Zusage einhalten? Die Ingenieure hatten den Flug auf die Minute genau durchgeplant: Wann Apollo 13 in die Mondumlaufbahn einschwenkt, wann die Mondlandefähre startet, wie lange die Astronauten auf dem Mond spazieren gehen. Nun können sie ihr Drehbuch auf den Müll werfen und ganz von vorn anfangen. Natürlich hat das Kontrollzentrum auch Notfallpläne erarbeitet, doch die gehen davon aus, dass die Kapsel intakt ist.2 Das ist jedoch nicht der Fall: Das Servicemodul ist zerstört, und in der Kommandokapsel bricht die Versorgung mit Sauerstoff und Elektrizität zusammen. Das Einzige, was noch funktioniert, ist die Mondlandefähre. Die NASA hat eine ganze Reihe von Szenarien durchgespielt, aber dieses nicht.
Die Ingenieure wissen, dass sie vor einer nahezu unmöglichen Aufgabe stehen: Sie müssen drei Menschen retten, die in einer defekten Metallkapsel stecken und mit 4500 Kilometern pro Stunde durch den luftleeren Raum rasen. Moderne Satellitenkommunikationssysteme und PCs sind noch viele Jahre entfernt. Mit Rechenschieber und Bleistift müssen die Ingenieure eine Möglichkeit finden, wie die Astronauten die Kommandokapsel verlassen und die Mondlandefähre in ein Rettungsboot verwandeln können.
Die Ingenieure gehen ein Problem nach dem anderen an: die Planung einer Rückflugroute, die Steuerung der Kapsel, die Stromerzeugung. An Bord spitzt sich die Lage währenddessen weiter zu. Anderthalb Tage nach Beginn der Krise erreicht das Kohlendioxid in der engen Kapsel eine gefährliche Konzentration. Wenn nichts passiert, werden die Astronauten binnen weniger Stunden ersticken. Die Mondlandefähre hat ein Luftreinigungssystem, doch dessen runde Filter sind aufgebraucht. Die einzige Rettung sind die frischen Filter der Kommandokapsel – doch die sind leider eckig. Wie soll man einen eckigen Filter auf eine runde Öffnung setzen?
Da die Ingenieure im Kontrollzentrum eine genaue Liste aller Gegenstände haben, die sich an Bord befinden, improvisieren sie einen Adapter aus einer Plastiktüte, einer Socke, Pappe, Klebeband und dem Schlauch eines Druckanzugs. Sie erklären der Mannschaft, wie sie aus der Plastikhülle ihres Flugplans einen Trichter basteln können, um Luft in den Filter zu leiten. Auf Anweisungen vom Boden packen die Astronauten ihre Thermounterwäsche aus, die sie eigentlich während des Mondspaziergangs tragen sollten; allerdings brauchen sie jetzt nicht die Unterwäsche, sondern die Plastikfolie, in die sie eingepackt ist. Schritt für Schritt setzen die Astronauten ihren Filter zusammen und installieren ihn.
Zur allgemeinen Erleichterung kehrt das Kohlendioxid zum normalen Niveau zurück. Aber auf diese Hürde folgen weitere. Kurz vor dem Wiedereintritt in die Atmosphäre wird der Strom knapp. Beim Bau des Fluggeräts war es niemandem in den Sinn gekommen, dass die Batterien der Kommandokapsel von der Mondlandefähre aufgeladen werden würden – es war genau andersherum gedacht. Befeuert von Koffein und Adrenalin, finden die Ingenieure im Kontrollzentrum im letzten Moment eine Möglichkeit, aus dem Heizungskabel der Mondlandefähre ein Ladekabel zu basteln.
Nachdem die Batterien aufgeladen sind, weisen die Ingenieure Jack Swigert an, die Kommandokapsel zu starten. Der Astronaut verbindet Kabel, schaltet Wechselrichter, hantiert mit Antennen, legt Schalter um, aktiviert Fernmessung – eine Startprozedur, die nichts mit dem zu tun hat, was er in seiner Ausbildung gelernt hat. Angesichts der vielen unvorhergesehenen Probleme müssen die Ingenieure ganz neue Abläufe improvisieren.
In den frühen Morgenstunden des 17. April 1970 – achtzig Stunden nach Beginn der Krise – bereiten die Astronauten die Landung vor. In der Kommandozentrale werden letzte Einzelheiten überprüft. Als die Astronauten in die Erdatmosphäre eintreten, schaltet sich das Funksystem ab. Später schilderte Kranz, wie sich die Mitarbeiter in der Zentrale in diesem Moment fühlten:
Jetzt gab es nichts mehr, was wir noch tun konnten … Es war totenstill im Raum. Das einzige Geräusch war das Surren der Geräte, das Brummen der Klimaanlage und hin und wieder das Klicken eines Feuerzeugs … Niemand rührte sich, so als wären alle an ihre Konsolen gekettet.
Anderthalb Minuten später erreicht die Meldung das Kontrollzentrum: Apollo 13 ist sicher gelandet.
Die Mitarbeiter jubeln. Der ansonsten so stoische Kranz bricht in Tränen aus.
*
Etwa 63 Jahre früher stellt ein junger Maler namens Pablo Picasso in seinem kleinen Studio in Paris seine Staffelei auf. Von einem unverhofften Geldsegen hat sich der notorisch klamme Maler eine große Leinwand geleistet. Nun beginnt er ein provokantes Projekt: das Porträt von Prostituierten in einem Bordell. Es soll ein ungeschminkter Blick auf das Laster werden.
Aber zuerst fertigt Picasso mit Kohle Skizzen von Köpfen, Körpern, Früchten an. In seiner ersten Version sind ein Matrose und ein Medizinstudent Teil der Szenerie. Schließlich beschließt er, ohne sie auszukommen und sich auf die fünf Frauen zu konzentrieren. Er experimentiert mit verschiedenen Posen und Anordnungen und verwirft die meisten wieder. Nach Hunderten Skizzen setzt er sich an die Leinwand. Später lädt er seine Geliebte und einige Freunde ein, um ihnen den Entwurf zu zeigen; ihre Reaktion ist derart ernüchternd, dass er das Gemälde ein paar Monate lang zur Seite legt. Aber irgendwann macht er sich wieder an die Arbeit und malt im Stillen weiter.
Picasso sieht das Porträt der Prostituierten als eine Art »Exorzismus« seines eigenen Stils: Je länger er daran arbeitet, umso weiter entfernt er sich von seinen früheren Bildern. Als er ein weiteres Mal Freunde einlädt, um ihnen das Bild zu zeigen, fällt das Urteil noch ablehnender aus. Er bietet es seinem treuesten Kunden zum Kauf an, doch der lacht nur.3 Die Freunde des Malers meiden ihn und sorgen sich um seinen Geisteszustand. Enttäuscht rollt Picasso die Leinwand ein und versteckt sie im Schrank.
Erst neun Jahre später, mitten im Ersten Weltkrieg, zeigt er das Gemälde zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Um das Publikum nicht aufzubringen, ändert der Organisator der Ausstellung den Titel von Le Bordel d’Avignon (Das Bordell von Avignon) zu Les Demoiselles d’Avignon (Die Damen von Avignon). Die Reaktionen der Ausstellungsbesucher sind gemischt; ein Journalist schreibt: »Die Kubisten warten nicht bis Kriegsende, um ihren Kampf gegen den guten Geschmack aufzunehmen …«4
Doch der Einfluss des Gemäldes wächst. Als Les Demoiselles einige Jahrzehnte später im Museum of Modern Art in New York ausgestellt wird, schreibt ein Kritiker der New York Times:
Wenige Gemälde haben derart weitreichenden Einfluss gehabt wie diese Komposition von fünf entstellten nackten Gestalten. Mit einem Pinselstrich stellte es die Kunst der Vergangenheit infrage und gab der Kunst der Gegenwart eine neue Richtung.5
Später bezeichnete der Kunsthistoriker John Richardson Les Demoiselles als das originellste Gemälde der vergangenen sieben Jahrhunderte. Das Gemälde
erlaubte den Menschen, die Dinge mit neuen Augen und neuem Bewusstsein zu sehen. Es ist das erste Kunstwerk, das eindeutig dem 20. Jahrhundert zuzuordnen ist, einer der wichtigsten Zünder der Moderne und ein Grundstein der Kunst des 20. Jahrhunderts.6
Was machte die Originalität dieses Gemäldes aus? Pablo Picasso stellte den Anspruch infrage, mit dem europäische Maler seit Jahrhunderten zu Werke gingen: die realitätsgetreue Abbildung des Lebens. Unter Picassos Pinsel verformten sich die Körper, zwei Frauen haben maskenhafte Gesichter, und jede der fünf Gestalten scheint in einem anderen Stil gemalt zu sein. Menschen sehen nicht mehr ganz menschlich aus. Picassos Gemälde verstieß gegen die westlichen Vorstellungen von Schönheit, Darstellung und Anstand. Les Demoiselles gilt heute als der schwerste Schlag, der je gegen die Tradition der Kunst geführt wurde.
Kontrollzentrum der NASA und Picassos Les Demoiselles d’Avignon.
Was haben diese beiden Geschichten gemein? Auf den ersten Blick nicht viel. Die Rettung von Apollo 13 war eine kollektive Tat, während Picasso allein arbeitete. Die Ingenieure der NASA kämpften gegen die Uhr, während Picasso monatelang an seiner Staffelei saß und sich mit der Ausstellung fast ein Jahrzehnt lang Zeit ließ. Die Ingenieure suchten nach einer funktionierenden Lösung, während »Funktion« das Allerletzte war, für das sich Picasso interessierte: Er wollte etwas noch nie Dagewesenes schaffen.
Trotzdem stehen hinter der Kreativität der Ingenieure und des Künstlers die gleichen kognitiven Abläufe. Und nicht nur hinter der Kreativität von Technikern und Malern – auch hinter der von Friseuren, Buchhaltern, Architekten, Bauern, Schmetterlingsforschern und allen möglichen Menschen, die Neues in die Welt bringen. Wenn wir die Gussformen des Bekannten zerbrechen und etwas Neues schaffen, dann verwenden wir dazu alle dieselbe Software des Gehirns. Das menschliche Gehirn nimmt Erfahrung nicht passiv auf wie ein Diktiergerät, sondern es verarbeitet die von den Sinnesorganen gelieferten Daten unentwegt und erschafft damit neue Versionen der Welt. Die grundlegende Denksoftware unseres Gehirns, die unsere Umwelt registriert und neue Versionen erzeugt, bringt all das hervor, was uns umgibt: Straßenlaternen, Nationen, Sinfonien, Gesetze, Gedichte, Armprothesen, Handys, Deckenventilatoren, Wolkenkratzer, Boote, Drachen, Laptops, Ketchupflaschen und fahrerlose Autos. Außerdem bringt diese mentale Software Zukunftsvisionen hervor in Form von selbst heilendem Beton, beweglichen Gebäuden, Geigen aus Kohlefaser, biologisch abbaubaren Autos oder Nanoraumschiffen. Aber wie ein Computerprogramm, das still auf der Platine eines Laptops seine Arbeit verrichtet, läuft unsere Kreativität meist im Hintergrund ab und entzieht sich unserem Bewusstsein.
Die Programme, die unbemerkt in unserem Kopf ablaufen, sind etwas ganz Besonderes. Wir sind Teil eines großen Stammbaums von Arten. Aber warum choreografieren Kühe kein Ballett? Warum erfinden Eichhörnchen keine Aufzüge, um in die Baumwipfel zu kommen? Warum bauen Krokodile keine Schnellboote? Die Evolution hat die Programme in unserem Gehirn so aufgepeppt, dass wir die Welt nicht nur so wahrnehmen, wie sie ist, sondern dass wir uns auch alternative Szenarien vorstellen können. Genau um diese kreative Software geht es in diesem Buch: Wie funktioniert sie? Warum haben wir sie? Was machen wir damit? Und wohin führt sie uns? Wir sehen uns an, warum der Wunsch nach Neuem die Kreativität des Menschen beflügelt. Bei Ausflügen in Kunst, Wissenschaft und Technik werden wir den roten Faden der Innovation aufspüren, der diese unterschiedlichen Disziplinen miteinander verbindet.
So wichtig die Kreativität in der Vergangenheit der Menschheit war, so wichtig wird sie auf dem Weg in die Zukunft. Ob im Alltag, in der Schule oder in Unternehmen – überall gehen wir gemeinsam in eine Zukunft, die uns dazu zwingt, unser Bild von der Welt ständig zu überdenken. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir den Wechsel von der Industrie- zur Informationsgesellschaft erlebt. Doch damit sind wir längst nicht am Ende angekommen. Wenn Computer immer mehr Aufgaben übernehmen, dann können wir Menschen uns anderen Tätigkeiten zuwenden. Schon jetzt sehen wir die Anfänge von etwas Neuem: der Kreativitätsgesellschaft. Synthetische Biologen, App-Entwickler, Multimediaingenieure, Entwickler von fahrerlosen Autos – das alles sind Tätigkeiten, an die in der Schule noch kaum jemand dachte, und heute sind sie nur die Speerspitze dessen, was auf uns zukommt. Wenn Sie in zehn Jahren ins Büro gehen, dann könnte Ihre Arbeit ganz anders aussehen als das, was Sie heute dort machen. Deshalb versucht man überall in den Vorstandsetagen hastig Schritt zu halten, denn die unternehmerischen Techniken und Verfahren verändern sich ständig.
Nur eines kann uns helfen, diese rasanten Veränderungen erfolgreich zu meistern: unsere kognitive Flexibilität. Wir nehmen das Rohmaterial unserer Erfahrung und stellen daraus etwas ganz Neues her. Mit unserer Fähigkeit, über Gelerntes hinauszugreifen, nehmen wir die Welt um uns her wahr und stellen uns gleichzeitig andere Welten vor. Wir beobachten Fakten und schaffen Fiktionen. Wir lernen das, was ist, und stellen uns vor, was sein könnte.
Wenn wir in einer sich ständig wandelnden Welt erfolgreich sein wollen, müssen wir verstehen, was in unseren Köpfen passiert, wenn wir etwas Neues erschaffen. Wenn wir uns die Werkzeuge und Strategien aneignen, mit denen wir neue Ideen generieren, können wir in die Zukunft blicken statt in die Vergangenheit.
Leider tun unsere Schulen nichts, um Innovation zu unterrichten. Kreativität beflügelt die Neugierde und Ausdrucksfähigkeit junger Menschen, doch sie wird unterdrückt, weil sich andere Fähigkeiten leichter in Prüfungen abfragen lassen. Die Unterdrückung der Kreativität spiegelt gesellschaftliche Befindlichkeiten wider. Lehrer unterrichten lieber brave Schüler, denn kreative Kinder und Jugendliche halten sich oft nicht an die Regeln. Eine Umfrage unter amerikanischen Eltern ergab, dass ihnen in ihren Kindern Respekt gegenüber Erwachsenen wichtiger ist als eigenständiges Denken, Anstand wichtiger als Neugierde und Benimm wichtiger als Kreativität.7
Wenn wir uns eine leuchtende Zukunft für unsere Kinder wünschen, dann sollten wir diese Prioritäten überdenken. Angesichts der rasanten Geschwindigkeit, mit der sich die Welt heute verändert, wird das alte Drehbuch für Leben und Arbeit seine Gültigkeit verlieren, und wir müssen unsere Kinder darauf vorbereiten, neue und eigene Drehbücher zu schreiben. Die kognitive Software, die in den Köpfen von Picasso und NASA-Ingenieuren läuft, ist auch in den Köpfen unserer Kinder installiert – aber sie will geschult sein. Eine ausgewogene Bildung fördert Wissen und Fantasie. Eine solche Bildung zahlt sich in einigen Jahrzehnten aus, wenn die Kinder die Schule längst hinter sich gelassen haben und eine Welt betreten, von der wir, die Eltern, nicht einmal die Konturen erahnen.
Einer von uns beiden (Anthony) ist Komponist, der andere (David) ist Hirnforscher. Wir sind seit vielen Jahren befreundet. Vor einiger Zeit komponierte Anthony sein Oratorium Maternity, basierend auf Davids Geschichte »The Founding Mothers«, die eine mütterliche Linie durch die Geschichte zurückverfolgt. Während unserer Zusammenarbeit kam unser Gespräch immer wieder auf die Kreativität. Wir hatten uns beide schon länger aus unserer jeweils eigenen Sicht mit diesem Thema beschäftigt. Seit Jahrtausenden eröffnen die Künste einen direkten Zugang zu unserem Innersten und zeigen uns nicht nur, was wir denken, sondern auch wie. Jede Kultur der Menschheitsgeschichte hatte ihre eigene Musik, Kunst und Geschichten. Die Hirnforschung wiederum hat in den vergangenen Jahrzehnten große Fortschritte erzielt beim Verständnis der oftmals unbewussten Kräfte, die hinter dem menschlichen Verhalten stehen. In unseren Gesprächen stellten wir fest, dass unsere unterschiedlichen Perspektiven ein neues Verständnis der Kreativität ermöglichen – und genau darum geht es in diesem Buch. Wir durchforsten die Erfindungen der Menschheit wie Paläontologen auf der Suche nach Knochen. In der Kombination mit den neuesten Erkenntnissen aus der Hirnforschung entdecken wir neue Facetten dieses so wesentlichen Aspekts unseres Selbst. In Teil 1 sehen wir uns an, welche Bedeutung die menschliche Kreativität hat, wie wir auf neue Ideen kommen und wie unsere Innovationen durch unsere Zeit und unsere Umwelt geprägt werden. In Teil 2 gehen wir den wesentlichen Eigenschaften des kreativen Denkens nach, von der Vervielfältigung von Möglichkeiten bis zur Risikobereitschaft. In Teil 3 wenden wir uns schließlich Schulen und Unternehmen zu und zeigen, wie wir in diesen Brutstätten der Zukunft die Kreativität fördern können. Dieses Buch ist ein Sprung ins kreative Denken, eine Feier des menschlichen Geistes und eine Vision, wie wir unsere Welt verändern können.
TEIL 1
NEUES UNTER DER SONNE
KAPITEL 1
NEUES IST MENSCHLICH
WARUM FINDEN WIR NIE DEN PERFEKTEN STIL?
Um zu sehen, wie groß unser Bedürfnis nach Neuem ist, reicht schon ein Blick auf die Frisuren in Ihrer Umgebung.
Diese ständige Neugestaltung lässt sich in sämtlichen menschlichen Erzeugnissen beobachten, von Fahrrädern bis hin zu Sportarenen:
Liegerad, Michael Killians Snowboard-Fahrrad, DiCycle von GBO Innovation Maker und Konferenzfahrrad.
Was die Frage aufwirft: Warum müssen wir dauernd mit unseren Frisuren, Fahrrädern und Sportstadien experimentieren? Warum finden wir nicht die eine perfekte Form und bleiben dabei?
Die Antwort: Veränderung wird nie enden. Weil es nicht um das Richtige geht, sondern um das Nächste. Wir Menschen sind der Zukunft zugewandt, und es gibt keinen Endpunkt. Aber was macht unser Gehirn so rastlos?
WIR PASSEN UNS SCHNELL AN
In jedem beliebigen Moment schwebt eine gute Million Menschen in bequemen Sesseln Tausende Meter hoch über der Erde. So beliebt ist der Flugverkehr. Doch es ist noch nicht lange her, da waren Flugreisen ein waghalsiges Abenteuer für einige wenige Pioniere. Heute ist das Fliegen ganz selbstverständlich: Wir steigen ein wie im Schlaf und werden nur wach, wenn unsere Erwartung an bequeme Sitze, leckere Mahlzeiten und unterhaltsame Filme enttäuscht wird.
In einem seiner Programme wundert sich der Komiker Louis C. K. darüber, dass wir nicht mehr über Flugreisen staunen. Er imitiert einen meckernden Passagier: »Und dann steigen wir ein, und die lassen uns da auf dem Rollfeld stehen, eine geschlagene Dreiviertelstunde. Wir haben einfach da rumgestanden.« Worauf Louis: »Echt jetzt? Und was ist dann passiert? Bist du dann geflogen, so richtig durch die Luft, wie ein Vogel? Hast du dieses Wunder des Flugs genossen, du Null?« Dann macht er sich über Leute lustig, die sich über Verspätungen aufregen. »Verspätung? Im Ernst? New York nach Kalifornien in fünf Stunden. Das hat mal dreißig Jahre gedauert. Wenn man nicht unterwegs gestorben ist.« Louis erinnert sich daran, wie er 2009 zum ersten Mal Internet im Flugzeug hatte. »Ich sitze im Flieger, und die so, öffnen Sie Ihr Laptop, Sie können ins Internet. Und es war schnell, ich habe mir auf YouTube Filme angeschaut. Das war cool: Ich war im Flieger!« Aber es dauert nicht lange, und das Internet setzt aus. Und der Sitznachbar von Louis wird sauer. »Das ist doch Mist!« Worauf Louis: »Vor zehn Sekunden hat er davon erfahren, dass es das gibt, und jetzt meint er schon, dass es die Welt ihm schuldig ist!«
Was eben noch neu war, ist jetzt schon normal. Sehen Sie sich nur an, wie selbstverständlich Handys heute sind. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, da haben wir mit Münzen in der Tasche geklimpert, nach Telefonzellen gesucht, Treffen verabredet und dann doch verpasst, weil irgendetwas schiefging. Das Handy hat unsere Kommunikation radikal verändert – aber die neue Technik wird vor unseren Augen selbstverständlich und unsichtbar.
130 Millisekunden 100 Millisekunden
3. Wiederholung
6. Wiederholung
12. Wiederholung
24. Wiederholung
Wiederholungsunterdrückung in Aktion8
Magnetenzephalogramm das Gehirns, das im Abstand von 130 bzw. 100 Millisekunden mit demselben akustischen Reiz stimuliert wird. Je häufiger der Reiz wiederholt wird, umso schwächer reagiert das Hörzentrum.
Aber nicht nur der Glanz der Technik verblasst rasch, auch Kunst altert schnell. Wie Marcel Duchamp schrieb:
In fünfzig Jahren kommt eine neue Generation mit einer neuen kritischen Sprache und einem ganz anderen Ansatz. Deshalb geht es darum, ein Gemälde zu schaffen, dass zu unseren Lebzeiten lebendig ist. Kein Gemälde hat eine aktive Lebensdauer von mehr als dreißig oder vierzig Jahren … Nach dreißig oder vierzig Jahren stirbt ein Gemälde, es verliert seine Aura, seine Ausstrahlung, oder wie man es nennen will. Und dann ist es entweder vergessen, oder es geht in die Vorhölle der Kunstgeschichte ein.9
Im Laufe der Zeit werden selbst große Werke, die das Publikum einst erschreckten, entweder salonfähig oder vergessen. Was gestern noch Avantgarde war, ist heute schon normal. Die Speerspitze wird stumpf.
Selbst das beste Unternehmen wird von dieser Normalisierung betroffen. Alle paar Jahre geben Firmen große Summen für Berater aus, die ihnen erklären, dass sie alles auf den Kopf stellen müssen und jetzt zum Beispiel Großraum- statt Einzelbüros brauchen. Aber wie wir noch sehen werden, gibt es keine richtigen Antworten: Es geht allein um die Veränderung. Die Berater haben nicht unrecht, aber was sie im Einzelnen vorschlagen, spielt keine Rolle. Es geht nicht um die perfekte Lösung, sondern um das Neue.
Aber warum passen wir uns so schnell an Veränderungen in unserer Umgebung an? Die Antwort ist der Gewöhnungseffekt oder, genauer gesagt: die Wiederholungsunterdrückung. Wenn sich unser Gehirn an etwas gewöhnt, dann reagiert es mit jeder Begegnung ein bisschen schwächer. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie sehen zum ersten Mal etwas vollkommen Revolutionäres, zum Beispiel ein fahrerloses Auto. Beim ersten Mal rattert Ihr Gehirn heftig. Es nimmt etwas Neues auf und verarbeitet es. Beim zweiten Mal reagiert es schon etwas gelassener: Es interessiert sich weniger dafür, weil es nicht mehr ganz so neu ist. Beim dritten Mal fällt die Reaktion wieder schwächer aus. Und beim vierten Mal noch schwächer.
Je vertrauter etwas ist, umso weniger Energie verwendet unser Gehirn darauf. Deshalb scheint die erste Fahrt zu einem neuen Arbeitsplatz so lange zu dauern. Am zweiten Tag kommt uns die Fahrt schon etwas kürzer vor. Und irgendwann bemerken wir nicht einmal mehr, wie wir die Strecke fahren. Die Welt wird vertraut und nutzt sich ab; was eben noch im Vordergrund war, das tritt in den Hintergrund.
Warum sind wir so? Weil unsere Körper auf die Energie angewiesen sind. Die Orientierung in der Welt ist eine anstrengende Aufgabe und erfordert eine Menge Bewegung und Hirntätigkeit, und beides verbraucht viel Energie. Wenn wir korrekte Vorhersagen treffen, kostet uns das weniger Energie. Wenn wir wissen, dass die essbaren Käfer unter ganz bestimmten Steinen sitzen, dann müssen wir nicht mehr jeden Stein umdrehen und sparen so eine Menge Energie. Je besser unsere Vorhersagen sind, umso weniger Energie verbrauchen wir. Wiederholung verbessert unsere Vorhersagen und optimiert unser Handeln.
Vorhersagbarkeit ist also wünschenswert und nützlich. Aber wenn unsere Gehirne all diese Bemühungen anstellen, um unsere Welt berechenbarer zu machen, dann drängt sich eine Frage auf: Wenn uns so viel an der Vorhersagbarkeit gelegen ist, warum werfen wir dann nicht zum Beispiel unsere Fernsehapparate weg und ersetzen sie durch Geräte, die rund um die Uhr ein gleichförmiges und vorhersagbares Piepsen von sich geben?
Weil keine Überraschung auch nicht gut ist. Je besser wir etwas verstehen, umso weniger Gedanken verschwenden wir darauf. Vertrautheit macht gleichgültig. Der Effekt der Wiederholungsunterdrückung setzt ein, und unsere Aufmerksamkeit lässt nach. Deshalb muss eine Ehe frisch gehalten werden. Deshalb können wir nur einmal über einen Witz lachen. Und deshalb gibt sich selbst der größte Fußballfan nicht damit zufrieden, sich dauernd dasselbe Spiel anzusehen. Vorhersagbarkeit mag beruhigend wirken, doch das Gehirn ist daran interessiert, immer neue Fakten in sein Modell von der Welt aufzunehmen. Und deshalb sucht es das Neue. Denn wenn das Gehirn etwas lernen kann, dann wird es hellwach.
Uns dürstet es immer nach Neuem: In dem Film … und täglich grüßt das Murmeltier muss der Fernsehmeteorologe Phil immer wieder denselben Tag erleben. Gefangen in der Endlosschleife, hat er irgendwann keine Lust mehr, immer dasselbe zu erleben. Also lernt er Französisch, wird Klaviervirtuose, freundet sich mit seinen Nachbarn an und setzt sich für die Schwachen ein.
Warum gefällt uns das? Weil wir keine absolute Vorhersagbarkeit wollen. Wir wollen Überraschungen. Nur so entkommen wir dem Autopiloten. Sie halten unsere Erfahrung frisch.
Es kommt nicht von ungefähr, dass die Neurotransmitter, die mit dem Belohnungssystem unseres Gehirns zusammenhängen, auf Überraschungen anspringen: Regelmäßige und vorhersehbare Belohnungen regen unser Gehirn sehr viel weniger an als unvorhersehbare Belohnungen. Überraschung befriedigt.
Daher folgen Witze einem ganz bestimmten Schema. Es kommen nie zwei Männer in eine Kneipe – es sind immer drei. Warum? Der erste gibt die Geschichte vor, der zweite ein Muster, damit der dritte dagegen verstoßen und die Vorhersage des Gehirns aushebeln kann. Der Witz entsteht durch den Verstoß gegen unsere Erwartungen. Wenn man einem Roboter denselben Witz erzählen würde, dann würde er vermutlich einfach zuhören, was jeder der drei Männer tut, aber den Witz würde er verpassen. Der funktioniert nämlich nur, weil das Gehirn immer Vorhersagen trifft und die Pointe seine Erwartungen auf den Kopf stellt.10
Werbemacher wissen, dass sie dauernd kreativ sein müssen, um unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Mit ihren Werbespots wecken sie unser Interesse an bestimmten Waschmitteln, Kartoffelchips oder Parfüms, aber wenn ihre Spots nicht dauernd frisch sind, nehmen wir sie nicht mehr wahr, und sie verlieren ihre Wirkung.
Die Vermeidung der Wiederholung ist der Ursprung der menschlichen Kultur. Man hört oft, die Geschichte wiederhole sich, doch das stimmt so nicht. Sie reimt sich höchstens, wie Mark Twain meinte. Sie versucht ähnliche Dinge, aber die Details sind immer andere. Alles entwickelt sich. Innovation ist unerlässlich. Menschen wollen Neues.
Wir brauchen also beides. Einerseits will unser Gehirn Energie sparen, indem es die Welt wegerklärt. Andererseits sucht es den Reiz der Überraschung. Wir wollen nicht in einer Endlosschleife leben, aber genausowenig wollen wir ununterbrochen überrascht werden. Wir wollen nicht morgens aufwachen und schon wieder vom Murmeltier begrüßt werden, aber wir wollen auch nicht aufwachen und feststellen, dass sich die Schwerkraft umgekehrt hat und wir an der Decke kleben. Wir brauchen beides: Wir wollen Bekanntes nutzen und Unbekanntes erforschen.
DIE GOLDENE MITTE
Gehirne suchen ein Gleichgewicht zwischen Vertrautem und Neuem und müssen einen Kompromiss zwischen beiden herstellen.11 Nehmen wir an, Sie überlegen, in welches Restaurant Sie Ihre Familie ausführen wollen. Sie können sich für das entscheiden, in das Sie immer gehen, oder Sie können etwas Neues ausprobieren. Wenn Sie sich für das Lieblingsrestaurant der Familie entscheiden, nutzen Sie Ihr Erfahrungswissen. Wenn Sie sich auf kulinarisches Neuland wagen, dann erforschen Sie das Unbekannte.
Tiere suchen diesen Kompromiss irgendwo in der Mitte. Wenn sie aus Erfahrung wissen, dass unter den roten Steinen Würmer sitzen und unter den blauen nicht, dann müssen sie dieses Wissen nutzen. Aber weil die Welt unberechenbar ist, müssen sie trotzdem auch anderswo suchen. Denn eines Tages könnten sie feststellen, dass die Würmer weg sind, zum Beispiel wegen einer Dürre, eines Waldbrands, oder weil ein Konkurrent sie ihnen weggefressen hat. Weil die wenigsten Gesetze dieser Welt unveränderlich sind, müssen Tiere das Gelernte nutzen (unter den roten Steinen liegen Würmer) und gleichzeitig versuchen, neue Entdeckungen zu machen (was mag wohl unter den blauen Steinen liegen?). Deshalb sucht ein Tier überwiegend unter roten Steinen – aber nicht ausschließlich. Hin und wieder sieht es auch unter einem blauen Stein nach, auch wenn es dort in der Vergangenheit keinen Erfolg hatte. Es forscht weiter. Es steckt die Nase auch unter gelbe Steine, in Astlöcher und in den Bach, weil es nie weiß, woher die nächste Mahlzeit kommen wird. So finden Tiere die goldene Mitte zwischen der Ausnutzung von Erlerntem und der Suche nach Neuem.
In ihrer langen Entwicklung haben unsere Gehirne die goldene Mitte gefunden zwischen der Erforschung von Neuem und der Nutzung von Altem, zwischen Flexibilität und Starre. Die Welt soll berechenbar sein, aber auch nicht zu berechenbar: Wir leben im Spannungsfeld zwischen Bekanntem und Unbekanntem. Deshalb gibt es ständig neue Frisuren, Fahrräder, Sportstadien, Schrifttypen, Romane, Moden, Filme, Kücheneinrichtungen oder Autos. Die neuen Erzeugnisse haben große Ähnlichkeit mit ihren Vorgängern, aber sie wandeln diese auch ab. Wenn etwas allzu vorhersehbar ist, dann schauen wir nicht mehr hin, und wenn es zu überraschend ist, dann sind wir verwirrt. Wie wir in den folgenden Kapiteln sehen werden, blüht die Kreativität genau in diesem Spannungsfeld auf.
*
Wir brauchen also Neues, aber in Maßen. Wir wollen Überraschungen, aber wohldosiert. Deshalb gibt es in unserer Welt so viele »Skeuomorphe«: neue Dinge, die sich an Vertrautes anlehnen. Als beispielsweise der iPad auf den Markt kam, hatte er eine Lese-App mit einem Bücherregal aus »Holz«, und die Programmierer gaben sich alle Mühe, damit sich die »Seiten« der Bücher blättern ließen wie die von Büchern aus Papier. Warum erfand man das Buch nicht einfach für das digitale Zeitalter völlig neu? Weil man den Kunden entgegenkommen wollte, und die wünschten sich einen Bezug zum Vertrauten.
Selbst beim Wechsel von einer Technik zur nächsten stellen wir eine Verbindung zum Bekannten her. So hat zum Beispiel die Apple Watch einen Drehknopf, der aussieht wie der Knopf, mit dem man an einer analogen Uhr die Zeiger verstellte und die Feder aufzog. In einem Interview mit der Zeitschrift New Yorker erklärte der Designer Jonathan Ive, er habe den Knopf ein wenig versetzt, um ein Gefühl der »fremden Vertrautheit« herzustellen. Wenn er ihn in die Mitte gesetzt hätte, dann hätten Nutzer vermutlich erwartet, dass er die alte Funktion erfüllt, und wenn er ganz darauf verzichtet hätte, dann hätte die Uhr vielleicht nicht mehr wie eine Uhr ausgesehen.12 Skeuomorphe sind eine Brücke zwischen Alt und Neu.
Unsere Smartphones sind voller Skeuomorphe. Um zu telefonieren, drücken Sie auf das Symbol eines alten Telefonhörers mit Hör- und Sprechmuschel, obwohl sich diese Technik schon vor Jahren verabschiedet hat. Wenn Sie ein Foto machen, spielt das Gerät eine Audiodatei mit einem Kameraklicken ab, obwohl Digitalkameras keine mechanischen Verschlüsse haben. Wir löschen die Nullen und Einsen unserer Apps, indem wir sie in einen »Papierkorb« verschieben. Wir speichern Dateien, indem wir das Symbol einer Diskette anklicken – eine längst ausgestorbene Technik. Wir kaufen Waren im Internet, indem wir sie in den »Warenkorb« legen. Solche Bezüge schaffen einen nahtlosen Übergang von der Vergangenheit in die Zukunft. Selbst unsere modernste Technik ist über eine Nabelschnur mit ihrer Geschichte verbunden.
Diese Goldene Mitte zwischen der Erforschung des Neuen und der Nutzung des Alten ist nicht auf den Menschen beschränkt, aber während Eichhörnchen seit Jahrmillionen in verschiedenen Büschen suchen, haben wir Menschen mit unserer Technologie die Welt erobert. Irgendetwas muss also anders sein am menschlichen Gehirn. Nur was?
WARUM ZOMBIES KEINE HOCHZEIT FEIERN
Wenn Sie mit einem Zombie Essen gehen würden, dann würden Sie vermutlich nicht erwarten, dass er Sie mit einem originellen Einfall überrascht. Warum? Das Verhalten von Zombies ist automatisiert: Sie funktionieren nach vorgegebenen Programmen. Deshalb fahren sie nicht Skateboard, schreiben keine Memoiren, schicken keine Raketen auf den Mond und legen sich keine neuen Frisuren zu.
Zombies sind natürlich nur Filmwesen, aber sie verraten uns etwas über die Natur: Auch die meisten Tiere spulen mit ihrem Verhalten nur feste Programme ab. Zum Beispiel die Biene. Ein Reiz bewirkt jedesmal dieselbe Reaktion, und so entscheidet sich eine Biene zwischen verschiedenen Möglichkeiten wie »auf der blauen Blüte landen« oder »auf der gelben Blüte landen«, »angreifen« oder »wegfliegen«. Aber warum denkt die Biene nicht kreativ? Weil ihre Gehirnzellen starr miteinander verbunden sind und Signale von Input zu Output weitergeben wie eine Kette von Feuerwehrleuten die Wassereimer.13 Im Gehirn der Biene entstehen diese Ketten schon vor der Geburt: Chemische Signale geben die Routen von Gehirnzellen vor und lassen so unterschiedliche Hirnregionen entstehen, die für Bewegung, Hören, Sehen, Riechen und so weiter zuständig sind. Selbst wenn sie neues Territorium erforscht, arbeitet sie hauptsächlich mit Autopilot. Eine Biene lässt genauso wenig mit sich diskutieren wie ein Zombie: Sie ist nichts anderes als eine biologische Maschine, ihr Verhaltensprogramm ist das Ergebnis einer Jahrmillionen langen Evolution.
Auch wir Menschen haben ein wenig von Bienen in uns. Dieselbe neurale Maschinerie ermöglicht uns ein riesiges Portfolio von instinktiven Verhaltensweisen, die vom Gehen und Kauen über Ducken und Ausweichen bis hin zur Verdauung reichen. Außerdem haben wir ein Talent dafür, neue Fähigkeiten so gut zu lernen, dass unser Gehirn sie automatisiert. Wenn Sie Radfahren, Autofahren, Tippen oder mit Messer und Gabel essen lernen, dann ätzen Sie diese Fähigkeiten in schnelle Leiterbahnen auf die Platine Ihres Gehirns, um die Effizienz des Systems zu maximieren.14 Die schnellsten Verbindungen werden gegenüber den langsameren bevorzugt. Hirnzellen, die für eine Aufgabe nicht mehr gebraucht werden, werden nicht mehr aktiviert.
Wenn die Geschichte hier schon zu Ende wäre, dann hätten wir unsere Zivilisationen niemals geschaffen: Es gäbe keine Gedichte, Hubschrauber, Hüpfstelzen, Jazz, Bratwurstbuden, Flaggen, Kaleidoskope, Konfetti und Cocktails. Worin unterscheidet sich also unser Gehirn von dem einer Biene? Das Gehirn einer Biene besteht aus einer Million Zellen, aber das menschliche Gehirn aus Hundert Milliarden und hat damit Spielraum für ein viel größeres Repertoire an Verhaltensweisen. Aber wir haben nicht nur mehr Gehirnzellen, sondern diese Zellen sind auch anders organisiert. Vor allem haben wir mehr Gehirnzellen zwischen Wahrnehmung (»was ist da los?«) und Handlung (»das will ich tun«). So können wir eine Situation registrieren, verarbeiten, Alternativen abwägen und schließlich (wenn nötig) handeln. Ein großer Teil unseres Lebens spielt sich in den Hirnregionen ab, die mit Wahrnehmen und Handeln beschäftigt sind, und deshalb können wir vom Nachdenken zum Erneuern wechseln.
Das gewaltige Wachstum der menschlichen Hirnrinde machte Unmengen von Gehirnzellen unabhängig von frühen chemischen Signalen, weshalb hier flexiblere Verbindungen entstehen können. Diese große Zahl nicht festgelegter Gehirnzellen verleiht uns Menschen eine geistige Flexibilität, die andere Tiere nicht haben. Sie ermöglicht uns »vermittelte« Verhaltensweisen – also Verhaltensweisen, die nicht auf Kommando erfolgen, sondern nach Abwägung.
Im Gegensatz zu den automatischen Verhaltensweisen verlangen nichtautomatische Verhaltensweisen Denken und Voraussicht – nur so können wir ein Gedicht verstehen, ein schwieriges Gespräch mit einer Freundin führen oder neue Lösungen für ein Problem entwickeln. Zu diesem Denken gehört die Suche nach innovativen Ideen. Die Gehirnzellen reagieren nicht auf Knopfdruck, sondern führen eine Art Parlamentsdebatte.15 Alle nehmen an der Diskussion teil. Koalitionen werden geschmiedet. Wenn sich ein Konsens herausschält, kann eine Idee ins Bewusstsein aufsteigen – doch das, was uns wie eine plötzliche Eingebung vorkommt, ist in Wirklichkeit das Ergebnis einer ausführlichen inneren Debatte. Und wenn dieselbe Frage ein weiteres Mal ansteht, kann die Antwort ganz anders ausfallen. Eine Biene würde ihre Königin nicht mit den Geschichten aus Tausendundeiner Nacht umgarnen – es wäre immer dieselbe Nacht, denn das Bienengehirn geht immer denselben Weg. Da unsere Gehirnstruktur jedoch auf Improvisation ausgelegt ist, können wir Geschichten erfinden und unsere Welt neu erfinden.
Menschen leben in einem Spannungsfeld zwischen automatischen Verhaltensweisen, die Gewohnheiten hervorbringen, und nichtautomatischen Verhaltensweisen, die diese durchbrechen. Welches Gehirn ist besser: ein optimiertes und effizientes oder ein verästeltes und flexibles? Die Antwort ist: Wir brauchen beides. Automatisierte Verhaltensweisen machen uns zu Experten: Wenn Bildhauer meißeln, Architekten Gebäude entwerfen oder Wissenschaftler Experimente durchführen, dann hilft ihnen ihr erworbenes Geschick bei der Suche nach neuen Lösungen. Und wenn wir unsere neuen Ideen nicht umsetzen können, dann kämpfen wir für sie. Automatisiertes Verhalten bringt dagegen nichts Neues hervor. Mit vermitteltem Verhalten schaffen wir Neues. Das ist die neurologische Grundlage der Kreativität. Wie Arthur Koestler es ausdrückte: »Kreativität ist Überwindung der Gewohnheit durch Originalität.« Oder um es mit den Worten des Erfinders Charles Kettering zu sagen: »Runter von der Autobahn!«
ZUKUNFTSSZENARIEN
Die große Zahl von Hirnzellen, die zwischen Reiz und Reaktion liegen, ist ebenfalls ein entscheidender Grund für unsere eindrucksvolle Kreativität. Dank ihrer Hilfe können wir über Möglichkeiten nachdenken, die weit über das hinausgehen, was wir direkt vor Augen haben. Und das macht die Magie unseres Gehirns aus: Wir spielen unermüdlich Was wäre wenn.
Überhaupt ist dies eine der wichtigsten Aufgaben des Gehirns: der Entwurf von Zukunftsszenarien.16 Soll ich zustimmend nicken oder dem Chef sagen, dass er Blödsinn daherredet? Will ich heute Abend Chinesisch, Italienisch oder Mexikanisch essen gehen? Wenn ich die Stelle bekomme, sollte ich dann lieber in ein Haus auf dem Land oder in eine Wohnung in der Stadt ziehen? Weil wir nicht alle Möglichkeiten durchprobieren können, um ihre Folgen zu verstehen, simulieren wir sie im Kopf. Nur eines der Szenarien wird schließlich Wirklichkeit (oder auch gar keins), aber indem wir uns auf die verschiedenen Alternativen vorbereiten, können wir flexibler auf die Zukunft reagieren.
Diese Fähigkeit machte uns zu kognitiv modernen Menschen. Bei der Erfindung alternativer Realitäten haben wir es zu einer wahren Meisterschaft gebracht. Wir nehmen das, was ist, und spielen damit Was wäre wenn.
Schon als Kinder simulieren wir die Zukunft: Fantasiespiele sind ein fester Bestandteil der menschlichen Entwicklung.17 In den Gedanken eines Kindes wirbeln Vorstellungen herum, in denen es Präsident wird, zum Mars fliegt und heldenhaft Brände löscht. Mithilfe von Gedankenspielen dieser Art malen sich Kinder immer neue Möglichkeiten aus und sammeln Wissen über ihre Umgebung.
Auch als Erwachsene entwerfen wir Zukunftsszenarien, etwa wenn wir uns Alternativen überlegen oder uns vorstellen, was passiert, wenn wir einen anderen Weg wählen. Wenn wir darüber nachdenken, wo wir wohnen, was wir studieren, wie wir unser Geld anlegen und mit welchem Partner wir unser Leben verbringen wollen, dann ist uns klar, dass die meisten unserer Überlegungen falsch sein oder nie Wirklichkeit werden könnten. Werdende Eltern fragen sich: »Wird es ein Junge oder ein Mädchen?« Weil sie es nicht wissen, legen sie sich Alternativen für Namen, Kleidung, Einrichtung und Spielsachen zurecht. Auch Pinguine, Pferde, Koalas und Giraffen bringen nur ein Junges zur Welt, doch soweit wir wissen, macht sich keine dieser Arten derartige Gedanken.
Dieses Denken in Szenarien ist so alltäglich, dass wir gar nicht mehr bemerken, wie kreativ es eigentlich ist. Mithilfe der Sprache können wir unsere Vorstellungen an andere weitergeben. Wir spekulieren endlos darüber, was hätte sein können: »Wenn du mit zu der Party gekommen wärst, dann hättest du Spaß gehabt.« Oder: »Wenn du die Stelle angenommen hättest, dann wärst du heute reich, aber unglücklich.« Oder: »Wenn der Trainer nicht den Stürmer vom Feld genommen hätte, dann hätten wir gewonnen.«18 Hoffnung ist eine Form der kreativen Spekulation: Wir stellen uns die Welt so vor, wie wir sie gern hätten, und nicht so, wie sie ist. Ohne es zu bemerken, leben wir einen großen Teil unseres Lebens im Konjunktiv.19
Zukunftsszenarien tragen auch zu unserer Sicherheit bei: Wir spielen bestimmte Schritte erst im Kopf durch, ehe wir sie in der wirklichen Welt umsetzen. Deshalb meinte der Philosoph Karl Popper: »Unsere Hypothesen sterben an unserer Stelle.« Wir simulieren die Zukunft (»Was würde passieren, wenn ich von dieser Klippe springe?«) und passen unser künftiges Verhalten daran an (»Ich trete besser einen Schritt zurück«).
Aber wir benutzen dieses Denkinstrument nicht nur, um uns am Leben zu erhalten, sondern um vollständige neue Welten zu erfinden. Diese alternativen Wirklichkeiten sind der Acker, auf dem unsere Fantasie reiche Ernte einholt. Das Was wäre wenn war der Weltraumaufzug, mit dem Einstein die Zeit neu verstand. Das Was wäre wenn entführte Jonathan Swift nach Liliput und ins Land der Riesen. Mit dem Was wäre wenn versetzte sich Shakespeare in Julius Cäsar. Das Was wäre wenn transportierte Alfred Wegener in eine Zeit, in der die Kontinente zusammenhingen. Das Was wäre wenn half Charles Darwin, sich den Ursprung der Arten vorzustellen. Unsere Fähigkeit, uns Zukunftsszenarien auszumalen, ermöglicht unter anderem neue Formen des Reisens. Richard Branson gründete mehr als hundert Unternehmen, darunter eine kommerzielle Fluglinie, die Reisende ins Weltall befördern soll. Worauf er sein unternehmerisches Talent zurückführt? Auf die Fähigkeit, sich Dinge vorzustellen, die nicht auf der Hand liegen.
Aber es gibt noch etwas anderes, das unserer Kreativität Flügel verleiht und das nicht in unserem Kopf zu finden ist: die Gehirne anderer Menschen.
KREATIVITÄT WIRD GESELLSCHAFTLICH BESCHLEUNIGT
Die Freunde F. Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway lebten als arme Schriftsteller in Paris. Der junge Robert Rauschenberg hatte Beziehungen zu Cy Twombly und Jasper Johns, ehe diese berühmt wurden. Die zwanzigjährige Mary Shelley schrieb ihren Roman Frankenstein in einem Sommer, den sie mit den Dichtern Percy Bysshe Shelley und Lord Byron verbrachte.
Wenn man dem Mythos glaubt, dann sind Künstler in der Abgeschiedenheit von der Welt am kreativsten. Die Autorin Joyce Carol Oates schrieb dagegen 1972 in einem Aufsatz: »Dass Künstler fern jeder Gemeinschaft leben müssen, ist ein Märchen … Künstler sind vollkommen normale und normal sozialisierte Menschen, auch wenn die romantische Tradition sie gern als tragische Einzelgänger darstellt.«20
So ziemlich das Schlimmste, was Künstlern passieren kann, ist ein Umfeld, in dem sich niemand für ihre Arbeit interessiert, ihnen niemand Beachtung schenkt und niemand sie unterstützt. Das einsame Genie, das unverstanden in der Wüste lebt, ist eine Märchenfigur. Denn Kreativität ist immer ein sozialer Akt.
Wenige Menschen verkörpern den Mythos des verkannten Genies so sehr wie Vincent van Gogh. Er lebte am Rand des künstlerischen Establishments und verkaufte zu Lebzeiten kaum Bilder. Aber bei genauerem Hinsehen erweist auch er sich als ein Mensch, der mitten im Leben stand: In regen Briefwechseln tauschte er sich mit anderen Malern über die Malerei und andere Künstler aus. Als er seine erste gute Besprechung erhielt, schickte er dem Kritiker zum Dank eine Zypresse. Er und Paul Gauguin planten eine Künstlerkolonie in den Tropen, ehe es zum Zerwürfnis zwischen beiden kam. Warum glauben dann trotzdem noch so viele Menschen, van Gogh sei ein tragischer Einzelgänger gewesen? Weil das unserer Vorstellung des Genies entspricht. Aber diese Vorstellung ist falsch. Van Gogh war weder ein Außenseiter noch ein Eremit, sondern nahm aktiv an der Kunstwelt seiner Zeit teil.21
Und nicht nur Maler sind sozial vernetzt, sondern alle kreativen Menschen. E.O. Wilson schrieb: »Den großen Wissenschaftler, der allein in einem versteckten Labor vor sich hin arbeitet, gibt es nicht.«22 So gern viele Wissenschaftler glauben, dass ihnen ihre Geistesblitze in einsamer Genialität kommen – in Wirklichkeit arbeiten sie in einem Geflecht aus gegenseitigen Abhängigkeiten. Schon die Fragen, mit denen sich Wissenschaftler beschäftigen, stammen aus der kreativen Gemeinschaft: Isaac Newton, einer der größten Denker seiner Zeit, beschäftigte sich ausgiebig mit der Alchemie, die seine Zeitgenossen in Atem hielt.
Wir sind soziale Wesen. Wir arbeiten pausenlos daran, einander zu beeindrucken. Stellen Sie sich vor, Sie würden jedes Mal dasselbe antworten, wenn ein Freund Sie fragt, was Sie heute gemacht haben. Die Freundschaft würde vermutlich nicht sonderlich lange halten. Stattdessen versuchen wir, andere zu überraschen, zu verblüffen und zu erstaunen, und umgekehrt wollen wir von anderen überrascht, verblüfft und erstaunt werden.
Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum Computer nicht sonderlich kreativ sind. Sie spucken nur aus, womit man sie füttert – Telefonnummern, Dokumente, Fotos. Das können sie zugegeben oft besser als unser eigenes Gedächtnis. Aber gerade weil Computer so exakt sind, haben sie kein Talent dafür, Witze zu machen oder zu schmeicheln, um etwas zu erreichen. Oder einen Film zu drehen. Oder einen Vortrag zu halten. Oder einen rührseligen Roman zu schreiben. Damit künstliche Intelligenz kreativ wird, müssten wir eine Gesellschaft von Computern schaffen, die einander überraschen und beeindrucken wollen. Doch der soziale Aspekt von Computern fehlt völlig, weshalb die »Intelligenz« von Computern rein mechanisch bleibt.
ESSEN SIE IHR GEHIRN NICHT AUF
Ein kleines Weichtier namens Seescheide legt ein ganz sonderbares Verhalten an den Tag. Als Larve schwimmt sie umher und sucht sich einen Standort, an den sie sich heften kann. Sobald sie sich niedergelassen hat, frisst sie ihr eigenes Gehirn auf. Warum? Weil sie es nicht mehr braucht. Sie hat ihr festes Zuhause gefunden. Das Gehirn hat ihr geholfen, einen geeigneten Lebensraum zu finden, und nachdem es seinen Zweck erfüllt hat, wird es zum Rohstoff für den Aufbau von anderen Organen. Daraus lernen wir, dass das Gehirn dazu da ist, zu suchen, zu streben und zu entscheiden; wenn sich das Tier niedergelassen hat, hat es seinen Zweck erfüllt.
Wir Menschen neigen nicht dazu, unser eigenes Gehirn aufzufressen, was auch daran liegt, dass wir nie einen Punkt erreichen, an dem wir uns niederlassen. Mit unserem dauernden Drang, Routinen zu bekämpfen, müssen wir kreativ bleiben. In Kunst und Technik suchen wir nicht einfach nur die Befriedigung von Erwartungen, sondern Überraschung. Daher zeichnet sich die Menschheit während ihrer gesamten Geschichte durch ihre überbordende Fantasie aus: Wir bauen wunderliche Wohnräume, bereiten unsere Mahlzeiten nach immer neuen Rezepten zu, kleiden uns in ständig wechselndes Gefieder, kommunizieren mit hochkomplexen Lautgebilden und reisen auf selbst gebauten Rädern und Flügeln von einem Lebensraum zum anderen. Kein Aspekt unseres Lebens bleibt von unserer Genialität verschont.
Bei unserem Hunger nach Neuem wird die Innovation zum obersten Gebot. Und das beschränkt sich nicht auf einige wenige Genies. Der Innovationstrieb ist in jedem Gehirn angelegt, und der daraus resultierende Kampf gegen Eintönigkeit ist der Motor der gewaltigen Veränderungen von einer Generation, einem Jahrzehnt und einem Jahr zum anderen. Der Wunsch, Neues zu schaffen, ist Teil unserer biologischen Ausstattung.
Wir schaffen Hunderte Kulturen und erfinden Abermillionen neue Geschichten. Wir umgeben uns mit Dingen, die es noch nie gegeben hat – etwas, was Schweine, Lamas und Goldfische nicht tun. Aber woher kommen die neuen Ideen?
KAPITEL 2
DAS SCHÖPFERISCHE GEHIRN
A