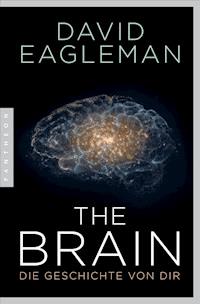
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Unterhaltend und fundiert: Ein Pageturner über die Hirnforschung
Die Hirnforschung macht rasante Fortschritte, aber nur selten treten wir einen Schritt zurück und fragen uns, was es heißt, ein Lebewesen und Mensch zu sein. Der renommierte Neurowissenschaftler David Eagleman nimmt uns mit auf die Reise durch das Gewirr aus Milliarden von Hirnzellen und Billionen von Synapsen – und zu uns selbst.
Das sonderbare Rechengewebe in unserem Schädel ist der Apparat, mit dem wir uns in der Welt orientieren, Entscheidungen treffen und Vorstellungen entwickeln. Seine unendlich vielen Zellen bringen unser Bewusstsein und unsere Träume hervor. In diesem Buch baut Bestsellerautor David Eagleman eine Brücke zwischen der Hirnforschung und uns, den Besitzern eines Gehirns. Er hilft uns, uns selbst zu verstehen. Denn ein besseres Verständnis unseres inneren Kosmos wirft auch ein neues Licht auf unsere persönlichen Beziehungen und unser gesellschaftliches Zusammenleben: wie wir unser Leben lenken, warum wir lieben, was wir für wahr halten, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir unsere Gesellschaftspolitik verbessern und wie wir den menschlichen Körper auf die kommenden Jahrhunderte vorbereiten können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
DAVID EAGLEMAN
THE
BRAIN
DIE GESCHICHTE VON DIR
Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer
Pantheon
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel The Brain. The Story of you bei Canongate Books Ltd, Edinburgh. Copyright © 2015 David Eagleman Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe bei Pantheon Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München, unter Verwendung einer Bildvorlage von Blink Films Satz: Ditta Ahmadi, Berlin ISBN 978-3-641-18315-8 V002 www.pantheon-verlag.de
Inhalt
Einleitung
1 Wer bin ich?
2 Was ist die Wirklichkeit?
3 Wer sitzt am Steuer?
4 Wie entscheide ich?
5 Brauche ich dich?
6 Wer werden wir sein?
Dank
Anmerkungen
Glossar
Bildnachweis
Einleitung
Die Hirnforschung macht rasante Fortschritte, aber nur selten treten wir einen Schritt zurück, um uns einen Überblick zu verschaffen, um zu fragen, was das alles für unser Leben bedeutet, und um uns in einfachen und verständlichen Begriffen klar zu machen, was es heißt, ein Lebewesen und Mensch zu sein. Genau das möchte dieses Buch.
Die Hirnforschung hilft, uns selbst zu verstehen. Das sonderbare Rechengewebe in unserem Schädel ist der Apparat, mit dem wir uns in der Welt orientieren, Entscheidungen treffen und Vorstellungen entwickeln. Seine vielen Milliarden zappender Zellen bringen unser Bewusstsein und unsere Träume hervor. Ein besseres Verständnis unseres Gehirns wirft ein neues Licht auf unsere persönlichen Beziehungen und unser gesellschaftliches Zusammenleben: wie wir kämpfen, warum wir lieben, was wir für wahr halten, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir unsere Gesellschaftspolitik verbessern und wie wir den menschlichen Körper auf die kommenden Jahrhunderte vorbereiten können. Auf den mikroskopisch kleinen Platinen unseres Gehirns ist die Geschichte und Zukunft unserer Art eingeschrieben.
Aber obwohl das Gehirn eine so zentrale Rolle in unserem Leben spielt, sprechen wir kaum darüber und füllen unsere Ätherwellen lieber mit Promiklatsch und Reality Shows. Aber vielleicht ist dieses mangelnde Interesse ja weniger ein Manko als vielmehr ein Hinweis: Wir sind so sehr in unserer Wirklichkeit gefangen, dass wir gar nicht bemerken, dass wir gefangen sind. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es gar nichts zu entdecken gibt: Natürlich ist die Welt farbig. Natürlich funktioniert mein Gedächtnis wie eine Videokamera. Natürlich weiß ich, warum ich manche Dinge glaube.
Dieses Buch nimmt unsere Annahmen unter die Lupe. Es ist kein Lehrbuch, sondern stellt Fragen, die viel weiter gehen: Wie treffen wir unsere Entscheidungen? Wie nehmen wir die Wirklichkeit wahr? Wer sind wir? Wie lenken wir unser Leben? Warum brauchen wir andere Menschen? Und wohin ist unsere Spezies unterwegs, die gerade beginnt, ihre Zügel selbst in die Hand zu nehmen? Dieses Buch will eine Brücke bauen zwischen der Hirnforschung und uns, den Besitzern eines Gehirns. Auf den folgenden Seiten gehe ich anderen Fragen nach als in den wissenschaftlichen Artikeln, die ich für Fachzeitschriften schreibe, und auch der Ansatz ist ein anderer als in meinen bisherigen neurowissenschaftlichen Büchern. Dieses Buch richtet sich an ein anderes Publikum. Es setzt keine Vorkenntnisse voraus – nur Neugierde und die Lust an der Selbsterforschung.
Schnall dich also an und begib dich mit mir auf eine Reise durch unseren inneren Kosmos. Auf der Fahrt durch das unendlich dichte Gewirr aus Milliarden von Hirnzellen und Billionen von Synapsen werden wir etwas entdecken, das du vielleicht gar nicht da vermutet hättest: dich selbst.
1WER BIN ICH?
Jede deiner Erfahrungen – vom einfachen Gespräch bis zur gesamten Kultur – prägt die mikroskopischen Einzelheiten deines Gehirns. Wer du bist, hängt aus Sicht deines Gehirns davon ab, wo du warst. Dein Gehirn ist ständig in Veränderung und schreibt seine Schaltkreise laufend neu. Weil du einmalige Erfahrungen machst, sind auch die filigranen Muster deines riesigen neuronalen Netzes einmalig.Und weil sich diese dein ganzes Leben über unentwegt verändern, ist auch deine Identität immer im Fluss.
Obwohl ich von Beruf Hirnforscher bin, staune ich jedes Mal wieder, wenn ich ein menschliches Gehirn in der Hand halte. Da ist zum einen sein beachtliches Gewicht (das Gehirn eines Erwachsenen wiegt knapp anderthalb Kilogramm), seine merkwürdige Konsistenz (die an festen Wackelpudding erinnert) und die runzelige Gestalt (tiefe Täler, die eine gewölbte Landschaft durchziehen). Aber vor allem verblüfft mich die schiere Körperlichkeit des Gehirns: Dieser unscheinbare Klumpen will so gar nicht zu den komplizierten Vorgängen passen, die sich in seinem Inneren abspielen.
Unsere Gedanken und Träume, Erinnerungen und Erfahrungen stammen alle aus diesem sonderbaren Hirnmaterial. Wer wir sind, ergibt sich aus den komplizierten Mustern seiner elektrochemischen Impulse. Wenn diese Aktivität endet, endest auch du. Wenn diese Aktivität ihren Charakter verändert, sei es durch Verletzungen oder Drogen, dann verändert sich auch dein Charakter. Dein Gehirn ist ganz anders als jedes andere Körperteil: Wenn auch nur ein winziges Stück davon beschädigt wird, bist du nicht mehr wiederzuerkennen. Um zu verstehen, wie das möglich ist, wollen wir am Anfang beginnen.
In diesen anderthalb Kilo Gewebe spielte sich ein ganzes Leben mit all seinen Freuden und Leiden ab.
Unfertig geboren
Wir Menschen kommen hilflos zur Welt. Wir brauchen ein Jahr, um gehen zu lernen, zwei weitere, um einen zusammenhängenden Gedanken zu äußern, und viele mehr, um wirklich für uns selbst sorgen zu können. Wir sind vollkommen abhängig von den Menschen in unserer Umgebung. Bei anderen Säugetieren ist das vollkommen anders. Delfine können schon bei ihrer Geburt schwimmen, Giraffen können innerhalb weniger Stunden stehen und Zebras rennen nach 45 Minuten. Unsere tierischen Verwandten sind schon kurz nach ihrer Geburt erstaunlich selbstständig.
Auf den ersten Blick scheinen die anderen Arten damit einen großen Vorteil zu haben, doch in Wirklichkeit ist es eine Einschränkung. Tierjunge entwickeln sich rasch, weil sich ihre Gehirne weitgehend nach fest vorgegebenen Mustern verschalten. Doch der Preis für diese schnelle Entwicklung ist mangelnde Flexibilität. Stellen wir uns ein argloses Nashorn vor, das plötzlich in die arktische Tundra, auf einen Berggipfel im Himalaja oder eine belebte Straße im Zentrum von Tokio versetzt wird. Es wäre nicht in der Lage, sich anzupassen (weshalb in diesen Gegenden auch keine Nashörner vorkommen). Diese Strategie, den Nachwuchs mit einem weitgehend fertigen Gehirn zur Welt zu bringen, funktioniert nur in bestimmten ökologischen Nischen. Aber wenn ein Tier aus seiner Nische herausgerissen wird, sind seine Überlebenschancen sehr gering.
Wir Menschen können dagegen in sehr unterschiedlichen Ökosystemen überleben, in der Tundra und dem Hochgebirge genauso wie in einer hektischen Großstadt. Das liegt daran, dass wir mit einem unfertigen Gehirn zur Welt kommen. Unser Gehirn ist nicht von Anfang an »fest verdrahtet«, sondern wird erst durch unsere Lebenserfahrungen gestaltet. Deshalb sind wir lange Zeit hilflos, während unser junges Gehirn langsam an seiner Umgebung Form annimmt. Es ist »dynamisch verdrahtet«.
Die Statue im Marmor
Warum ist das junge Gehirn so flexibel? Nicht etwa, weil es noch wächst – im Gegenteil, das Gehirn eines Kindes hat schon genauso viele Zellen wie das eines Erwachsenen. Die Antwort liegt vielmehr darin, wie sich diese Zellen untereinander verbinden.
Bei Geburt sind die Nervenzellen im Gehirn des Säuglings noch weitgehend unverbunden. Dafür vernetzen sie sich in den ersten beiden Lebensjahren umso schneller, während sie über die Sinnesorgane immer neue Informationen aufnehmen. Im Gehirn eines Kleinkindes bilden sich pro Sekunde bis zu zwei Millionen neue Synapsen, wie die Verbindungen genannt werden. Im Alter von zwei Jahren hat ein Kind mehr als 100 Billionen solcher Synapsen – doppelt so viele wie ein Erwachsener.
DYNAMISCHE VERDRAHTUNG
© GlobalP (Nashorn), © LenaSkor (Baby)
Viele Tiere kommen mit festen Instinkten oder Verhaltensweisen zur Welt, weshalb man davon spricht, dass ihre Gehirne »fest verdrahtet« sind. Gene steuern die Entwicklung des Körpers und Gehirns und geben die Eigenschaften und Verhaltensweisen dieser Tiere vor. Wenn eine Fliege beim Anblick eines Schattens flieht, ein Star im Herbst nach Süden fliegt, ein Bär Winterschlaf hält und ein Hund sein Herrchen beschützt, dann handelt es sich um feste Instinkte und Verhaltensweisen. Dank dieser Programmierung können diese Tiere gleich nach der Geburt laufen, fressen und manchmal sogar allein überleben.
Anders der Mensch. Im menschlichen Gehirn ist manches vorgegeben (zum Beispiel Atmung, Weinen, Saugen, Gesichtserkennung und die Fähigkeit, eine Sprache zu erlernen). Aber im Vergleich zum Rest der Tierwelt ist unser Gehirn bei der Geburt unfertig. Der genaue Schaltplan ist nicht vorgegeben. Stattdessen geben die Gene nur eine ungefähre Anleitung für den Aufbau des Netzwerks und erlauben dem Gehirn, sich an die Gegebenheiten anzupassen.
Dank der Formbarkeit des Gehirns konnte der Mensch jedes Ökosystem der Erde besiedeln und die Reise in den Weltraum antreten.
Aber so viele Verbindungen braucht das Gehirn gar nicht. Daher beginnt es auf diesem Höhepunkt, einige davon wieder zu kappen. Während wir heranwachsen, wird die Hälfte der Synapsen wieder zurückgestutzt.
Aber welche Synapsen bleiben und welche müssen wieder weg? Wenn eine Synapse in einen aktiven Schaltkreis eingebunden ist, wird sie gekräftigt, und wenn sie nicht benutzt wird, wird sie schwächer und irgendwann beseitigt. Wie Trampelpfade im Wald verschwinden diejenigen Verbindungen, die wir nicht benutzen.
In gewisser Hinsicht werden wir also zu dem, was wir sind, indem bereits vorhandene Möglichkeiten wieder reduziert werden. Nicht das, was in deinem Gehirn wächst, macht dich aus, sondern das, was daraus entfernt wird.
Im Lauf unserer Kindheit stutzt unsere Umwelt unser Gehirn weiter zurecht, sie lichtet das Dickicht der Möglichkeiten und gestaltet es entsprechend unseren Erfahrungen. Die Verbindungen werden weniger, aber die verbleibenden kräftiger.
Die Sprache, die wir in unserer Kindheit hören (zum Beispiel Deutsch oder Japanisch), schärft beispielsweise unsere Fähigkeit, ganz bestimmte Laute zu unterscheiden; gleichzeitig sind wir immer weniger in der Lage, die Laute anderer Sprachen auseinanderzuhalten. Ein deutsches und ein japanisches Baby können Laute in beiden Sprachen erkennen. Aber im Lauf der Zeit verliert das Baby, das in Japan aufgezogen wird, die Fähigkeit, R und L zu unterscheiden, weil es diesen Unterschied im Japanischen nicht gibt. Wir werden von der Welt geformt, in die wir hineingeboren werden.
Im Gehirn eines Neugeborenen sind die Nervenzellen relativ unverbunden. In den ersten zwei bis drei Jahren wachsen Äste, und die Zellen sind zunehmend vernetzt. Danach werden Verbindungen wieder gekappt und die bis ins Erwachsenenalter hinein verbleibenden werden gestärkt.
© Corel, J. L.
Das Glücksspiel der Natur
Im Lauf unserer langen Kindheit stutzt das Gehirn fortwährend Verbindungen zurück und formt sich nach den Gegebenheiten seines Umfelds. Das ist eine geschickte Strategie, um unser Gehirn an seine Umwelt anzupassen, aber sie hat auch ihre Risiken.
Wenn das heranwachsende Gehirn kein geeignetes Umfeld vorfindet – also keine fürsorgliche und liebevolle Umgebung für das Kind –, dann fällt es ihm schwer, sich normal zu entwickeln. Das musste die Familie Jensen erleben. Das amerikanische Ehepaar Carol und Bill Jensen adoptierte die Kinder Tom, John und Victoria, als diese vier Jahre alt waren. Die Kinder waren Waisen und hatten vor ihrer Adoption unter entsetzlichen Bedingungen in einem staatlichen Waisenhaus in Rumänien gelebt. Und das hatte Folgen für die Entwicklung ihrer Gehirne.
Als die Jensens die Kinder mit dem Taxi aus dem Heim in Rumänien abholten, bat Carol den Taxifahrer zu übersetzen, was die Kinder sagten. Aber der Taxifahrer verstand es selbst nicht. Die Kinder sprachen gar keine richtige Sprache: Da sie ohne normale zwischenmenschliche Beziehungen aufgewachsen waren, hatten sie eine sonderbare eigene Sprache erfunden. Die Entbehrungen ihrer Kindheit hinterließen tiefe Narben, und die Kinder hatten ihr Leben lang mit Lernbehinderungen zu kämpfen.
Tom, John und Victoria erinnern sich nur noch vage an ihre Zeit in Rumänien. Im Gegensatz zu Charles Nelson, Professor und Kinderarzt in einer Kinderklinik in Boston. Er hat noch sehr eindrückliche Bilder von seinen ersten Besuchen im Jahr 1999 im Gedächtnis. Was er in den rumänischen Heimen sah, schockierte ihn. Kleinkinder lagen in ihren Bettchen, ohne dass ihre Sinne in irgendeiner Weise stimuliert wurden. Auf fünfzehn Kinder kam eine Pflegerin, die ausdrücklich Anweisung hatte, die Kinder nicht in den Arm zu nehmen und ihnen keinerlei Zuneigung zu zeigen, selbst dann nicht, wenn sie weinten. Die Verantwortlichen hatten Angst, dass solche Zuwendungen die Kinder veranlassen könnte, mehr zu wollen, was aufgrund des Personalmangels nicht möglich war. Deshalb wurde alles so weit wie möglich rationiert. Die Kinder wurden in Reihen aufs Töpfchen gesetzt. Alle bekamen denselben Haarschnitt, egal ob Junge oder Mädchen. Sie wurden in dieselbe Kleidung gesteckt und nach einem festen Zeitplan gefüttert. Sie wurden abgefertigt wie am Fließband.
Weil niemand auf ihr Weinen reagierte, lernten die Kinder bald, nicht mehr zu weinen. Niemand nahm sie in den Arm, niemand spielte mit ihnen. Ihre körperlichen Grundbedürfnisse wurden zwar befriedigt (sie wurden gefüttert, gewaschen und angezogen), doch sie erhielten keinerlei emotionale Zuwendung, Förderung oder Stimulation. Daher entwickelten sie eine »unterschiedslose Freundlichkeit«. Nelson erinnert sich, dass er beim Betreten eines Raumes von kleinen Kindern umringt wurde, die er noch nie gesehen hatte. Sie bestürmten ihn, wollten in den Arm genommen werden, auf seinem Schoß sitzen, seine Hand nehmen und ihn fortziehen. Dieses Verhalten ist auf den ersten Blick anrührend, doch es ist nichts anderes als eine Bewältigungsstrategie vernachlässigter Kinder und geht Hand in Hand mit langfristigen Bindungsproblemen. Es ist das typische Verhalten von Kindern, die in einem Waisenhaus aufwachsen.
Erschüttert von dem, was sie erlebt hatten, riefen Nelson und sein Team in Bukarest ein Hilfsprogramm ins Leben. Er untersuchte 136 Kinder im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren, die von Geburt an in Waisenhäusern gelebt hatten. Dabei stellte er fest, dass der Intelligenzquotient dieser Kinder zwischen 60 und 80 lag, also weit unter dem Durchschnitt von 100. Die Gehirne dieser Kinder waren unterentwickelt, ihr Spracherwerb stark verzögert. Als Nelson die Kinder mit einem Elektroenzephalographen untersuchte, beobachtete er eine dramatisch verringerte Hirnaktivität.
In einem Umfeld ohne emotionale Zuwendung und kognitive Stimulation kann sich das menschliche Gehirn nicht normal entwickeln.
Nelsons Untersuchung ergab jedoch noch etwas anderes, das Mut macht: Das Gehirn kann den Rückstand bis zu einem gewissen Grad aufholen, wenn die Kinder in ein geschütztes und liebevolles Umfeld kommen. Je jünger ein Kind ist, umso besser. Kinder, die vor dem zweiten Lebensjahr in Pflegefamilien kamen, erholten sich in der Regel gut. Auch ältere Kinder holten auf, aber je nach Alter blieben unterschiedlich schwere Entwicklungsstörungen zurück.
Nelsons Erkenntnis unterstreicht, wie wichtig ein liebevolles und fürsorgliches Umfeld für die Entwicklung des kindlichen Gehirns ist. Und dies wiederum zeigt, wie sehr uns unsere Umwelt zu dem macht, was wir sind. Wir reagieren ausgesprochen sensibel auf unsere Umgebung. Unser Gehirn ist dynamisch verdrahtet, und wer wir sind, hängt entscheidend davon ab, wo wir waren.
RUMÄNIENS KINDERHEIME
© Michael Carroll
Um das Bevölkerungswachstum anzukurbeln, verbot der rumänische Präsident Nicolae Ceauşescu 1966 Verhütung und Abtreibung. Staatliche Gynäkologen, die »Menstruationspolizei«, untersuchten gebärfähige Frauen, damit diese genug Kinder bekamen. Familien mit weniger als fünf Kindern zahlten eine »Zölibatssteuer«. Die Geburtenrate explodierte.
Da sich viele arme Familien ihre Kinder nicht leisten konnten, gaben sie sie in staatliche Heime. Um den rasant steigenden Bedarf zu decken, richtete der Staat immer mehr Kinderheime ein. Als Ceauşescu 1989 gestürzt wurde, lebten 170000 Kinder in solchen Einrichtungen.
Bald deckten Wissenschaftler die Folgen der Kindheit im Heim auf die Gehirnentwicklung auf. Die Untersuchungen beeinflussten die Politik der Regierung. In den folgenden Jahren kehrten die meisten Kinder zu ihren Familien zurück. Seit 2005 dürfen Kinder erst ab zwei Jahren in ein Heim gegeben werden, es sei denn, sie sind schwer behindert.
Überall auf der Welt leben Millionen Waisen in Heimen. Angesichts der großen Bedeutung der fürsorglichen Umgebung müssen dort Bedingungen geschaffen werden, unter denen sich ihre Gehirne normal entwickeln können.
Das jugendliche Gehirn
Noch vor wenigen Jahrzehnten glaubte man, die Entwicklung des menschlichen Gehirns sei mit dem Ende der Kindheit mehr oder weniger abgeschlossen. Heute wissen wir, dass der Prozess etwa 25 Jahre dauert. In der Jugend gehen derart umfassende Umstrukturierungen vor, dass diese Zeit entscheidenden Einfluss darauf hat, wer wir sind. Hormone bewirken eine sichtbare körperliche Verwandlung und machen uns äußerlich zu Erwachsenen. Doch im Verborgenen, in unserem Gehirn, geht eine ähnliche Revolution vor sich. Diese Umwälzungen haben großen Einfluss darauf, wie wir uns verhalten und auf unsere Umwelt reagieren.
Eine dieser Veränderungen betrifft unsere erwachende Selbstwahrnehmung – und die Unsicherheit, die damit einhergeht.
Um zu verstehen, wie das jugendliche Gehirn tickt, führte ich zusammen mit meinem Assistenten Ricky Savjani ein einfaches Experiment durch. Wir baten die Teilnehmer, sich allein auf einen Stuhl in ein Schaufenster zu setzen. Dann zogen wir den Vorhang zurück, sodass die Probanden hinaus auf die Straße schauen und von den Passanten angegafft werden konnten.
Probanden saßen in einem Schaufenster und wurden von Passanten angestarrt. Jugendliche zeigten größere soziale Ängste als Erwachsene, was mit der Entwicklung des jugendlichen Gehirns zusammenhängt.
Ehe wir unsere Testpersonen dieser peinlichen Situation aussetzten, schlossen wir sie an ein Gerät an, um ihre emotionalen Reaktionen zu verfolgen. Dieses Gerät misst die »psychogalvanische Hautreaktion«, an der sich die Nervosität ablesen lässt: Je mehr wir schwitzen, umso leitfähiger wird unsere Haut, und umso stärker schlägt das Gerät aus. (Dieselbe Technik wird übrigens auch beim Lügendetektor verwendet.)
WIE DAS JUGENDLICHE GEHIRN GEFORMT WIRD
© David Eagleman
Kurz vor der Pubertät beginnt eine zweite Phase der Überproduktion: Im präfrontalen Cortex entstehen neue Zellen und Synapsen, und es müssen neue Pfade geformt werden. Auf diesen Überschuss folgt ein Jahrzehnt der Reduzierung: In der Pubertät werden schwächere Verbindungen gekappt und stärkere gekräftigt. In dieser Zeit schrumpft daher der präfrontale Cortex um rund 1 Prozent pro Jahr. Die Herausbildung der Schaltkreise im Jugendalter bereitet uns auf die Lektionen vor, die uns später zu Erwachsenen machen.
Aufgrund der gewaltigen Veränderungen in Hirnregionen, die für höhere Denkfunktionen und Selbstbeherrschung verantwortlich sind, ist die Pubertät eine Zeit der kognitiven Umwälzungen. Der dorsolaterale präfrontale Cortex, der für die Impulskontrolle verantwortlich ist, entwickelt sich zuletzt und wird erst mit Mitte zwanzig erwachsen.
Noch ehe die Neurologen die Details verstanden, hatten Autoversicherer die Folgen der unvollständigen Hirnreife erkannt und verlangten Zuschläge für junge Fahrer. Auch das Strafrecht kennt diesen Unterschied schon lange und behandelt junge Erwachsene oft wie Jugendliche.
An unserem Experiment nahmen sowohl Jugendliche als auch Erwachsene teil. Letztere reagierten wie erwartet mit Stress, wenn sie von fremden Menschen angestarrt wurden. Aber bei den Jugendlichen überschlugen sich die Emotionen: Wenn sie angestarrt wurden, waren einige so nervös, dass sie zitterten.
Warum dieser Unterschied zwischen Erwachsenen und Jugendlichen? Die Antwort hängt mit einer Hirnregion namens medialer präfrontaler Cortex zusammen. Diese Region wird aktiv, wenn du über dich selbst nachdenkst, und vor allem über die emotionale Bedeutung, die eine Situation für dich hat. Leah Somerville von der Universität Harvard fand heraus, dass diese Hirnregion beim Übergang von der Kindheit ins Jugendalter in zwischenmenschlichen Situationen aktiver wird und im Alter von fünfzehn Jahren ihren Höhepunkt erreicht. In diesem Alter haben zwischenmenschliche Situationen ein besonderes emotionales Gewicht, weshalb sie starke Verunsicherung und heftige Stressreaktionen provozieren. Bei Jugendlichen ist die Beschäftigung mit sich selbst, genauer die Selbstbeurteilung, besonders ausgeprägt. Das erwachsene Gehirn hat sich dagegen bereits an eine bestimmte Selbstwahrnehmung gewöhnt, als hätte es ein Paar Schuhe eingelaufen; deshalb macht es Erwachsenen weniger aus, sich in ein Schaufenster zu setzen.
Aber das jugendliche Gehirn ist nicht nur im Umgang mit anderen Menschen verunsichert und emotional überempfindlich, sondern es ist auch besonders risikofreudig. Egal ob es darum geht, mit dem Auto zu rasen oder Nacktfotos ins Internet zu stellen – dem jugendlichen Gehirn erscheinen riskante Verhaltensweisen deutlich attraktiver als dem erwachsenen. Das hat vor allem damit zu tun, wie wir auf Belohnungen und Anreize reagieren. Beim Übergang ins Jugendalter reagieren Hirnregionen, die mit Lustgewinn zusammenhängen (zum Beispiel der sogenannte Nucleus accumbens), zunehmend heftig auf Belohnungen. Bei Jugendlichen sind diese Regionen schon genauso aktiv wie bei Erwachsenen. Es gibt jedoch einen kleinen Unterschied: Der sogenannte orbitofrontale Cortex – die Hirnregion, die mit bewussten Entscheidungen, Aufmerksamkeit und der Einschätzung von Konsequenzen zusammenhängt – ist bei Jugendlichen noch genauso unterentwickelt wie bei Kindern. Diese Kombination aus einem reifen Lustsystem und einem unreifen Entscheidungssystem macht Jugendliche emotional nicht nur empfindlicher, sondern auch unbeherrschter als Erwachsene.
In der Pubertät verändern sich viele Hirnregionen, die mit Belohnung, Planung und Motivation zusammenhängen, weshalb sich unsere Selbstwahrnehmung in diesem Alter stark wandelt.
© Dragonfly Media Group
Somerville hat auch eine Vermutung, warum sich Jugendliche so stark vom Gruppenzwang beeinflussen lassen: Hirnregionen, die mit sozialen Wahrnehmungen zusammenhängen (zum Beispiel der mediale präfrontale Cortex), sind stärker mit anderen Hirnregionen vernetzt, die Motivationen in Handlungen übersetzen (zum Beispiel mit dem Striatum und seinem Netzwerk). Das könnte erklären, warum Jugendliche in der Clique ganz besonders risikofreudig sind.
Dass wir als Jugendliche die Welt anders sehen, ist die Folge der fahrplanmäßigen Umstrukturierungen in unserem Gehirn. Diese Veränderungen machen uns unsicherer, risikofreudiger und empfänglicher für den Einfluss unserer Freunde. Frustrierte Eltern überall auf der Welt sollten eines im Kopf behalten: Wenn ihre jugendlichen Sprösslinge so sind, wie sie sind, dann nicht aus Trotz oder weil sie so sein wollen, sondern weil ihr Gehirn unweigerlich gewaltige neuronale Veränderungen durchmacht.
Plastizität im Erwachsenenalter
Wenn wir das 25. Lebensjahr erreicht haben, sind die Umbauten der Kindheit und Jugend endlich abgeschlossen. Die erdbebenartigen Veränderungen unserer Identität und Persönlichkeit gehören der Vergangenheit an, und unser Gehirn scheint nun vollkommen entwickelt zu sein. Aber wir sollten nicht glauben, dass unsere Persönlichkeit nun für alle Zeiten in Stein gemeißelt ist: Auch im Erwachsenenalter verändert sich das Gehirn ständig weiter. Es ist plastisch wie Knetmasse: Es wird durch Erfahrungen verändert und behält diese Veränderungen bei.
Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie drastisch diese Veränderungen sein können, sehen wir uns die Gehirne einer kleinen Gruppe von Männern und Frauen aus London an: der Taxifahrer der Stadt. Sie müssen einen vierjährigen Intensivkurs absolvieren und zum Abschluss einen Test ablegen, der als einer der schwersten Gedächtnistests überhaupt gilt. Um diesen Test zu bestehen, müssen sich die angehenden Taxifahrer das riesige Straßennetz Londons mit all seinen Winkeln und Windungen einprägen. Die Informationsmenge ist gewaltig: Der Test umfasst 320 verschiedene Routen quer durch die gesamte Metropolregion, 25000 Straßen und 20000 wichtige Orte wie Sehenswürdigkeiten, Hotels, Theater, Restaurants, Botschaften, Polizeireviere, Sportstadien und alle möglichen anderen Orte, wo Fahrgäste hinwollen könnten. Die Teilnehmer bringen in der Regel drei bis vier Stunden am Tag damit zu, theoretische Fahrten durchzuspielen.
Mit einer gewaltigen Gedächtnisleistung prägen sich die Taxifahrer den Londoner Stadtplan ein. Danach sind sie imstande, ohne Karte den kürzesten Weg zwischen zwei Punkten der Stadt zu finden. Dabei verändert sich ihr Gehirn sichtbar.
Die ungewöhnlichen Herausforderungen der Taxifahrerprüfung weckten das Interesse der Hirnforscher des University College in London. Sie unterzogen einige der Fahrer einem Hirnscan. Die Wissenschaftler interessierten sich besonders für eine Hirnregion namens Hippocampus, der für das Gedächtnis und insbesondere für das räumliche Gedächtnis zuständig ist.
Die Wissenschaftler entdeckten sichtbare Veränderungen in den Gehirnen der Taxifahrer: Der hintere Teil ihres Hippocampus war deutlich vergrößert, weshalb sie vermutlich ein besseres räumliches Gedächtnis hatten. Diese Hirnregion war umso größer, je länger die Taxifahrer schon ihrem Beruf nachgingen, was die Vermutung nahelegt, dass sie nicht von vorneherein einen größeren Hippocampus mitbrachten, sondern dass dieser mit der Ausübung des Berufs wuchs.
Die Untersuchung der Taxifahrer zeigt, dass das erwachsene Gehirn nicht starr ist, sondern sich so stark verändern kann, dass die Veränderung mit bloßem Auge erkennbar ist.
Nach dem Intensivkurs war der Hippocampus der Taxifahrer sichtbar vergrößert – ein Ergebnis der verbesserten räumlichen Orientierung.
Taxifahrer sind nicht die einzigen, deren Gehirne sich verändern. Als eines der berühmtesten Gehirne des 20. Jahrhunderts, das Gehirn von Albert Einstein, untersucht wurde, gab es das Geheimnis seiner Genialität nicht preis. Dafür war die Hirnregion, die den Fingern der linken Hand entspricht, vergrößert und bildete ein Omega. Der Grund dafür war Einsteins Leidenschaft für das Geigenspiel. Bei geübten Violinisten wölbt sich diese Region zu einem Omega, weil sie in den Fingern der linken Hand eine außergewöhnliche Geschicklichkeit entwickeln. Bei Klavierspielern ist in beiden Gehirnhälften ein Omega erkennbar, weil sie mit den Fingern beider Hände fein abgestimmte Bewegungen ausführen.
Die Furchen und Wulste des Gehirns sind bei allen Menschen mehr oder weniger gleich. Aber die Feinheiten sind ein persönliches und ganz einmaliges Abbild dessen, wo sie waren und wer sie heute sind. Die meisten Unterschiede sind zwar nicht mit bloßem Auge erkennbar, doch die Summe deiner Erfahrungen prägt die physische Struktur deines Gehirns – vom Ausdruck der Gene über die Position der Moleküle bis zum Aufbau deiner Gehirnzellen. Deine Herkunftsfamilie, deine Kultur, deine Freunde, deine Arbeit, jeder Film, den du gesehen und jedes Gespräch, das du geführt hast – sie alle hinterlassen ihren Fingerabdruck in deinem Nervensystem. Diese unauslöschlichen, winzigen Spuren summieren sich: Sie machen dich zu dem, was du bist, und beschränken, wer du werden kannst.
Albert Einstein und sein Gehirn. A zeigt das Gehirn in der Draufsicht, die Vorderseite ist oben. Die eingefärbte Region ist so stark vergrößert, dass sie sich zu einem umgekehrten Omega wölbt.
© Dean Falk (Einsteins Gehirn)
Krankhafte Veränderungen
Veränderungen in unserem Gehirn sind ein Ergebnis unserer Erfahrungen und machen uns zu dem, was wir sind. Aber was passiert, wenn das Gehirn durch Krankheiten oder Verletzungen verändert wird? Hat das auch einen Einfluss darauf, wer wir sind und was wir tun?
Am 1. August 1966 fuhr Charles Whitman mit dem Aufzug zur Aussichtsterrasse des Turms der University of Texas in Austin. Dann schoss der Fünfundzwanzigjährige willkürlich auf die Menschen, die unter ihm über den Campus gingen. 13 Menschen starben und 23 wurden verletzt, ehe Whitman schließlich von Polizisten erschossen wurde. Als die Beamten sein Haus durchsuchten, stellten sie fest, dass er am Abend zuvor schon seine Frau und seine Mutter umgebracht hatte.
Noch schockierender als diese willkürlichen Gewaltakte selbst war die Tatsache, dass nichts an Charles Whitman auf diese Taten hindeutete. Er war ein Pfadfinder gewesen, arbeitete in einer Bank und studierte Ingenieurwesen.
Polizeifoto der Leiche von Charles Whitman nach seinem Amoklauf. In seinem Abschiedsbrief bat Whitman um eine Autopsie: Er hatte den Verdacht, dass mit seinem Gehirn irgendetwas nicht stimmte.
© Shel Hershorn/Contributor/Getty Images
Kurz nachdem er seine Frau und seine Mutter ermordet hatte, setzte er sich hin und tippte einen Abschiedsbrief:
Seit kurzem verstehe ich mich selbst nicht mehr. Ich halte mich für einen durchschnittlich vernünftigen und intelligenten jungen Mann. Doch in letzter Zeit (ich erinnere mich nicht genau, seit wann) werde ich von ungewöhnlichen und irrationalen Gedanken heimgesucht … Ich möchte, dass nach meinem Tod eine Autopsie vorgenommen wird, um zu sehen, ob es sich um eine erkennbare körperliche Störung handelt.
Diesem Wunsch kamen die Behörden nach. Bei der Autopsie fand der Pathologe einen kleinen Tumor in Whitmans Gehirn. Er war so groß wie eine Cent-Münze und drückte gegen eine Hirnregion namens Amygdala, die an der Entstehung von Angst und Aggressionen beteiligt ist. Der geringe Druck des Tumors auf die Amygdala bewirkte einen Dominoeffekt in Whitmans Gehirn und ließ ihn Dinge tun, die seiner gesunden Persönlichkeit vollkommen widersprachen. Sein Gehirn hatte sich verändert, und er sich mit ihm.
Das ist natürlich ein Extremfall, aber auch weniger dramatische Veränderungen im Gehirn können sich auf unsere Persönlichkeit auswirken. Wir müssen nur schauen, was passiert, wenn wir Alkohol trinken oder Drogen nehmen. Bestimmte Formen der Epilepsie machen Menschen religiöser. Die Parkinson’sche Krankheit lässt viele Menschen dagegen den Glauben verlieren, während die Medikamente zur Behandlung dieser Krankheit die Patienten in zwanghafte Zocker verwandeln können. Aber nicht nur Krankheiten oder Chemikalien verändern uns: Von den Filmen, die wir sehen, bis zu unserer Arbeit trägt alles zu einem ständigen Umbau der Schaltkreise bei, die uns ausmachen. Wer also bist du? Ist da irgendjemand, irgendwo tief in deinem Inneren?
Bin ich die Summe meiner Erinnerungen?
Im Lauf unseres Lebens spielen sich in unseren Gehirnen und Körpern so umfassende Veränderungen ab, dass es schwer ist, sie alle im Blick zu behalten. Unsere roten Blutkörperchen werden beispielsweise alle vier Monate komplett ausgetauscht, und unsere Hautzellen erneuern sich alle paar Wochen. Innerhalb von rund sieben Jahren wird jedes einzelne Atom in unserem Körper durch ein anderes ersetzt. Rein körperlich sind wir täglich ein anderer. Zum Glück scheint es da eine Konstante zu geben, die diese verschiedenen Versionen zusammenhält: die Erinnerung. Könnte es sein, dass die Erinnerung der rote Faden ist, der uns zu dem macht, was wir sind? Sie steht jedenfalls im Mittelpunkt unserer Identität und bietet uns ein bruchloses, beständiges Ich-Gefühl.
Aber vielleicht ist das doch nicht ganz so einfach. Könnte es nicht sein, dass diese Bruchlosigkeit eine Illusion ist? Stell dir vor, du gehst durch einen Park und begegnest dir selbst in unterschiedlichen Lebensabschnitten. Da bist du im Alter von sechs Jahren, als Jugendlicher, Ende zwanzig, Mitte fünfzig, Anfang siebzig und am Ende deines Lebens. Ihr könnt euch alle zusammensetzen und euch über dieselben Erfahrungen austauschen und auf diese Weise den roten Faden deiner Identität bloßlegen.
Oder doch nicht? Ihr habt zwar alle denselben Namen und dieselbe Vergangenheit, aber in Wirklichkeit seid ihr leicht unterschiedliche Menschen mit jeweils eigenen Werten und Zielen. Und eure Erinnerungen haben vielleicht weniger gemeinsam, als du glaubst. Deine Erinnerung daran, wer du mit fünfzehn Jahren warst, hat nicht mehr sehr viel zu tun mit der Person, die du mit fünfzehn tatsächlich warst. Und je nach Lebensabschnitt sieht deine Erinnerung an ein und dasselbe Ereignis anders aus. Warum ist das so? Der Grund liegt in der Natur der Erinnerung selbst.
Stell dir vor, ein Mensch könnte sich selbst in verschiedenen Lebensabschnitten begegnen. Hätten alle dieselben Erinnerungen? Und wenn nicht – sind sie dann wirklich dieselbe Person?
Die Erinnerung ist nämlich keine exakte Videoaufzeichnung eines bestimmten Moments. Es ist vielmehr ein empfindlicher Gehirnzustand einer früheren Zeit, den man wiederbeleben muss, um sich zu erinnern.
Nehmen wir an, ein Freund hat Geburtstag und ihr feiert in einem Café. Jede Erfahrung löst in deinem Gehirn bestimmte Aktivitätsmuster aus. Das Gespräch mit deinen Freunden erzeugt beispielsweise ein bestimmtes Muster, der Duft des Kaffees ein anderes, und der Geschmack des leckeren Kuchens wieder ein anderes. Die Tatsache, dass der Kellner seinen Daumen in der Kaffeetasse hatte, ist ein weiteres erinnerungswürdiges Detail und wird durch eine eigene Konstellation von aktiv feuernden Gehirnzellen repräsentiert. All diese Muster werden in einem gewaltigen assoziativen Netz von Gehirnzellen verknüpft, das der Hippocampus wieder und wieder abspielt, bis die Beziehungen gefestigt sind. Die Gehirnzellen, die gleichzeitig aktiv sind, stärken ihre Verbindungen untereinander. Das Netzwerk, das so entsteht, ist der einmalige Fingerabdruck dieses Ereignisses und damit deine Erinnerung an diese Geburtstagsfeier.
Deine Erinnerung an ein Ereignis wird durch eine einmalige Konstellation von Hirnzellen repräsentiert, die an deiner Erfahrung beteiligt waren.
Stell dir nun vor, sechs Monate später isst du wieder ein Stück von genau demselben Kuchen wie auf der Geburtstagsfeier. Dieser ganz spezielle Schlüssel kann das gesamte Netzwerk von Assoziationen aufschließen. Die ursprüngliche Konstellation wird wieder aktiv und springt an wie die Lichter einer Großstadt in der Dämmerung. Und plötzlich bist du zurück in der Erinnerung.
Aber auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen: Die Erinnerung enthält weniger Details, als wir erwarten. Du weißt, dass deine Freunde da waren. Und das Geburtstagskind muss einen Anzug getragen haben, weil er immer einen Anzug trägt. Seine Freundin hatte eine blaue Bluse an. Oder war sie violett? Oder vielleicht grün? Wenn du in deinem Gedächtnis herumsuchst, stellst du fest, dass du dich auch an die anderen Gäste kaum noch erinnerst.
Deine Erinnerung an die Geburtstagsfeier verblasst also bereits. Warum? Zum einen haben wir nur eine begrenzte Anzahl von Gehirnzellen, die bei allen möglichen Aufgaben gebraucht werden. Jede dieser Zellen wird zu unterschiedlichen Gelegenheiten Teil unterschiedlicher Konstellationen. Sie arbeiten in einer dynamischen Matrix von wechselnden Beziehungen und müssen sich dauernd mit neuen Zellen vernetzen. Deine Erinnerung an die Geburtstagsfeier verschwimmt, weil die »Geburtstagsneuronen« inzwischen auch in anderen Erinnerungsnetzen eingespannt wurden. Der Feind der Erinnerung ist nicht die Zeit, sondern andere Erinnerungen. Jedes neue Ereignis muss neue Beziehungen zwischen einer begrenzten Zahl von Gehirnzellen herstellen. Das eigentlich Erstaunliche ist, dass dir die verblasste Erinnerung gar nicht blass vorkommt. Ganz im Gegenteil hast du das Gefühl oder zumindest die Vermutung, dass du das ganze Bild siehst.
Aber der Gedächtnisinhalt selbst ist noch zweifelhafter. Nehmen wir an, ein Jahr später trennt sich der Freund von seiner Freundin. Wenn du jetzt an die Geburtstagsfeier zurückdenkst, dann meinst du vielleicht fälschlicherweise, schon damals Warnsignale erkannt zu haben. War dein Freund nicht irgendwie ruhiger als sonst? Herrschte nicht manchmal betretenes Schweigen zwischen den beiden? Das lässt sich kaum mit Sicherheit sagen, weil das neue Wissen in deinem Netzwerk die zugehörigen Erinnerungen verändert hat. Ob wir wollen oder nicht, unsere Gegenwart färbt auf unsere Vergangenheit ab. Und so kommt es, dass wir uns je nach Lebensabschnitt anders an ein bestimmtes Ereignis erinnern.
Die Fehlbarkeit der Erinnerung
Wie formbar unsere Erinnerung ist, zeigte Elizabeth Loftus, Professorin an der University of California in Irvine, und veränderte damit die gesamte Gedächtnisforschung.
In einem Experiment zeigte Loftus ihren Versuchsteilnehmern Videos von Autounfällen und stellte ihnen dann eine Reihe von Fragen, um herauszufinden, woran sie sich erinnerten. Dabei stellte sie fest, dass die Fragestellung einen Einfluss darauf hatte, welche Antworten sie bekam. Sie erklärt: »Wenn ich frage: ›Wie schnell waren die Autos, als sie zusammenstießen?‹, dann schätzen die Teilnehmer die Geschwindigkeit anders ein, als wenn ich frage: ›Wie schnell waren die Autos, als sie ineinanderkrachten?‹ Wenn sie das Wort ›krachen‹ hören, schätzen sie die Geschwindigkeit höher ein.« Sie war fasziniert, wie weit sich die Erinnerung durch suggestive Fragen manipulieren ließ, und beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen.





























